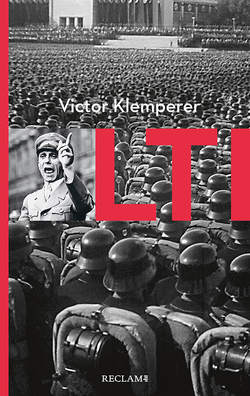Читать книгу LTI - Victor Klemperer - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[110]XVI An einem einzigen Arbeitstag
ОглавлениеDas Gift ist überall. Im Trinkwasser der LTI wird es verschleppt, niemand bleibt davon verschont.
In der Fabrik für Briefumschläge und Papierbeutel, bei Thiemig & Möbius, ging es gar nicht sonderlich nazistisch zu. Der Chef gehörte der SS an, aber er tat für seine Juden, was irgend möglich war, er redete höflich mit ihnen, er ließ ihnen manchmal etwas aus der Kantinenküche zukommen. Ich weiß wahrhaftig nicht, was mich entschiedener oder dauernder tröstete: wenn es ein Endchen Pferdewurst gab, oder wenn ich einmal »Herr Klemperer« oder gar »Herr Professor« tituliert wurde. Die arischen Arbeiter, unter die wir Sternträger verstreut waren – nur beim Essen und während der Luftwache wurde die Absonderung durchgeführt; bei der Arbeit mußte das Plauderverbot uns gegenüber die Isolierung ersetzen, aber niemand hielt es ein –, die Arbeiter waren erst recht nicht nazistisch gesinnt, sie waren es mindestens im Winter 1943/44 nicht mehr. Man fürchtete den Obmann und zwei oder drei Frauen, denen man Denunziationen zutraute, man stieß sich an oder warnte sich durch Blicke, wenn eines dieser Anrüchigen auftauchte; aber waren sie außer Sicht, dann herrschte sofort wieder kameradschaftliche Zutunlichkeit.
Die freundlichste von allen war die bucklige Frieda, die mich angelernt hatte und mir noch immer half, wenn ich mit meiner Kuvertmaschine in Schwierigkeiten geriet. Sie stand seit mehr als dreißig Jahren im Dienst der Firma und ließ sich selbst durch den Obmann nicht davon abbringen, mir irgendein gutmütiges Wort durch den Lärm des Maschinensaals zuzurufen: »Machen Sie sich nicht wichtig! Ich habe nicht mit ihm gesprochen, ich habe ihm eine Dienstanweisung über den Gummierer gegeben!« Frieda wußte, daß meine Frau krank zu Hause lag. Am Morgen fand ich einen großen Apfel mitten auf meiner Maschine. Ich sah zu Friedas Arbeitsplatz hinüber, sie nickte mir zu. Eine Weile später stand sie [111]neben mir: »Für die Mutti mit schönem Gruß von mir.« Und dann, neugierig, verwundert: »der Albert sagt, Ihre Frau ist eine Deutsche. Ist sie wirklich eine Deutsche?« …
Die Freude am Apfel war hin. Dieser Sancta-Simplicitas-Seele, die ganz unnazistisch und ganz menschlich empfand, war das Grundelement des nazistischen Giftes eingeflossen; sie identifizierte das Deutsche mit dem magischen Begriff des Arischen; es schien ihr kaum faßlich, daß mit mir, dem Fremden, der Kreatur aus einer anderen Sparte des Tierreiches, eine Deutsche verheiratet sei, sie hatte »artfremd« und »deutschblütig« und »niederrassig« und »nordisch« und »Rassenschande« allzuoft gehört und nachgesprochen: sie verband sicherlich mit alledem keinen klaren Begriff – aber ihr Gefühl konnte es nicht fassen, daß meine Frau eine Deutsche sein sollte.
Der Albert, von dem ihre Information stammte, war ihr im Denken überlegen. Er hegte seine eigenen politischen Ansichten, und sie waren gar nicht regierungsfreundlich, sie waren auch nicht militaristisch. Er hatte einen Bruder im Felde verloren, er selbst war eines schweren Magenleidens halber bis jetzt bei jeder Musterung zurückgestellt worden. Dies »bis jetzt« konnte man jeden Tag von ihm hören: »Bis jetzt bin ich noch frei – wenn nur der dreckige Krieg zu Ende ist, eh sie mich doch noch holen!« An diesem Apfeltage, der die verschleierte Nachricht von einem Erfolg der Alliierten irgendwo in Italien gebracht hatte, verweilte er im Gespräch mit einem Kameraden etwas länger als sonst bei seinem üblichen Thema. Ich lud unmittelbar neben Alberts Platz Papierstöße für meine Maschine auf einen Karren. »Wenn sie mich nur nicht holen«, sagte er, »bevor der dreckige Krieg zu Ende ist!« – »Aber Mensch, wie soll er denn bloß zu Ende gehen? Niemand will nachgeben.« – »Nu, das ist doch klar: die müssen endlich einsehen, daß wir unbesiegbar sind; sie können uns nicht kleinkriegen, wir sind ja so prima organisiert!« Prima organisiert – da war es wieder, das eingeschluckte, das umnebelnde Rauschgift.
Eine Stunde später rief mich der Meister, ich hatte ihm beim Etikettieren der fertigen Kartons zu helfen. Er selbst schrieb die [112]Etiketten nach der Rechnung aus, ich klebte sie an die hochgetürmten Kartonreihen, hinter deren Wand wir von der übrigen Belegschaft des Saales abgeschlossen standen. Diese Isoliertheit machte den alten Mann gesprächig. Er nähere sich nun den Siebzig und sei noch immer in Arbeit; so habe er sich sein Alter nicht vorgestellt, seufzte er. Aber jetzt müsse man ja wie ein Sklave arbeiten, bis zum Verrecken! »Und was wird aus meinen Enkeln, wenn die Jungen nicht zurückkommen? Der Erhard hat aus Murmansk seit Monaten nichts von sich hören lassen, und der Kleine liegt in einem Lazarett in Italien. Wenn nur endlich Friede käme … Bloß die Amerikaner wollen ihn nicht, dabei haben die gar nichts bei uns zu suchen … Aber sie werden reich durch den Krieg, diese paar Saujuden. Es ist wirklich der ›jüdische Krieg!‹ … Da sind sie schon wieder!«
Er war durch das Sirenengeheul unterbrochen worden; wir bekamen des öfteren unmittelbaren Vollalarm, um diese Zeit wurde auch der Voralarm manchmal überhört, da er allzu üblich geworden war und keine Unterbrechung der Arbeit mehr zur Folge hatte.
Unten im großen Keller saß die Judengruppe um einen Pfeiler herum, zusammengedrängt und deutlich abgetrennt von der arischen Belegschaft. Aber der Abstand von den arischen Bänken war ein geringer, und Unterhaltungen der vorderen Reihen drangen zu uns. Alle zwei, drei Minuten hörte man den Situationsbericht des Lautsprechers. »Der Verband ist nach Südwesten abgeschwenkt … Neues Geschwader nähert sich von Norden. Gefahr eines Angriffes auf Dresden besteht.«
Stocken der Gespräche. Dann sagte eine dicke Frau auf der vordersten Bank, eine sehr fleißige und geschickte Arbeiterin, sie bedient die große komplizierte Maschine der »Fensterkuverts« –, sie sagt es lächelnd mit ruhiger Gewißheit: »Sie kommen nicht, Dresden bleibt verschont.« – »Weshalb?« fragt ihre Nachbarin. »Glaubst du auch den Unsinn, daß sie aus Dresden die Hauptstadt der Tschechoslowakei machen wollen?« – »O nein, ich habe eine bessere Gewißheit.« – »Welche denn?« Die Antwort erfolgt mit einem schwärmerischen Lächeln, das merkwürdig in dem derben und ungeistigen Gesicht steht. »Wir haben es zu dritt deutlich [113]gesehen. Letzten Sonntag mittag bei der Annenkirche. Der Himmel war frei bis auf ein paar Wölkchen. Mit einem Male zog sich die eine dieser kleinen Wolken so zurecht, daß sie ein Gesicht bildete, ein ganz scharfes, ganz einmaliges Profil (sie sagte wirklich ›einmalig‹!). Wir haben es alle drei sofort erkannt. Mein Mann rief zuerst: das ist doch der Alte Fritz, ganz so wie man ihn immer abgebildet sieht!«
»Na, und?« – »Was noch?« – »Was hat das alles mit unserer Sicherheit in Dresden zu tun?« – »Wie kann man so dumm fragen? Ist nicht das Bild, das wir alle drei gesehen haben, mein Mann, mein Schwager und ich, ist es nicht ein sicheres Zeichen dafür, daß der Alte Fritz über Dresden wacht? Und was kann einer Stadt geschehen, die er beschützt? … Hörst du? Da wird schon entwarnt, wir können hinaufgehen.«
Natürlich war es eine Ausnahme, daß sich vier solcher Offenbarungen eines Geisteszustandes in einen Tag zusammendrängten. Aber der Geisteszustand selber beschränkte sich nicht auf den einen Tag und war nicht auf diese vier Leute beschränkt.
Keines dieser vier war ein richtiger Nazi.
Am Abend hatte ich Luftwache; der Weg zum arischen Wachraum führte in ein paar Metern Abstand an meinem Sitzplatz vorbei. Während ich in einem Buch las, grüßte die Fridericus-Schwärmerin im Vorbeigehen laut: »Heil Hitler!« Am nächsten Morgen kam sie zu mir heran und sagte in herzlichem Ton: »Entschuldigen Sie bitte mein ›Heil Hitler!‹ von gestern; ich habe Sie im eiligen Vorbeigehen mit einem verwechselt, den ich so grüßen mußte.«
Keines war ein Nazi, aber vergiftet waren sie alle.