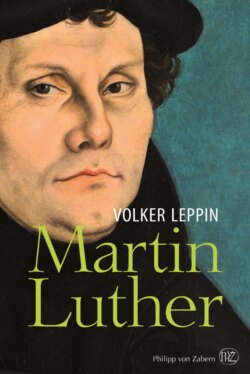Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 10
3. Universitätsbesuch in Erfurt: erste Studien und Öffnung für die Welt der Humanisten
ОглавлениеIm Sommersemester 1501 war das eigentliche Ziel dieser schulischen Ausbildung erreicht: Martin Luder wurde an der Universität Erfurt immatrikuliert.56 Für jemanden aus der Eisenacher Gegend war diese Universität im wahrsten Sinne des Wortes die nächstliegende Möglichkeit: Erfurt war die pulsierende Metropole des Thüringer Gebietes, auch deswegen weil die rechtlich problematische Stellung mit der Zugehörigkeit zum fernen Mainz der Stadt ein großes Maß an Gestaltungsfreiheit gab, wie es sonst eigentlich nur die Reichsstädte besaßen. Die Erfurter Universität, 1392 gegründet, gehörte zu den ältesten Universitäten des Reiches, ihr Nährboden waren die städtischen Schulen gewesen.
Studienbeginn bedeutete im ausgehenden Mittelalter zunächst einmal den Besuch der artes-Fakultät, also ein philosophisches Grundlagenstudium. Hier wurde das Denken nach den Regeln der aristotelischen Philosophie gelernt, ehe man auf einer der höheren Fakultäten – Jura, Medizin oder Theologie – weitere Studien treiben konnte. Der Weg an eine dieser Fakultäten war allerdings ohnehin eher die Ausnahme. Meist begnügte man sich mit dem Erwerb des Baccalaureates nach drei Semestern, um die an der Universität erworbenen Denkfähigkeiten in irgendwelchen Berufsfeldern anzuwenden. Mit der Entscheidung für eine bestimmte Universität und ihre artes-Fakultät war zugleich in der Regel die Entscheidung für eine bestimmte Ausrichtung dieses philosophischen Studiums verbunden: Die spätmittelalterlichen Universitäten im Reich zerfielen aufgrund tief zerklüftender Schulstreitigkeiten in die Via antiqua einerseits, die Via moderna andererseits. Beide Wege hatten sich auf der Basis von Entwicklungen des 14. Jahrhunderts im 15. Jahrhundert formiert. Dabei zeichnete sich die Via moderna vor allem durch einen konsequent sprachkritischen Umgang mit Sprache und Begriffen aus. Mit unterschiedlichen Modellen wurde der Abbildcharakter der Sprache gegenüber der Realität problematisiert, was sich vor allem an der Deutung der Universalien, der Allgemeinbegriffe (wie „Mensch“, „Tier“ oder Ähnliches), festmachte: Im Rahmen der Via moderna konnte man solche Begriffe als bloß begrifflich existent (Konzeptualismus) oder gar als bloß auf willkürlichen Benennungen beruhend (Nominalismus) ansehen, während die Via antiqua davon ausging, dass die darin ausgedrückten Allgemeinheiten tatsächlich in irgendeiner Weise auch in der Realität existierten. Hier berief man sich vor allem auf Thomas von Aquin (1224/5–1274) und andere Lehrer des 13. Jahrhunderts, während die Via moderna insbesondere von Johannes Buridan (vor 1300 – nach 1358) geprägt war. Im ausgehenden 15. Jahrhundert erfuhr allerdings auch ein weiterer früher Vertreter der modernen Philosophie eine starke Renaissance: Wilhelm von Ockham (ca. 1285–1347).57
Dessen neue Betonung ging sogar so weit, dass Luther, der in Erfurt im Rahmen der Via moderna ausgebildet wurde, sich später als jemanden bezeichnen konnte, der der „secten“ der Terministen angehört habe und dessen Lehrer Ockham gewesen sei.58 Vermittelt wurde ihm diese Philosophie, der er aber von Anfang an alles andere als sklavisch verpflichtet war,59 in Erfurt durch Jodokus Trutvetter (gest. 1519) und Bartholomäus Arnoldi von Usingen (ca. 1464–1532). Neben bestimmten materialen Lehren lag der Hauptakzent der Ausbildung in dieser Richtung im Erlernen logischer Denkregeln, die in der spätmittelalterlichen Philosophie aufs Schärfste ausformuliert und durchreflektiert wurden.
Allerdings bestand Luders Erfurter Bildungsweg nicht allein aus dem, was er im offiziellen Studium an der Universität lernen konnte. Hierfür ist eine Notiz des Crotus Rubeanus wichtig, der 1520 an ihn schrieb: „Du warst in unserer Burse ein gut ausgebildeter Philosoph und Musiker“.60 Dies verweist auf zweierlei: die Bedeutung der Burse für die Ausbildung des jungen Studenten und die Bedeutung des Humanismus.61
Die Burse war gewissermaßen das Studentenwohnheim. Luder wohnte vermutlich in der Georgenburse – jedenfalls berichtet mehr als zwanzig Jahre später sein Verwandter Dietrich Lindemann hiervon.62 Das Leben in der Burse hatte etwas Monastisches, war in gewisser Weise dem vergleichbar, was Luder in Magdeburg bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben erlebt hatte, die soziale Kontrolle war sehr hoch. Aber sie eröffnete, wie die Bemerkung des Rubeanus zeigt, auch die Möglichkeit zu gemeinsamen literarischen und musischen Bemühungen.
Wenn Crotus Rubeanus hier von Philosophie spricht, so dürfte er nichts anderes meinen als humanistische Orientierung: Er gehörte zu den wichtigsten Vertretern des Humanismus in Deutschland. Die humanistische Bewegung, der es um eine zunächst stark an den philologisch ausgerichteten studia humanitatis orientierte Rückbesinnung auf die vormittelalterliche Antike ging, zeichnete sich durch eine starke interne Vernetzung aus. Man kommunizierte miteinander durch persönliche Besuche oder durch Briefe, und an verschiedenen Orten bildeten sich in diesem Netzwerk gewissermaßen Knoten, an denen sich die Kommunikation besonders verdichtete. Neben den bedeutenden Zentren des Humanismus im Südwesten – etwa Heidelberg oder Schlettstadt – gehörte Erfurt zu den ganz wichtigen Zentren des Humanismus. Seit 1503 scharte Mutianus Rufus, ein Gothaer Kanoniker, in der nahe gelegenen großen Stadt einen Kreis begeisterter Humanisten um sich, der, einige Jahre nach Luders Studium, 1515, auch literarisch bedeutsam hervortrat: in den „Dunkelmännerbriefen“. Darin wurde mit beißendem satirischen Spott für Johannes Reuchlin (1455–1522) Partei genommen, als diesem vorgeworfen wurde, dass er sich für den Erhalt jüdischer Schriften statt ihrer Verbrennung ausgesprochen hatte – zu den Autoren gehörte auch Crotus Rubeanus.
Diesem engeren Kreis gehörte Luder zwar nicht an, denn er lernte Mutianus Rufus erst 1515 kennen, und es herrschte offenkundig keine gegenseitige Sympathie.63 Doch wird man sich Luder in Erfurt schwerlich allein als eifrigen Studenten der scholastischen Philosophie vorzustellen haben, viel eher als jemanden, der den mit dem Charme der oppositionellen Haltung gegenüber der Universität verbundenen Humanismus wenn nicht aufsog, so doch mitbekam und bejahte. Charakteristisch ist sein späterer Bericht, er habe vor dem Klostereintritt alle seine Bücher an den Buchhändler zurückgegeben außer Plautus und Vergil64 – insbesondere letzterer war nicht erst seit Dante der maßgebliche Wegweiser in die Antike und unter Humanisten ebenso wie Plautus hoch geschätzt.
Dass Luder zudem ein begabter Musiker war, vervollständigt das Charakterbild eines Mannes, den man allzu oft nur mit Büchern zu identifizieren geneigt ist. Das Lautespielen hat er in einer intensiven Krisensituation erlernt: Bei einer Reise zu den Eltern hatte er sich selbst versehentlich mit seinem Degen am Bein lebensgefährlich verletzt und damit wohl erstmals für sich selbst die Nähe des Todes erfahren. Während der folgenden Genesungszeit erlernte er das Lautespielen,65 wohl nicht, wie man früher meinte, im Selbststudium, sondern unter Anleitung von Lehrern.66 Die Erinnerungen des Crotus Rubeanus dürften sich also auf die Zeit kurz nach diesem Ereignis beziehen, das Luder im zügigen Fortgang seines Studiums offenbar nicht behinderte.
Als er 1505 den Magister der artes absolvierte,67 hatte er sich also auch bereits ein Stück Eigenständigkeit gegenüber dem System der scholastischen Universität erworben. Er war nun in jungen Jahren bestens ausgebildet und konnte eine der höheren Fakultäten Medizin, Jura oder Theologie beziehen. In den Augen der ehrgeizigen Aufsteiger-Eltern war klar, dass dies in eine Richtung gehen musste, die weiteren Aufstieg garantierte. Und diese Möglichkeit schien am ehesten an der juristischen Fakultät gegeben.
Im Sommersemester immatrikulierte Martin Luder sich also, unterstützt von seinem Vater, der ihm eine große Anzahl von juristischen Büchern schenkte,68 an der Erfurter rechtswissenschaftlichen Fakultät, deren Studienbetrieb am 19. Mai begann. Seine ureigenste Entscheidung dürfte das nicht gewesen sein.