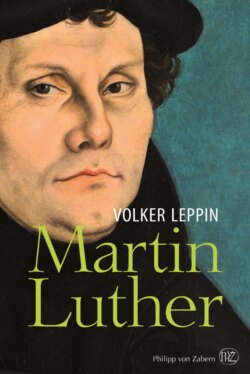Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 6
Vorwort
ОглавлениеRascher als erwartet und heftiger als erwünscht, hat dieses Buch seine Wirkung entfaltet. Bei den scharfen Abwehrreaktionen, die eine Zeit lang das Bild bestimmten, ist es nicht geblieben. Mittlerweile finden sich differenzierende Auseinandersetzung und vielfach positive Aufnahme – wie etwa in der Feststellung Walter Sparns: „Ist das ‚gedankliche Experiment‘ des Autors gelungen? In vieler Hinsicht darf man das bejahen“ (Marburger Jahrbuch Theologie 21 [2009], 151).
Wenn es denn tatsächlich gelungen ist, so in dem Sinne, dass meine Lutherdeutung zu weiteren, durchaus auch kritischen Fragen und Überlegungen provoziert hat. Will man die breite Diskussion in Tageszeitungen, Zeitschriften und auf Tagungen zusammenfassen, die mein Lutherbuch mit seinem ersten Erscheinen national und international ausgelöst hat, so sind es wohl vor allem drei Themenkomplexe, um die die Debatte kreist: Zunächst geht es um die Frage, wie zuverlässig unser vermeintliches Wissen von Luther ist. Es scheint zunehmend klar: jedenfalls weniger zuverlässig, als man lange Zeit einfach voraussetzte. Der kritische Umgang mit Luthers Selbstdarstellungen in diesem Buch ist nach den Standards wissenschaftlichen Arbeitens wohl unumgänglich – auch wenn man im Einzelfall mit guten Gründen zu anderen Ergebnissen der kritischen Lektüre kommen kann, als ich sie vorschlage. Nicht die Zuordnungen im Einzelnen sind entscheidend, sondern ein methodischer Zugriff, der es erlaubt, sich von über Generationen verfestigten Lutherbildern zu lösen, die mancherorts in der Gefahr sind, steril zu werden. Die Debatte um Gedächtnis und Erinnerung, die die Geschichtswissenschaft seit Jahren bestimmt, dürfte nun auch die Diskussion um Luther erreicht haben, und dies gerade rechtzeitig vor dem großen Jubiläumsjahr 2017. Nur mit entschiedener Quellenkritik wird man auch zu einem lebendigen Lutherbild kommen.
Dass dieser methodische Ansatz mich zu der Einsicht geführt hat, dass Luther tiefer im Mittelalter verwurzelt ist, als manchem recht ist, war ein weiterer kontrovers diskutierter Punkt. Dabei handelt es sich hier wohl um kaum mehr als den sehr normalen Vorgang historischer Einordnung. Selbstverständlich entstammt ein Mensch, der im ausgehenden 15. Jahrhundert aufgewachsen ist, dem späten Mittelalter, ebenso selbstverständlich ist er von ihm geprägt. Und selbstverständlich ist es auch, dass das keineswegs ausschließt, Neues bei ihm zu finden, manchmal sogar radikal Neues – so wie bei Luther etwa den Gedanken des allgemeinen Priestertums, den ich in dieser zweiten Auflage wie in der ersten mit dem Begriff „Umsturz“ beschreibe. Die Transformation, die sich mit ihm und der Reformation insgesamt verbindet, ist nur als komplexes Ineinander von Neuheit und Kontinuität zu erfassen. So hat sich denn auch mittlerweile die Debatte über das Reformationsverständnis insgesamt dahin verschoben, dass die Emphase, mit der die epochale Neuheit der Reformation behauptet wurde, immer stärker zurückgenommen wird – so lässt sich im Einzelfall beobachten, dass ein Autor, der noch vor gut zehn Jahren vehement betonte, dass Kirchenhistoriker mit Nachdruck auf dem Epochen charakter der Reformation beharren müssten, jetzt selbst dazu neigt, die Übergänge fließender zu gestalten. Dabei werden die pragmatischen Einteilungen von Mittelalter und Neuzeit nicht hinfällig, aber es gilt unverändert, dass Luther zwischen beidem steht, so wie auch wiederholt sei, dass er weniger der Begründer einer Epoche war als einer, der durch seine Zeitumstände zu dem gemacht wurde, was er war (349). Dass mir gelegentlich vorgeworfen wurde, dass durch solche Wendungen die Epochenschwelle an die Person Luthers gebunden werde, ist, wie Leserinnen und Leser dieses Buches rasch merken werden, eine Verkehrung: Der Luther, der auf den folgenden Seiten vor- und dargestellt wird, ist wie viele andere Zeitgenossen Teil einer sich wandelnden Welt. Dass dieser Wandel hier anhand einer Person dargestellt wird, gehört zum Genre der Biographie.
Die mit der Frage nach der Epoche verbundenen Schwierigkeiten weisen aber auch auf den dritten Diskussionspunkt von Gewicht: Eine wesentliche Anfrage in vielen Rezensionen war die nach dem Verhältnis von Theologie und Biographie in meiner Lutherdarstellung. Tatsächlich ist die Grundentscheidung, die bei mir für diese Frage leitend war, dass ich Theologie so weit zum Tragen kommen lasse, wie es für ein historisches Verständnis des Wirkens Luthers notwendig ist – ein solches wird man in dem vorliegenden Falle schwerlich ohne Theologie erreichen können. Worum es mir aber in diesem Rahmen nicht ging und gehen konnte, war, Luthers Theologie unter dem Gesichtspunkt ihrer über seine Zeit hinausweisenden Bedeutung zu würdigen. Der Ort dafür ist nicht die Biographie. Das heißt nicht, dass ich eine solche nicht auch für einen Beitrag zum theologischen Gespräch hielte – allein schon die Verflüssigung der Grenzen zwischen spätmittelalterlicher und reformatorischer Theologie erhöht etwa die Gesprächsfähigkeit zwischen den heutigen Konfessionen. Ohne Unterschiede leugnen zu müssen, können auf diese Weise gemeinsame Wurzeln heutigen römisch-katholischen und evangelischen Denkens neu wahrgenommen und bedacht werden. Und eine Erweiterung und Vertiefung des Gesprächs zwischen den Konfessionen wäre nicht der schlechteste Beitrag, den eine Luther-Biographie heutzutage bieten könnte.
Auch dies wird wohl umstritten bleiben. Gleichwohl hat bei allen Differenzen die Debatte um mein Lutherbuch an diesen drei Punkten zu einem höheren Maße an Klarheit beigetragen, und so kann ich für die geäußerte Kritik nur dankbar sein. Der Dank gilt auch für die Hinweise auf kleine Versehen, die mir gelegentlich unterlaufen sind und die ich in dieser Neuausgabe korrigieren konnte. Die Mühe, der sich manche Rezensenten bei der ausführlichen Suche nach Fehlern unterzogen haben, war – auch wenn sich in vielen Fällen vermeintliche Fehler als bloße Deutungsunterschiede oder Irrtümer der Rezensenten selbst erwiesen – also nicht umsonst.
Nicht zuletzt aber gilt der Dank den zahlreichen Leserinnen und Lesern, die mich durch Zuschriften oder direkten Kontakt auf Vortragsreisen haben spüren lassen, dass sie das Anliegen der vorliegenden Biographie, Luther als Menschen seiner Zeit zu erfassen, verstanden und aufgegriffen haben. Ich freue mich, weiter von Ihnen zu hören!
Volker Leppin