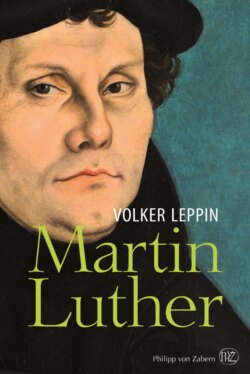Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 13
3. Die Primiz: Abschied und Aussöhnung mit dem Vater
ОглавлениеZentral wurde für Luder der Weg ins Priesteramt. Entscheidend hierfür war nicht etwa ein Theologiestudium, sondern die Weihe, die dem Recht nach nur sehr geringe Kenntnisse voraussetzte. Zentrale Aufgabe des Priesters war die sakramentale Heilsvermittlung, wobei im Zentrum die Messfeier und die Buße mit der mit ihr verbundenen Beichte standen. Die Priesterweihe erhielt Luder wohl am 3. April 1507113 in einer Kreuzgangkapelle des Erfurter Domes114 durch den Mainzer Weihbischof Johann Bonemilch von Laasphe (gest. 1507), also schon bald nach seinem Klostereintritt. Den biographischen Höhepunkt stellte die Primiz in der Augustinerkirche, also der Klosterkirche seines Ordens, dar: die erste Durchführung der Messe in eigener Verantwortung. In ihr wurde die Priesterweihe gewissermaßen öffentlich, und damit handelte es sich um einen entscheidenden Übergangsritus von hoher biographischer Symbolik. Diese erschließt sich aus der Ordnung der mittelalterlichen Sakramente: Während fünf der sieben Sakramente für alle Menschen gleichermaßen gespendet werden – Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße und Letzte Ölung –, repräsentieren zwei Sakramente die biographische Alternative: für den Priester als den herausgehobenen Kleriker die Weihe, für die Weltmenschen die Ehe. Insofern wurde mit der Priesterweihe jene Lebensentscheidung endgültig offenkundig vollzogen, die Luder gegen den Willen seines Vaters getroffen hatte.
So scheint er besonderen Wert auf die Gegenwart des Vaters gelegt zu haben. Erst als der Vater zugestimmt hatte, legte der Konvent den Termin der Primiz auf den Sonntag Cantate, den 2. Mai 1507, fest.115 So wurde der Übergang von den bisherigen familiären Banden in den Priesterstand augenfällig. Und auch der Vater setzte seine eigene Symbolik. Er schickte 20 Gulden für das Festmahl und kam selbst in Begleitung von zwanzig Personen, deren Verpflegung er selbst vollständig finanzierte.116 Deutlicher konnte man die Mitteilung kaum machen: Hans Luder kam als reicher Herr, um seinen Sohn, den Bettelmönch, zu ehren. Es waren unterschiedliche Lebensstile, die hier aufeinanderprallten. Und noch etwas anderes schwang mit, das der entfernt mit Luther verschwägerte Mediziner Matthäus Ratzeberger in seinem fast zehn Jahre nach Luthers Tod verfassten Bericht noch anklingen lässt:
„Da rustet sich der alte Luther hierzu nicht anders, als sollte er ettwa ein hochzeitmal ausrichten, wie es noch an etzlichen ortern Im Babstthumb der brauch ist.“117
Es war die Weggabelung zwischen weltlichem Stand und Klerikerstand, die zelebriert wurde, und der Vater machte das Spiel mit. Seine Generosität dürfte den Tag zusätzlich aufgeladen haben, der ohnehin für Luder großes Gewicht haben musste. Freilich wird man auch hier seine späteren Selbstzeugnisse wie auch die spärlichen Äußerungen aus der Zeit selbst nicht überbelasten dürfen. Dass er in seinem Einladungsschreiben an Johannes Braun, den Erfurter Gefährten, Gottes Gnade und seine eigene Niedrigkeit betont, entspricht monastischem Selbstverständnis und stellt kaum eine übertriebene Ängstlichkeit angesichts der Messe dar. Wenn er Jahre später, 1538, berichtet, er sei bei seiner ersten Messe vor Angst beinahe gestorben, weil es ihm an Glauben gefehlt habe und er nur auf seine eigene Unwürdigkeit gesehen habe,118 so wird eine extreme Stresssituation im Nachhinein theologisch gedeutet. Selbstverständlich brachte das erste Singen einer Messe solchen extremen Stress mit sich, der zwei Seiten besaß, eine professionstheoretische und eine religiöse. Es wäre verfehlt, beide auseinanderzunehmen und Luders Erlebnisse nur in einer rein religiösen Perspektive zu deuten. Diese Erlebnisse sind natürlich gewichtig. Es lag nahe, eine besondere Scheu angesichts des ersten Umgangs mit dem Heiligen, dem Leib Christi selbst, zu entwickeln. Das dürfte hinter jener Erinnerung stecken, nach der Luder beim Sprechen der Worte „Aeterno vivo vero Deo“ – in anderen Erinnerungen nennt er andere Textstellen119 – vor Schrecken beinahe vom Altar fortgelaufen wäre und nur von seinem Prior zurückgehalten werden konnte.120 Zu einer öffentlichen Peinlichkeit wurde dieses Zaudern dank des Eingreifens des Priors offenbar nicht, denn Luther berichtet später, er sei am Tag nach der Primiz auf seinen Vater zugegangen und habe ihn gefragt, warum er ihm zürne, „so es alles wol geratten“121 – eine Frage, die nach einer eben blamabel vollzogenen Primiz schwerlich angemessen gewesen wäre.
Die Ängstlichkeit des jungen Luder bei der Primiz lag vor allem darin begründet, dass ein falsches Sprechen der Worte als Sünde galt.122 Entsprechend war Luders Ängstlichkeit auch keineswegs einmalig. Ähnliches haben Zeitgenossen auch erlebt, und der Versuch, sich der priesterlichen Aufgabe in der Primiz zu entziehen, kam im späten Mittelalter auch sonst durchaus vor.123 Die individuelle Frömmigkeit des jungen Luder besitzt insofern auch einen durchaus typischen Charakter. Und sie ist keineswegs nur auf das Sakrament bezogen. Er habe sich auch „ser gefurcht vorm predigstul“124, berichtet er später, um den jungen Anton Lauterbach zu trösten. Das weitet nun allerdings den Horizont seiner Berichte über die Angst vor der Primiz ganz erheblich aus, insofern es einerseits zeigt, dass es hier nicht nur um eine Furcht vor dem mittelalterlich im Mittelpunkt des priesterlichen liturgischen Vollzugs stehenden Sakrament ging, sondern jedenfalls nach der sekundären Erinnerung auch um eine Furcht vor dem, was typisches Medium evangelischen Gottesdienstes werden sollte: vor der Predigt. Und eben dies kann Luther dann auch auf die Situation eines jungen Geistlichen auf reformatorischer Grundlage beziehen.
Man sollte daher die Erzählungen von einer Furcht vor der Primiz in einen weiteren Horizont als den spezifischer Formen spätmittelalterlicher Frömmigkeit – in den sie natürlich auch gehören – hineinstellen. Neben dieser spezifisch religiösen Dimension und mit ihr verbunden gibt es in Luders Erfahrung seiner Primiz Elemente einer Schwierigkeit, wie sie noch heute in vielen Lebens- und Berufsfeldern nachvollziehbar ist: Die Primiz bedeutete den ersten Schritt in die Öffentlichkeit hinein, das erste Einüben in eine Rolle, für die es feste Schemata gab und in die man sich nicht nur innerlich hineinfinden musste, sondern deren exakte Regeln man auch äußerlich beherrschen musste.125
Diese Ängste und Befürchtungen wurden freilich im frühen 16. Jahrhundert spezifisch religiös ausgelegt, und es liegt nahe, ein solches Verhalten in biblischen Mustern zu verstehen. Man konnte nicht nur wie ein Paulus plötzlich bekehrt werden und darum ins Kloster gehen, man konnte offenbar auch wie ein Mose (Ex 4,1) oder ein Jeremia (Jer 1,6) Angst vor dem göttlichen Auftrag erfahren und sich ihm zu entziehen suchen. Entsprechend darf man nicht vergessen, dass die oben zitierte Äußerung von 1521, nach der der Teufel im ersten Jahr der monastischen Existenz Ruhe gebe, genau dasselbe auch – und sogar zuerst – über das erste Jahr des Priesteramtes sagt.126 Jenes Zagen bei der ersten Messe bedeutete also auch einen Durchgang zu einer beruhigenden und beruhigten Phase des Lebens, zu einer Gewissheit im Priesteramt.
Eher als eine übertriebene Skrupulosität zeigen solche Reaktionsmuster wohl, auch wenn sie typisiert sind, dass Luder zu jenen gehörte, die der neuen Aufgabe mit besonderem Reflexionsaufwand entgegentraten. Er selbst deutet dies einmal so, wenn er erklärt, besondere Angst hätten vor der ersten Messe jene gehabt, „welche frum waren und den es ein ernst war“.127 Das entsprach dem Hintergrund seines Klosters, das ja als Reformkloster in besonderer Weise auf das Frömmigkeitsleben und seine theologische Durchdringung ausgerichtet war und damit einen Frömmigkeitstypus repräsentierte, der seit dem 14. Jahrhundert immer stärker die innere Beteiligung des Priesters – und auch der Gläubigen – an der Messe in das Zentrum gestellt hatte. Messe war in diesem Verständnis keineswegs nur – wie sie in der späteren reformatorischen Polemik auch eines Martin Luther dargestellt wurde – ein objektivierter Akt der Heilsvermittlung, in dem lediglich der Vollzug „ex opere operato“ entscheidend war, die bloße Durchführung des regulären Ritus. Dies entsprach zwar der dogmatisch korrekten Erklärung, aber in der Frömmigkeit handelte es sich um einen Kommunikationsvorgang, für den Verstehen und inneres Beteiligtsein konstitutiv waren. Schon Johannes Tauler (ca. 1300–1361) hatte dazu gemahnt, zu den Messen jener „heiligen Priester […], deren Opfer dem Herrn so angenehm ist“, zu gehen.128 Das war zwar theologisch kaum korrekt, denn nach katholischer Lehre hing die Gottgemäßheit der Messe gerade nicht am einzelnen Priester, aber es entsprach den sich wandelnden, erhöhten Anforderungen an den Priester im Vollzug der Messe. Besonderen Ausdruck fanden diese in einem Werk, das auch Luder ausführlich studierte, der Messerklärung des Tübinger Theologieprofessors Gabriel Biel (ca. 1410–1495): „Canonis missae Expositio“. Hierin wurde in größter Ausführlichkeit jede Einzelheit der Messe beschrieben und erklärt. Ein solches Werk macht deutlich, in welcher Spannbreite sich Priestertum im ausgehenden Mittelalter bewegte. Auf der einen Seite stand jener ungelehrte Dorfpriester, der gerade einmal einige wenige Formeln zu sprechen vermochte, die er selbst oft mangels ausreichender Lateinkenntnisse nicht verstand, am anderen Ende der Skala fand sich der gebildete, in der Regel in einem Orden, zumal in städtischem Kontext wirkende Priester, der bereit und in der Lage war, einen mehrbändigen Folianten durchzuarbeiten, um seine Aufgabe verstehend zu vollziehen. Zu dieser Gruppe gehörte Luder.
Damit sind die berichteten Aussagen über seine Ängstlichkeit angesichts der Messe wohl weniger in den traditionellen Schemata besonderer Skrupulosität zu interpretieren. Am ehesten wird man den jungen Luder professionstheoretisch als einen Vertreter seiner Berufsgruppe zu verstehen haben, der deren moderne Züge, besonders die Hinwendung zum verstehenden Vollzug, aufgriff und voll repräsentierte. Es war keine besondere Skrupulosität, wohl aber eine von vielen geteilte besondere Reflexionsintensität, die ihn auszeichnete und die sich in einer besonderen Polarität verdichtete, die fortan sein Leben prägen sollte: die theologische Reflexion einerseits, die er in den kommenden Jahren als Student der Theologie pflegen sollte, und die innere Beteiligung am religiösen Geschehen andererseits, für die er in den kommenden Jahren Hilfe aus Frömmigkeitstheologie und Mystik erhalten sollte.