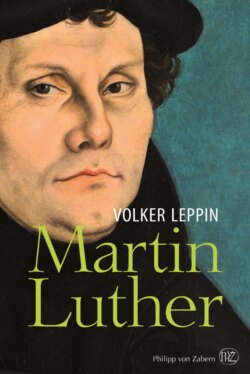Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 14
4. Das Theologiestudium
ОглавлениеWohl kurz nach der Priesterweihe hat Luder das Theologiestudium an der Erfurter Universität aufgenommen, ein weiterer Schritt, der die vollzogene Lebenswende ausdrückte und zugleich befestigte. Damit tritt eine neue prägende Persönlichkeit in seinen Lebensbereich. Für den mit der ewigen Profess versehenen Mönch war nicht mehr der Novizenmeister zuständig, für den Theologiestudenten aber der regens studiorum, der oben schon erwähnte Johannes Natin.129 Luder dürfte vor allem bei ihm und den anderen Lehrern seines Ordens, Leonard Heutleb und Georg Lyser, studiert haben,130 aber Natin hat ihn besonders gefördert.131 Welche Rolle Natin für die Entwicklung Luders spielte, ist schwer zu sagen: In der Erinnerung Luthers haftet jedenfalls am Studienbeginn der Moment, in dem man ihm die Bibel entzogen und ihn stattdessen auf die Sophisten, das heißt die Scholastiker verwiesen habe.132 Das ist eine sekundäre Deutung, aber an ihr mag so viel richtig sein, dass Luder von Natin mehr intellektuelle als spirituelle Anleitung erfahren hat – immerhin aber war Natin so wichtig für ihn, dass er sich von seinem Engagement für die Ordensobservanz gegen mögliche Aufweichungen anstecken ließ (s.u. S. 57).
Bald wurde Luder auch selbst Dozent im Erfurter Augustinerkloster. Das mittelalterliche Studiensystem sah vor, dass Studenten stets auch zugleich Lehrende waren, das heißt, Luder war als Dozent an der artes-Fakultät, die er ja mit dem Magistergrad abgeschlossen hatte, während er zugleich an der theologischen Fakultät, vermutlich vorwiegend bei seinen Ordensbrüdern, Theologie hörte. Es war möglicherweise gerade die Dozentur in den artes, die seinen 1508 erfolgten Wechsel nach Wittenberg mit beeinflusste: An der neu gegründeten sächsischen Landesuniversität stellten die Augustiner-Eremiten einen artes-Dozenten, und die Stelle war nach dem vollständigen Wechsel Wolfgang Ostermairs in die Theologische Fakultät133 gerade vakant. Sie wurde mit Luder besetzt, der von nun an wohl vorwiegend bei Johannes Staupitz, dem Generalvikar seines Ordens, studierte.134
Am 9. März 1509 erlangte Luder in Wittenberg seinen ersten theologischen Abschluss, er wurde Baccalaureus biblicus.135 Das bedeutete, dass er von nun an auch berechtigt war, Vorlesungen in der Theologie zu halten, und zwar über biblische Bücher. Diese ersten biblischen Auslegungen sind nicht erhalten, erinnern aber daran, dass Luder auch in der akademischen Welt keineswegs ausschließlich mit den „Sophisten“ befasst war, sondern sehr wohl auch mit den biblischen Büchern.
Die eigentliche theologische Formierung bedeutete aber für ihn wie für alle mittelalterlichen Theologiestudenten die wenig später, in Erfurt, mit dem Herbst 1509 beginnende Phase als Baccalaureus sententiarius.136 Der Sententiar hatte das grundlegende Werk der mittelalterlichen Theologie zu kommentieren: die Sentenzensammlung des Petrus Lombardus (1095–1160). In vier Büchern hatte der Lombarde den Stoff der Theologie dargeboten, nicht aufgrund eigener Ausführungen, sondern in Gestalt von Väterzitaten, Sentenzen. Dass er über die wichtigste Universität des Mittelalters, die von Paris, Verbreitung gefunden hatte, hatte letztlich dafür gesorgt, dass dieses kompilatorische Werk zum Grundlehrbuch mittelalterlicher Theologie wurde. Jeder Theologiestudent hatte sich in einer Phase seines Studiums kommentierend mit den Sentenzen auseinanderzusetzen und formulierte hier seine ersten theologischen Grundeinsichten. In der Regel dauerte diese Vorlesung zwei Jahre, konnte aber in Erfurt, wohin Luder 1509 zurückkehrte, auch in einem Jahr absolviert werden. Genau dies tat Luder im Studienjahr 1509/10. Die Randbemerkungen, mit denen er sich auf die Vorlesung vorbereitet hat, sind noch erhalten, ebenso wie seine etwa gleichzeitigen Randbemerkungen zu verschiedenen Werken Augustins. Sie zeigen, dass er sich in dieser Anfangszeit seiner akademischen Karriere bereits intensiv mit dem Ordenspatron auseinandersetzte – wiederholt gehen auch die Randbemerkungen zu den Sentenzen auf Augustin ein, und grundsätzlich sieht Luder zu diesem Zeitpunkt noch keinen Gegensatz zwischen Augustin und den Theologen seiner Zeit.137
Insgesamt zeigen diese Randbemerkungen den jungen Luder als einen Theologen, der versucht, die vom Lombarden aufbereiteten theologischen Probleme mit den Mitteln seiner Zeit, und das hieß vor allem mit den Mitteln der Logik und Grammatik, wie er sie als Schüler der Via moderna gelernt hatte, zu lösen. Charakteristisch ist schon allein die Art der Probleme, mit denen er sich befasst. Breiten Raum nehmen in seinen Randbemerkungen zwar einerseits – dies erwartet man aufgrund der späteren Entwicklungen – die Fragen von Sünde und Gnade ein, andererseits aber, und noch umfangreicher, die Probleme der Trinitätslehre und der Zwei-Naturen-Christologie, also die Lehre von dem Gott, der zugleich ein Wesen und drei Personen ist, und die Lehre von Jesus Christus als dem in menschlicher und göttlicher Natur Begegnenden.138 Das zeigt ein – auch durch die ausführliche Kommentierung von Augustins „De Trinitate“ unterstrichenes – Interesse an den spekulativen Themen der Theologie, wie es charakteristisch für Theologen war, die gewohnt waren, ihren Stoff logisch zu durchdringen, und die darum gerade in diesen Problemkomplexen auf besondere Schwierigkeiten stießen.
Auch methodisch ist Luder ganz an der spätmittelalterlichen Logik orientiert. So verwendet er viel Mühe darauf, im Blick auf die als Überzeitlichkeit verstandene Ewigkeit Gottes deutlich zu machen, dass über ihn allgemeine Sätze in der Vergangenheit – es geht um den Satz „Alles, was er wollte, hat er getan“ – eigentlich nicht isoliert aussagbar seien, sondern sie stets zugleich auch im Präsens und im Futur gelten müssten.139 Noch spezifischer ist, dass in seiner Auseinandersetzung mit der Trinitätslehre klassischerweise die Suppositionslehre eine zentrale Rolle spielt,140 die seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert dazu diente, sprachlogisch zu erklären, wie sich sprachliche Zeichen auf Realität beziehen, nämlich durch ein Stehen-für, ein Supponieren. Diese banal erscheinende Erklärung diente dazu, die Diskrepanz zwischen Realität und dem Reden über Realität zu erklären, insofern sie deutlich machte, dass die sprachlichen Ausdrücke keine unmittelbaren Abbilder der Realität waren. Dies war also ein klassischer Ausdruck der sprachphilosophisch orientierten Via moderna. Ganz auf dieser sprachphilosophischen Denklinie kommt auch Luder zu dem Ergebnis, dass es keine Namen gebe, die im eigentlichen Sinne direkt von Gott aussagbar seien, dessen Natur selbst unaussprechlich sei.141 Hier könnten die sprachkritischen Einsichten aus der Philosophie mit Lehren aus der dionysischen Mystik verbunden sein, in der die „theologia negativa“ eine entscheidende Rolle spielte, nach der von Gott nur negative Aussagen möglich sind.142 Freilich zeigt sich auch eine gewisse Skepsis gegenüber der Philosophie, wenn Luder in der Innenseite des Einbanddeckels den Lombarden lobt, „dass er in allem sich so auf die Lichter der Kirche stützt, am allermeisten auf den hell strahlenden und niemals genug gelobten Augustin, dass er, was auch immer von der Philosophie angstvoll ausgelegt wird, für fraglich zu halten scheint“.143 Und in einem der Randkommentare zu Augustins „De vera religione“ kann er sich sogar zu der Bemerkung steigern, dass die gesamte Philosophie als Torheit erwiesen werde.144 Solche Sätze lassen aufhorchen, wenn man sie mit dem Wissen liest, dass Luder nicht einmal ein Jahrzehnt später aufs Schärfste den im Mittelalter üblichen Gebrauch des Aristoteles in der Theologie angreifen wird (s.u. S. 101f.). Aber sie sind nicht wirklich in dem Sinne belastbar, dass man hier Anfänge dieser späteren Entwicklung greifen könnte. Dafür ist das Genre der Randbemerkungen zu unsystematisch und willkürlich. So kann Luder einerseits, wie oben geschildert, positiv an die sprachphilosophischen Entwicklungen der Via moderna anknüpfen, andererseits die zeitgenössischen Philosophen schelten, dass sie sich zu sehr mit bloßem Wortgeklapper abgäben.145 Hier ringt ein humanistisch gelehrter und scholastisch ausgebildeter junger Theologe noch um die eigene Position, formuliert selbstbewusst und heftig, aber deutet noch keineswegs, nicht einmal in nuce, ein konsistentes theologischphilosophisches Programm an. Auch das Bekenntnis zur Schrift, das Luder formuliert, wird man nicht von seiner späteren Sola-scriptura-Lehre her zu verstehen haben. Eine Kritik des Lombarden an einer verbreiteten Auffassung bekräftigt er mit der Bemerkung: „Auch wenn viele berühmte Gelehrte so denken, so haben sie dennoch für sich keine Schrift, sondern allein menschliche Vernunftüberlegungen. Ich aber habe für diese Meinung einen Schriftbeleg, dass die Seele das Abbild Gottes sei. Daher sage ich mit dem Apostel: ‚Wenn ein Engel vom Himmel‘, das heißt, ein Gelehrter in der Kirche, ‚anderes gelehrt hat, sei er verworfen‘“.146 Dass auch Kirchenväter unter der Schrift stehen, gehörte innermittelalterlich durchaus zu verbreiteten hermeneutischen Überlegungen – zumal Luder ja in dem Bewusstsein schrieb, an den Lombarden anknüpfen zu können. Der von ihm unterstellte und praktizierte Normalfall war die Harmonie zwischen Kirchenlehrern und Schrift, nicht der hier angesprochene Konfliktfall. Grundsätzlich galten die Kirchenväter selbstverständlich als Autoritäten,147 an denen man sich zu orientieren hatte. Markant ist lediglich der Gegensatz zwischen Offenbartem und menschlichen Vernunftschlüssen: Dies durchzieht Luders Theologie von früh an – freilich ist auch dies keineswegs ein von anderen deutlich abweichendes Merkmal. Und die Konsequenzen werden nicht überspitzt, sondern völlig selbstverständlich erscheint auch Aristoteles als „authoritas“.148
Noch deutlicher ist die Ferne zu anderen späteren Einsichten, wenn man die Rechtfertigungslehre und die mit ihr verbundene Anthropologie ansieht. Für den Luder der Sentenzenrandbemerkungen ist es noch völlig selbstverständlich, dass die Ursünde den Menschen als Zunder („fomes“) antreibt, während er später in dieser Ursünde die ganze Verderbtheit der menschlichen Natur sah.149 Und über den Glauben, der die Rechtfertigung bewirkt – diese Auffassung fand er selbstverständlich auch beim Lombarden vor –, erklärte er ausdrücklich, es handele sich um einen Glauben, der mit Liebe und Hoffnung verbunden sei,150 also gerade nicht der Glaube allein, der später in den Mittelpunkt seines Denkens rückte.
Mit anderen Worten: Wüsste man nicht, dass diese Randbemerkungen von Luder stammen, so käme man aufgrund einer Analyse ihres Inhaltes schwerlich darauf. Sie repräsentieren den üblichen theologischen Diskurs des späten Mittelalters, in dem in einer Sachfrage auch einmal „beinahe alle Sentenzenkommentare“ als irrend bezeichnet werden können.151 Es zeigt sich ein kritischer, an den Kirchenvätern orientierter, aber keineswegs von der Scholastik gelöster, aufstrebender junger Theologe. Dass er Karriere innerhalb des mittelalterlichen Systems hätte machen können, ist von diesen frühen Äußerungen her keineswegs eine ausgeschlossene Möglichkeit. Er fand sich in seine neue Rolle ein, und dies auf der Höhe der Zeit.