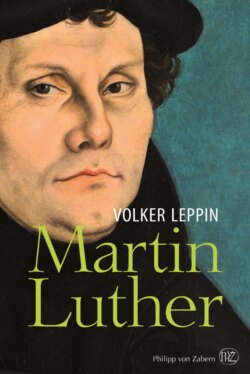Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 15
5. Im Dienste des Ordens: die Reise nach Rom
ОглавлениеZu den Besonderheiten der Amtszeit Johannes’ von Staupitz als Generalvikar der reformierten Ordenskongregation gehörte es, dass er 1509 zudem zum Ordensgeneral der sächsisch-thüringischen Ordensprovinz des Gesamtordens gewählt wurde,152 also eine Funktion innerhalb des konventualen Ordenszweiges mit seiner Führungsfunktion innerhalb der Reformkongregation verband. Das bot die einmalige Chance, beides wieder zusammenzuführen und damit den ärgerlichen Riss durch den Orden zu heilen. Tatsächlich versuchte Staupitz rasch, eine Union der Ordenszweige herbeizuführen, doch es kam noch im Jahr 1510 zu massivem Widerstand. Zunächst regte er sich im observanten Kloster Nürnberg, schließlich umfasste er eine Reihe von sieben Konventen, unter denen auch der Erfurter war.153 Die Sorge der Konvente war, dass eine Vereinigung mit den Konventualen ihre eigene Observanz gefährden und aufweichen könne. Die ältere Forschung war der Meinung, Luder sei im Auftrag dieser Staupitz-Gegner 1510 nach Rom aufgebrochen. Nach den jüngsten Forschungen von Hans Schneider muss man dies aber umschreiben: Es scheint, dass Luder erst nachdem er im Herbst 1511 nach Wittenberg gewechselt war, nach Rom aufgebrochen ist, dies allerdings dann recht bald154. Damit ist ein eigenartiges Problem der älteren Lutherbiographien155 gelöst: Früher musste man erklären, wie es gekommen sein sollte, dass Luder unmittelbar nachdem er im Protest gegen Staupitz nach Wittenberg gewechselt war, nach Wittenberg ging und dort zum treuesten Anhänger von Staupitz wurde – zu einem so treuen gar, dass er später stolz verkünden konnte, er habe nicht zu den vielen Schützlingen Staupitz’ gehört, die ihm, als sie ihn nicht mehr brauchten, „ynn die hand geschissen“ hätten156. Das hat er nachher nicht getan – und offenbar auch vorher nicht: Nicht im Namen der Opposition gegen Staupitz reiste er zur Ordensspitze nach Rom, sondern im Einvernehmen mit ihm und, zusammen mit seinem Ordensbruder Johann von Mecheln157, als sein Gesandter. Damit ändert sich nicht nur der Zweck der Reise, sondern auch ihr Zeitpunkt: Gängigerweise hatte man sie auf den Jahresübergang 1510/11 datiert. Nach Schneiders minutiöser Rekonstruktion muss man nun die Reise nun wohl auch 1511/12 datieren. Demnach wäre Luder als Begleiter und „zweiter Mann“158 neben Johannes von Mecheln wohl Anfang Oktober in Wittenberg zu einem weiten Fußmarsch aufgebrochen und im Laufe des Novembers in Rom angekommen159. Wo die Brüder Quartier nahmen, ist nicht ganz gesichert, da es zwei Niederlassungen der Augustiner-Eremiten in Rom gab. Gegenüber der traditionellen Annahme, sie hätten bei der observanten Kongregation in Santa Maria del Popolo Quartier genommen, also unmittelbar am Ortseingang von Norden, überwiegt heute die Auffassung, sie hätten zentraler, bei den Konventualen in S. Agostino gewohnt.160 Diese Frage lässt sich nicht klären, aber unzweifelhaft wird man davon ausgehen können, dass Rom ein nachhaltiges Erlebnis für Luder bedeutete. Er erinnert sich später, er sei beim Anblick Roms niedergefallen und habe: „Sei gegrüßt, heiliges Rom!“ ausgerufen.161 Tatsächlich war Rom die heiligste Stadt, die man sich vorstellen konnte: Ausgezeichnet durch die doppelte Apostolizität, die Reliquien der Apos telfürsten Petrus und Paulus, war es seit dem Jahr 1300 aufs Engste mit der Möglichkeit, Ablass zu erwerben, verbunden. Entsprechend überfüllt war die Stadt von Menschen, die sich hier eine besondere religiöse Begnadung erwarteten: Der ältere Luther erinnert sich, dass es in der Lateranbasilika gelegentlich ein solches Gedränge gab, dass es ihm gar nicht gelang, bis zum Altar vorzudringen.162 Dass er dies überhaupt versuchte, zeigt, dass auch er selbst sich offenbar ganz selbstverständlich mit dem Gedanken getragen hat, durch Gebete in Rom Ablass für seine Verwandten zu erwerben, auch wenn mancher spätere Hinweis hierauf von der Ironie des auf jene Frömmigkeit zurückblickenden Reformators geprägt ist163: „und war mir dazumal schier leid, das mein vater und mutter noch lebeten, Denn ich hette sie gern aus dem fegfeuer erlöset mit meinen Messen und ander mehr trefflichen wercken und gebeten“164. Zentral in seinen Erinnerungen ist die Heilige Treppe am Lateranpalast. Hier handelte es sich nach der frommen Legende um die nach Rom transferierte Treppe aus dem Palast des Pilatus, die Jesus Christus zu seinem Prozess emporgeschritten war. Wie zahlreiche andere Gläubige auch rutschte Luder sie, Stufe für Stufe ein Vaterunser betend, auf den Knien hinauf, im Glauben und in der Erwartung, hierdurch seinen Großvater erlösen zu können.165
Auch dürfte er die sieben Stationskirchen – und andere Kirchen – besucht haben, wenn er später berichtet, er sei „durch alle kirchen und klufften“ gelaufen.166 Besonders im Jubeljahr, aber nicht nur dann war dieser Besuch mit Ablässen verbunden, gab er doch die Möglichkeit, den großen Heiligen der ewigen Stadt näher zu kommen. Auch die Fülle von Messen, die er zelebrierte,167 ist Ausdruck jener spätmittelalterlichen Frömmigkeit, die sich das Heilige als räumlich, geographisch greifbar und damit als an bestimmten Stätten besonders konzentriert vorstellte. Luder partizipierte überzeugt an dieser Frömmigkeit, wenn auch offenbar mit einer gewissen naiven Zurückhaltung des aus der fernen deutschen Provinz kommenden Mönchs, der an dem professionellen Betrieb der Weltmetropole kaum aktiv teilnehmen konnte.168 Auch seine Erinnerungen an die lockere, ironisch gefärbte Renaissancekultur der Stadt dürften neben einer Überlagerung durch sich steigernde Polemik gegen Rom im reformatorischen Lager169 einen zutreffenden Kern enthalten. So etwa, wenn er das Erschrecken über Prostitution eng zusammenfasst mit der Erinnerung an Priester, die statt der Worte, durch die sich nach mittelalterlicher Lehre das Brot des Abendmahls in den Leib Christi wandeln sollte, in blasphemischer Weise sagten: „Brot bist du und Brot wirst du bleiben“.170 Selbst wenn diese Erinnerung zugespitzt und verfärbt sein sollte, spiegelt sich in ihr wohl doch wider, dass Luder jenen Ernst, der ihn selbst beim Vollzug seiner ersten Messe zugleich getragen und belastet hatte, in jenem Rom, das von einem hastigen geschäftigen Messbetrieb und intellektuellem Spott bestimmt war,171 in der Regel nicht wiederfand. Dass Rom in besonderer Weise ein Ort von Laster und Unfrömmigkeit war, war eine Erfahrung, die im späten Mittelalter nicht nur Luder machte, und Luther ist nicht der einzige, der von den Schrecken in Rom berichtet. Die bekannteste Variante ist vielleicht jene Anekdote aus Boccaccios Decamerone, nach der ein alter Jude nach Rom gereist und dort zum Christentum bekehrt worden sei. Darauf angesprochen, wie dies denn möglich sei, erklärte er, eine Religion, an deren Spitze so viele Verbrechen wie in Rom geschähen und die sich dennoch immer weiter erhalte und ausbreite, müsse wahrer und heiliger sein als jede andere Religion.172
Auch diese Erfahrungen aber waren eher Irritation als tief greifende Erschütterung, verdichteten sich erst im Nachhinein zu einem Gesamtbild des Schreckens. Wenn Luther später erklärt, es sei der göttliche Ratschluss gewesen, der ihn nach Rom gebracht habe, damit er den Sitz des Teufels sehe,173 so entspringt dies seiner späteren, erst sehr zögerlich vorgenommenen Identifizierung von Papst und Antichrist, nicht aber seiner zeitgenössischen Wahrnehmung. Gerade an diesem Punkt kann man die Genese einer Legende wahrnehmen: Nur wenn Luders Romerfahrung tatsächlich so erschütternd gewesen wäre, wäre plausibel, was – immerhin – sein Sohn 1582 berichtet, nämlich dass Luder in Rom zur Erkenntnis des Evangeliums gekommen sei.174 So drückt diese Erzählung mehr von der im ausgehenden 16. Jahrhundert im Luthertum gewonnenen Überzeugung aus, dass die Entdeckung des Evangeliums und die Gegnerschaft zum Papst unmittelbar zusammenhingen, als von der wahrscheinlichen historischen Gegebenheit, die Luder als einen nach Maßgabe seiner Zeit frommen und gerade darum irritierten Rompilger vermuten lässt. Noch 1519 teilte er die allgemeine Romfrömmigkeit und verwies auf den besonderen spirituellen Vorrang der ewigen Stadt.175
Über die Verhandlungen, deretwegen Luder eigentlich nach Rom gereist war, erfährt man von ihm selbst, aber auch aus Ordensakten wenig. Es scheint, dass die beiden vor allem die Mahnung an Staupitz mitnahmen, den Streit bald zu beruhigen176. Das erfolgte dann auch: Anfang Mai 1512 nahm Luder – wohl um aus Rom zu berichten – an einem Ordenskapitel in Köln teil177, das der Befriedung des Ordens diente. Diese erfolgte freilich auf Kosten von Staupitz: Er musste den Plan, die Reformkongregation mit der sächsischen Ordensprovinz zu vereinigen, aufgeben und beschränkte sich fortan auf seine Funktion als Generalvikat der Ersteren178.
Für Luder aber brachte das Kapitel eine entscheidende Entwicklung: Noch in Köln wurde er zum Subprior des Wittenberger Klosters gewählt179 und kam damit endgültig, wie auch sein Vertrauter Johannes Lang, nach Wittenberg, in jene Stadt, die von nun an seinen Lebensumkreis bestimmen, in gewisser Hinsicht im Laufe seines Lebens auch zunehmend begrenzen und einengen sollte. Seit 1511 ist der Mittelpunkt seines Lebens an der mittleren Elbe, in einer kleinen Residenz- und Universitätsstadt, die ihren bald wachsenden Ruhm ihm verdankte.
Und er ist im Umkreis einer neuen überragenden Persönlichkeit. Erst von jetzt an wird Staupitz zu der Figur, die sein Denken und seine Frömmigkeit prägt. Der ferne Generalvikar und Leiter der Reformkongregation ist nun Luders Mitbruder im Wittenberger Konvent; jedoch ist Staupitz nach Niederlegung seiner dortigen Professur 1512 nicht mehr allzu häufig anwesend. Lieber hält er sich im Südosten des Reichs, in München und in Salzburg, auf.180 Dennoch wird man den Wechsel der Vaterfigur in Luders Biographie nicht unterschätzen dürfen, der mit der römischen Episode verbunden ist: Von dem gelehrten, an scholastischer Theologie orientierten Natin kommt Luder nun in den Einflussbereich des souveränen Ordensmanagers, der zugleich von einer zutiefst innerlichen Frömmigkeit und Theologie geprägt ist – und der auch Luder selbst hierin so sehr prägen sollte, dass dieser Jahrzehnte später feststellte: „Staupicius hat die doctrinam angefangen“181.
Auch Staupitz seinerseits wusste, was er an dem jungen Mönch hatte. Er bestimmte ihn nicht nur zu seinem Nachfolger in der Wittenberger Professur, sondern im Mai 1515 auch zum Provinzialvikar der Reformkongregation in Meißen und Thüringen. Als solcher war er nun auch in leitender Funktion für sein früheres Erfurter Kloster verantwortlich.182 Diese Schritte zeigen, dass Luder in Staupitz nicht nur in dem weiter unten noch auszuführenden Sinne einer endlich tief greifenden Hilfe in seinen Anfechtungen einen geistlichen Vater gefunden hatte. Staupitz führte auch in gewisser Hinsicht das Werk des leiblichen Vaters fort. Hatte dieser seinem Sohn eine Aufsteigermentalität einzuimpfen versucht, so verhalf Staupitz Luder nun zu einem rasanten Aufstieg: mit noch nicht 30 Jahren Theologieprofessor, daneben mit 31 Jahren in einer leitenden Ordensfunktion. Staupitz baute den jungen Mann auf, half ihm zu einer Karriere, deren Rahmen seinen eigenen Vorgaben einer moderaten spätmittelalterlichen Reform entsprach. Luder war, das sollte man bei seiner späteren Absage an das späte Mittelalter nicht vergessen, im Rahmen eben dieser Epoche ein ausgesprochener Erfolgsmensch.