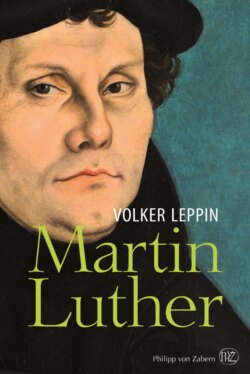Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 8
I. Der Sohn: zu Höherem bestimmt 1. Herkunft und Familie
Оглавление„Ich bekenne, dass ich Sohn eines Bauern aus Möhra bei Eisenach bin, bin dennoch Doktor der Heiligen Schrift, des Papstes Feind“.1 Knapp verdichtet Martin Luther in einer Tischrede drei Generationen, die Geschichte eines sozialen Aufstiegs,2 der schon das Elternhaus prägte und in ihm, dem Gelehrten und Reformator, seinen Gipfel fand.3
Bauer in Möhra, wenige Kilometer südlich von Eisenach, war sein Großvater Heine Luder gewesen – Luder: so war die üblichere Schreibweise des Namens, erst später, im Zuge seiner theologischen Entwicklung sollte der Enkel Martin beginnen, seinen Namen mit „th“ zu schreiben. Entsprechend soll er auch im Folgenden bis zu diesem Jahr als Martin Luder gelten.4 Er besaß offenkundig Ansehen und einen geringen, relativen wirtschaftlichen Wohlstand in dem kleinen Dorf, jedenfalls konnte er mit Margarete Ziegler eine Tochter aus der reichsten örtlichen Bauernfamilie heiraten. Das hiesige Erbrecht brachte es mit sich, dass sein Sohn Hans als einer der älteren Söhne nicht erbberechtigt war.5 Schon Luthers Vater also war keineswegs mehr Bauer, sondern schlug einen anderen Weg ein, der geographische und soziale Mobilität bedeutete. Dass dieser Weg zu einem Aufstieg führen sollte, macht schon die Eheschließung klar: Margarete Lindemann6 kam aus einer der angesehensten Eisenacher Familien – und hier gab es, im Unterschied zur bäuerlichen Familie aus Möhra, auch durchaus bereits die Tradition akademischer Studien an der nahe gelegenen Erfurter Universität.7 Das „Bekenntnis“, Sohn eines Bauern zu sein, bedeutet angesichts dessen auch eine gewisse Selbststilisierung. Der familiäre Hintergrund Luthers war durchaus komplex, fern von einer einfachen bäuerlichen Existenz, eher aus einer dynamischen Mischung: der zur Selbständigkeit und Mobilität gezwungene Vater, die aus besseren Kreisen stammende Mutter – das ist nicht das sesshafte Milieu des einfachen Landlebens, sondern das Milieu sozialen Aufstiegs, eben jenes Aufstiegs, den der Sohn später in sich erfüllt sah.
Tatsächlich hatte der Vater, trotz zeitweiliger Schwierigkeiten, wirtschaftlichen Erfolg. Er wandte sich dem Bergbau zu, genau das war auch der Grund für den Umzug in die Grafschaft Mansfeld, wo der Kupferbergbau blühte8 und ein System von Verpachtungen den wegen des Kapitalaufwandes risikoreichen, aber im Erfolgsfall äußerst lukrativen Einstieg in das zukunftsträchtige Geschäft ermöglichte. Als Hans und Margarete Luder aus der Eisenacher Gegend hierher aufbrachen, hatten sie nach einer späteren Erinnerung Luthers bereits einen Sohn,9 der aber früh verstorben zu sein scheint. Am 10. November 1483 wurde ihnen ein weiterer Sohn geboren.10 Als man ihn am folgenden Tag zur Taufe brachte, wurde ihm nach einem verbreiteten Brauch der Name des Tagesheiligen gegeben: Martin. Allein schon diese Namensnennung macht die Tagesangaben einigermaßen gewiss, sehr viel unsicherer ist das Jahr der Geburt.11 Luther selbst, der wie die meisten Zeitgenossen keinen großen Wert auf die genaue Festlegung seines Geburtsjahres gelegt hat, schreibt später einmal, er sei im Jahre 1484 geboren,12 und dies wird vor allem durch seinen Wittenberger Gefährten Philipp Melanchthon unterstützt – nicht zuletzt weil das Jahr 1484 auch eine astrologisch günstige Prognose ermöglichte. Erst nach Luthers Tod hat Melanchthon aufgrund der familiären Tradition das Jahr 1483 als Geburtsjahr favorisiert und so langfristig in das Gedächtnis des Luthertums eingebrannt, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten sich bis zum Erweis des Gegenteils weiter um dieses Jahr ranken werden. Historisch bleibt es mit einem Fragezeichen zu versehen.
In Eisleben, der heutigen „Lutherstadt“, ist die Familie nur kurz geblieben, bald erfolgte der Wechsel nach Mansfeld. Hier konnte Hans Luder eine Hütte pachten und wurde damit zu einer Art Kleinunternehmer, dem es oblag, im Auftrag größerer Handelsgesellschaften Rohkupfer zu erwerben und daraus edleres Silber und Kupfer zu gewinnen.13 Dieser Prozess brachte einerseits Abhängigkeiten von den größeren Gesellschaften, andererseits einen enormen Kapitalaufwand mit sich – es handelte sich um erste Formen frühkapitalistischen Wirtschaftens im Bergbau, mit all der damit verbundenen Unsicherheit der sozialen Existenz. Die Arbeit – des Vaters außer Haus, der Mutter in der Haushaltsführung – dürfte alles, was man heute unter „Erziehung“ fassen würde, dominiert haben. Die Berichte Luthers über sein Elternhaus sind spärlich und geben von der emotionalen Situation in der Familie wenig wieder.14 Letztlich reduzieren sie sich für beide Eltern auf Konfliktsituationen. So heißt es vom Vater: „Mein Vater stäubte mich einmal so sehr, dass ich vor ihm floh und dass ihm bang war, bis er mich wieder an ihn gewöhnt hatte“15, und, kaum angenehmer, über die Mutter: „Meine Mutter stäubte mich wegen einer einzigen Nuss bis aufs Blut“16. Dass Luther beides kritisch erinnert und berichtet und auch Folgerungen für die Erziehung der eigenen Kinder anschließt, zeigt, dass solche Erziehungsmaßnahmen auch im 16. Jahrhundert keineswegs nur selbstverständlich waren, und doch lässt sich nicht erkennen, dass das Haus Luder besonders streng gewesen wäre – schon gar nicht, wie beide Zitate zeigen, dass der Vater allein streng gewesen wäre. Es ist die Atmosphäre eines hart arbeitenden und sparenden Elternhauses, die hier erscheint – aber es war kein Haus ohne emotionale Bindung: Kehrseite der Härte war ja die Furcht des Vaters, seinen Sohn zu sehr gestraft zu haben. Sonst wäre ihm nicht bang gewesen, bis er wieder mit dem Sohn versöhnt war. Und man wird es auch nicht als bloßen Topos abtun dürfen, dass Luther nach der Nachricht vom Tod seines Vaters betont, dass er traurig seiner überaus süßen Liebe gedenke, und erklärt, alles, was ihm sein Schöpfer gegeben habe, habe er durch den Vater erhalten,17 denn sein Begleiter auf der Coburg, von wo aus er 1530 dies schrieb, Veit Dietrich, berichtet auch, dass Luther nach Empfang der Nachricht vom Tod seines Vaters lange geweint habe.18 Die verteilten, spärlichen Äußerungen lassen eine wenig sensationelle Bandbreite der Gefühle zwischen Härte und Zuwendung erkennen, kaum ein Satz findet sich, der jenseits allgemeiner Erziehungsvorstellungen der Zeit individuelle Züge aufscheinen ließe.
Luthers Vater Hans Luder. Gemälde von Lucas Cranach d.Ä., 1527.
So reichen die Erinnerungen Luthers an die Eltern weder dazu aus, ein volles Bild seiner Erziehung zu zeichnen, noch auch dazu, ihre Charaktere – über das hinaus, was Cranachs Porträts vermuten lassen – näher zu beschreiben. Gerne wird hier auf einen Bericht Luthers verwiesen, nach dem seine Mutter immer wieder das Lied „Mir und dir ist niemand hold, das ist unser beider schuld“ gesungen habe19 – aber allein schon die Tatsache, dass Luther diesen Spruch selbst als gängiges Diktum voraussetzt,20 zeigt, wie wenig man hieraus erschließen kann. Sicher ist es keine besonders lebenslustige Frömmigkeit, die aus diesen Zeilen spricht,21 aber ob dies allein die Lebenshaltung der Mutter prägte, ist nicht zu erschließen. Nach einer späteren Erinnerung dürfte es im Hause Luder auch einen sachten Antiklerikalismus gegeben haben,22 jedenfalls berichtet Luther 1545, sein Vater habe generell Mönche und Priester verachtet, die sich nur im Kirchenrecht umtäten.23 Diese späte Erinnerung steht zwar auf nicht ganz sicheren Füßen, aber sie besitzt doch eine gewisse Plausibilität, da sie gut zu der Mentalität eines hart arbeitenden Aufsteigers passt, der auf die vergeistigten Mönche und Priester hinabschaute.
Luthers Mutter Margarete, geb. Lindemann. Gemälde von Lucas Cranach d.Ä., um 1527.
Doch selbst wenn ein solcher Antiklerikalismus vorhanden gewesen sein sollte, verhinderte er nicht eine gewisse, unter Umständen freilich sehr rudimentäre, katechetische Grundkenntnis im Hause Luder. Hierfür und für eine daran orientierte Lebensnormierung spricht die scharfe Frage, die Luder und seine Primizgäste im Blick auf seinen gegen den Willen des Vaters – und der in diesem Zusammenhang von Luther nur selten erwähnten Mutter24 – vollzogenen Klostereintritt zu hören bekamen: „Ei, liebe Herren, wisst ihr auch, dass geschrieben steht: ‚Du sollst Vater und Mutter ehren? Oder kennt ihr das Gebot Gottes, die Eltern zu ehren, nicht?“25
Solche positiven Elemente christlicher Erziehung und Normierung erscheinen in den Relikten, die Rückschlüsse auf die elterliche Frömmigkeit zulassen, freilich weniger als Momente einer angstbesetzten Frömmigkeit. Eine starke Rolle scheint im Glauben des Elternhauses der Satan gespielt zu haben: So wie der Vater fürchtete, Martins Entschluss zum Klostereintritt könne durch den Teufel hervorgerufen sein,26 so versicherte Martin selbst seinem Vater später, seit seiner Kindheit habe er geglaubt, in besonderer Weise den Angriffen des Satans ausgesetzt gewesen zu sein.27 Dieser Teufel ist ein real im Leben erfahrbares Gegenüber. Gerne spricht Luther von seinem Kampf mit ihm.28 Solcher Glaube an den kraftvoll ins Leben hineinwirkenden Teufel ist im späten Mittelalter keineswegs ungewöhnlich – und er wird auch den Reformator sein Leben lang begleiten: In einer seiner letzten Schriften schreibt er „Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft“29. Die Teufelsvorstellungen sind dabei von jener Alternative, die der Vater aufmacht – was der Sohn als Gottes Führung empfindet, könnte Verführung des Teufels sein – nicht ganz fern. Selbst in einer seiner am stärksten um Gelehrsamkeit auf der Höhe der Zeit bemühten Schriften, der gegen den Humanisten Erasmus von Rotterdam gerichteten Ausführung „De servo arbitrio“ von 1525, schildert Luther den Menschen als ein Reittier, das mal von Gott, mal vom Teufel geritten wird.30 Solche hart an Dualismus grenzenden Aussagen haben Heiko Augustinus Oberman zu der treffenden Charakteristik Luthers als „Mensch zwischen Gott und Teufel“ geführt.31 Wenn irgendwo, dann ist hier das Erbe der Frömmigkeit des Elternhauses spürbar – und wohl auch in dem vor allem am Richter im Jüngsten Gericht orientierten schreckerfüllten Christusbild, das Luther später als große Problematik seiner klösterlichen Existenz beschreibt.32 Nach einer beiläufigen Erwähnung im Galaterkommentar der dreißiger Jahre nämlich war er tatsächlich seit seiner Kindheit daran gewöhnt, allein schon beim Hören des Namens Christi zu erschrecken, weil er ihn als Richter angesehen habe.33 Zu einer solchen Verankerung des strengen Christusbildes schon im Elternhaus34 und nicht erst, wie er an anderen Stellen immer wieder suggeriert,35 im Kloster passt auch die Tatsache, dass, wie unten (Kapitel 2) noch näher dargestellt werden wird, gerade die für Luders spirituelle Begleitung im Kloster Zuständigen – der Novizenmeister wie später der Beichtvater Staupitz – von Anfang an dem schreckerfüllten Christusbild ein positives, optimistisches entgegenzustellen suchten. Solche spirituelle Berater zeigen, dass Luthers spätere Behauptung, die Angst vor Christus sei „in papatu“ verbreitet gewesen,36 in dieser Pauschalität kaum zutrifft. Gleichwohl trifft sie einen nicht unerheblichen Teil spätmittelalterlicher Religiosität: Während es einerseits eine Auffassung gab, die in Christus die „nahe Gnade“ erfuhr,37 sprechen Bilder von Christus mit dem Schwert des Gerichts doch auch eine deutliche Sprache von der mit dem Erlöser und Heiland verbundenen Furcht der Menschen vor dem Richterwort. Es scheint diese Tendenz innerhalb der spätmittelalterlichen Frömmigkeit gewesen zu sein, die Luders Elternhaus prägte. Hierfür spricht neben der enormen Prägekraft, die es für Luther hatte, auch die Tatsache, dass ein solches Christusbild, wie noch in einer späten Erinnerung Luthers aufscheint, aufs Beste zu der Satansfurcht des Elternhauses passte38:
„Also ist es eine schädliche Sache, dass man unter dem Papst die Leute gelehrt hat, vor Christus zu fliehen. Ich hörte nicht gern, dass man ihn nannte, weil man mich so unterwiesen hatte, dass ich Genugtuung für meine Sünde leisten müsse und dass Christus am Jüngsten Tage sagen werde: ‚Wie hast du die zehn Gebote gehalten? Wie deinen Stand?‘ Wenn ich ihn gemalt sah, erschrak ich vor ihm wie vor dem Teufel, weil ich sein Gericht nicht ertragen konnte.“39
Es wäre allerdings verengend, die Wirkung des Elternhauses auf Martin Luder nur im Zusammenhang seiner Frömmigkeit zu suchen. Viel wichtiger dürfte ein anderer Bereich gewesen sein, in dem der Sohn zeitlebens Sohn blieb: Jene Aufsteigermentalität, die die Eltern prägt, nimmt er in sein Leben mit. Die Eltern achteten von Anfang an darauf, dass der Sohn eine gute schulische Bildung erhielt – in der Zeit einer „Bildungskonjunktur“ (Dieter Stievermann) für Eltern, die ihrem Kind das Beste wünschten, durchaus nicht überraschend, brauchte man doch allerorten für die Verwaltung des entstehenden modernen Staates gut ausgebildete Fachleute.40 Luder sollte nach dem Wunsch der Eltern einer von ihnen sein, dafür wurde auch der Besuch auswärtiger Schulen in Kauf genommen.