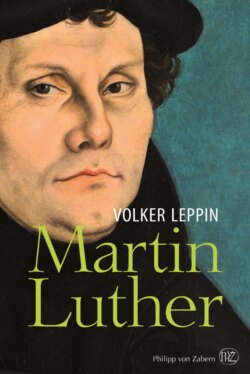Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 11
II. Der Mönch 1. Der Klostereintritt
ОглавлениеEnde Juni 1505 reiste Martin Luder zu seinen Eltern nach Mansfeld. Über die Gründe dieser Reise ist nichts bekannt, aber spätere Äußerungen Luthers lassen Vermutungen zu. 1521 schreibt er in einem Widmungsschreiben an seinen Vater:
„Es sind nun fast sechzehn Jahre her, seit ich gegen Deinen Willen und ohne Dein Wissen Mönch geworden bin. In väterlicher Sorge wegen meiner Anfälligkeit – ich war ein Jüngling von eben zweiundzwanzig Jahren, d.h. um mit Augustin zu sprechen, in glühender Jugendhitze – fürchtetest Du für mich, denn an vielen ähnlichen Beispielen hattest Du erfahren, dass diese Art zu leben manchem zum Unheil gereicht hatte. Deine Absicht war es sogar, mich durch eine ehrenvolle und reiche Heirat zu fesseln.“1
Es ist besonders der letzte Satz, der einige Spekulationen ermöglicht. Zwar konstruiert Luther keinen ausdrücklichen Zusammenhang zwischen seinem Klostereintritt und den Heiratsplänen des Vaters, aber die zeitliche Zuordnung zeigt doch, dass das Problem im Sommer 1505 virulent gewesen sein muss. Ob der Vater den Sohn eigens nach Hause gerufen hatte, um ihn über die Heiratspläne zu informieren,2 oder ob dieser aus anderen Gründen seinerseits nach Hause gereist war, ist unklar. Ob er die Pläne, Mönch zu werden, schon vor der Reise gehegt hatte? Ob er vielleicht mit dem Gedanken gespielt hatte, von der juristischen Laufbahn zum Theologiestudium zu wechseln? All dies ist aufgrund der spärlichen Notizen nicht mit Sicherheit zu erschließen, aber es spricht doch einiges dafür. Wenn die Absicht des Vaters war, den Sohn durch Heirat zu „fesseln“, so setzt diese Formulierung voraus, dass dem Vater schon deutlich bewusst war, dass der Sohn ein eheloses Leben anstrebte: das eines Klerikers oder eines Mönchs.3 Der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Lebensentwürfen, Martins eigenem und dem seines Vaters, war, wie ausgesprochen auch immer, bewusst, und es liegt nahe, anzunehmen, dass eben dies bei jener Reise ins Elternhaus thematisiert wurde. In jedem Falle dürfte der Besuch bei den Eltern mitten im Semester einen konkreten Anlass gehabt haben, der etwas mit einer anstehenden Lebensentscheidung zu tun hatte.
Die Entscheidung fiel aber offenkundig nicht während des Aufenthaltes bei den Eltern – jedenfalls wurde alles, was hier eventuell besprochen und beschlossen wurde, bald durch ein anderes Ereignis überlagert: Luder befand sich am 2. Juli kurz vor Erfurt, in der Nähe des Dorfes Stotternheim.4 Und hier überraschte ihn ein Blitzschlag, offenbar ganz in seiner Nähe. Darauf habe er, so berichtet er viele Jahre später, ausgerufen: „Hilff du, S. Anna, ich wil ein monch werden!“5 Dieses Ereignis ist vielfach nacherzählt worden und hat dem kleinen thüringischen Dörfchen Stotternheim zu einer gewissen Berühmtheit verholfen. Es passt auch bestens zu der Vita eines jungen Bergmannssohnes, war doch die heilige Anna, die Mutter Mariens, gerade unter Bergleuten eine seit kurzem populäre Heilige. Luther selbst berichtet hiervon Jahre später:
„Bej meinem gedencken ist das gross wesen von S. Anna auffkomen, als ich ein knabe von funffzehen jharen wahr. Zuvor wuste man nichts von ihr, sondern ein bube kam und brachte S. Anna, flugs gehet sie ahn, den es gab jederman darzu. Dohehr ist die hehrliche Stadt und kirche auff S. Annabergk ihr zu ehren gebauet worden, und wer nur reich werden wolte, der hatte S. Anna zum Heiligen.“6
Die Bergbaustadt im Erzgebirge, die 1505 durch Herzog Georg den Bärtigen (1500–1539) von Schreckenberge in Annaberg umbenannt worden war, legt noch heute Zeugnis von der seinerzeitigen Begeisterung für die neue Heilige ab, gerade im Sächsischen. Auch der ernestinische Kurfürst Friedrich der Weise (1486–1525) gehörte zu den Anhängern des Kults. Zwar war Anna bereits in der Spätantike als Mutter Mariens bezeugt – das Protoevangelium Jakobi nennt ihren Namen –, doch intensivierte sich ihr Kult im ausgehenden Mittelalter.7 Diese Popularität beruhte wohl vor allem darauf, dass man in ihr eine Heilige vor Augen gestellt bekam, die dazu geeignet war, neben und gegenüber dem asketischen Leben das familiäre Leben positiv wahrzunehmen. Denn in ihrer Person konnte die Legende eine Fülle familiärer Bande zusammenführen: Die Legenda aurea, die Sammlung der wichtigsten Heiligenlegenden des Mittelalters, erzählt im Abschnitt über die Geburt Mariens, dass ihre Mutter Anna – jeweils aufgrund des Todes des Gatten – dreimal verheiratet gewesen sei und jedem der Männer eine Maria geboren habe: so auch dem Joachim in unbefleckter, das heißt von der Erbsünde freier Empfängnis Maria, die Mutter Jesu.8 Die beiden anderen Marien wurden Mütter verschiedener Apostel Jesu, so dass am Ende die zahlreichen Altäre der Sippe der Anna eine Fülle wichtiger biblischer Personen darstellten – und zugleich in entsprechendem Interieur die bürgerliche Drei-Generationen-Familie repräsentierten. Dass darüber hinaus die Bergleute ein besonderes Verhältnis zur heiligen Anna entwickelten, hatte mit der Liturgie ihres Heiligenfestes am 26. Juli zu tun. Als Evangelium wurde hier Mt 13,44–52 verlesen, worin es zu Beginn heißt: „Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker“. Dieses Bild konnten die Bergleute gut auf die Realität ihrer Arbeit beziehen.9 Dennoch wäre es kurzschlüssig, Luthers Worte schnell auf eine entsprechende Prägung seines Elternhauses zu beziehen: In der Mansfeldischen Region war der Annenkult während seiner Kindheit noch nicht heimisch10 und gewiss nicht auf den Bergbau bezogen,11 sicher können wir von einer Kenntnis des Annenkultes erst in seiner Eisenacher Zeit ausgehen,12 im Erfurter Kloster, also nach dem fraglichen Ereignis, scheint er dann regelmäßig Messen für Anna gelesen zu haben.13
Warum sich der junge Student der Rechte also in der Not ausgerechnet an die heilige Anna gewandt haben soll, scheint keineswegs so selbstverständlich zu klären zu sein, wie es auf den ersten Anschein aussehen mag. Gewiss war sie nicht die einzige Heilige, die in einer solchen Situation in Frage kam. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man den Bericht ansieht, aus dem hervorgeht, dass Luder in diesem Jahr 1505 keineswegs zum ersten Mal in Todesgefahr war. In einer Tischrede erzählte er am 30. November 1531 von seiner als junger Mann erfahrenen schweren Beinverletzung,14 und seinerzeit rief er in seiner Not: „O Maria, hilff!“15 Die Heilige, die vor dem Tod retten sollte, konnte also bei unterschiedlichen Gelegenheiten jeweils eine andere sein, sei es im tatsächlichen Geschehen, sei es auch in der rückschauenden Erinnerung.
Nun gibt es tatsächlich eine Fülle von Gründen dafür, dass jüngst von Angelika Dörfler-Dierken entschieden und mit guten Gründen in Zweifel gezogen wurde, ob Luder sich an jenem Julitag des Jahres 1505 tatsächlich an die Mutter Mariens gewandt hat.16 Die gewichtigsten Bedenken ergeben sich aus der Tatsache, dass Luther zum ersten Mal im Jahre 1539 in Verbindung mit seinem Klostereintritt die heilige Anna erwähnt, mehr als drei Jahrzehnte nach dem tatsächlichen Geschehen. Das fällt zumindest auf,17 wenn man bedenkt, dass er über die Jahre hinweg mit Auskünften über jenes Ereignis nicht gespart hat, nur fehlte eben stets der Hinweis auf die heilige Anna. Und dieser bietet nun bei seiner ersten Erwähnung 1539 gleich die Gelegenheit für eine gelehrte theologische Assoziation: Gott habe diesen Ausruf hebräisch verstanden, „sub gratia“.18 Tatsächlich verweist der Name Anna, leitet man ihn aus der hebräischen Wurzel cnn ab, auf die gratia, die Gnade, eines der Leitworte von Luthers späterer reformatorischer Theologie. Der Ruf an Anna also hat nach Luther durchaus einen Sinn, der sich freilich erst in der Rückschau erschließt: Luder hat sich schon seinerzeit an die göttliche Gnade gewandt und wurde von Gott gnädig behütet.
Aber eben dieser Zusammenhang aus später und zugleich theologisch so sinnvoller Erläuterung lässt das Geschilderte in Zweifel ziehen. Handelt es sich hier nicht doch eher um eine Art biographische Rekonstruktion?19 Auch andere Äußerungen Luthers zu späteren Etappen seines Lebens lassen diese Frage immer wieder aufkommen, ob der Reformator, wenn er von seinem Leben erzählt, nicht gerade deswegen, weil dieses Leben ihm immer schon göttlich geführtes und gedeutetes Leben ist, dazu neigt, Ereignisse allzu sinnvoll darzustellen, ihnen einen Sinn nicht nur in einer der reinen Faktenebene sekundär aufgesetzten Deutungsebene zuzumessen, sondern diesen Sinn schon in die Erzählung einfließen zu lassen. Schon diese frühe Station seines Lebens lässt diese Fragen aufkommen, und bis auf weiteres wird man der heiligen Anna wohl mit nicht allzu großer Sicherheit eine wichtige Rolle im Leben des jungen Luder zumessen können.
Und doch geschah nicht nichts an jenem 2. Juli. Schon früh gibt es Hinweise auf das Geschehen. Dabei sollte man die ohnehin nur indirekt überlieferte Aussage seines klösterlichen Mitbruders Johannes Natin (ca. 1450–1529), der Luder „als eyn andern Paulum“ pries,20 nicht allzu sehr belasten. Sie ist spät, erst 1530, bezeugt und im Kern typologisch: Der Klostereintritt wurde mittelalterlich generell als conversio verstanden, als eine Bekehrung vom weltlichen zum geistlichen Leben, so dass Paulus als Figur zur Deutung dieses Schrittes nahe lag. Typologisch steckt diese Bekehrung des Apostels auch hinter dem Bericht des oben erwähnten Crotus Rubianus, der am 16. Oktober 1519 in einem Brief an Luther Rückschau auf die gemeinsame Bursenzeit hielt und bedauernd an dessen Fortgang aus der Burse erinnert.21 Dies sei „non sine numine divino“, also nicht ohne Gottes Willen erfolgt, und zwar durch einen himmlischen Blitzschlag („fulmen“). Crotus Rubianus war immerhin direkter Zeuge der unmittelbaren Folgen des Geschehens, erlebte also den plötzlichen Entschluss Luders zu einer Lebenswende. Auch wenn man Anna aus dem Szenario streichen muss, den Blitzschlag und Luders unmittelbar folgenden Entschluss, in das Kloster zu gehen, dürfte es gegeben haben.22 Wenig später berichtet auch Luther selbst davon, in eben dem Widmungsbrief an den Vater zu seiner Schrift „De votis monasticis“, dem wir auch die Information über die elterlichen Heiratspläne verdanken.23 Er erinnert sich an ein Gespräch mit dem Vater, das am Tag nach seiner Primiz, seiner ersten Messfeier, stattgefunden haben dürfte24:
„Du sprachst schon wieder besänftigt mit mir. Da versicherte ich dir, dass ich vom Himmel durch Schrecken gerufen, nicht etwa freiwillig oder auf eigenen Wunsch Mönch geworden sei. Noch viel weniger wurde ich es um des Bauches willen, sondern von Schrecken und der Furcht vor einem plötzlichen Tode umwallt legte ich ein gezwungenes und erdrungenes Gelübde ab.“25
Dieser Bericht von einem frühen Gespräch ist in mancher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen bestätigt es, niedergeschrieben 1521, dass es ein äußeres Ereignis war, das Luder zum Klostereintritt bewog. Gemeinsam mit dem Bericht des Crotus Rubianus und den späteren Erzählungen besteht kaum Grund zum Zweifel, dass es sich hier um ein Gewitter und jenen furchtbaren, erschreckenden Blitzschlag handelte. Aber Luther gibt auch Auskunft, was eigentlich daran das Erschreckende war: nicht der Tod an sich, mit dessen Nähe ein mittelalterlicher Mensch zu leben gelernt hatte, sondern der plötzliche Tod. Die Seelsorge des späten Mittelalters hatte sich große Mühe gegeben, den Menschen auf den Tod vorzubereiten. Eine Fülle von Texten des ausgehenden Mittelalters gehört in die Gattung der „ars moriendi“. Diese Schriften von der Sterbenskunst sollten der Bereitung zu einem seligen Sterben dienen. Ihr Hauptanliegen war es, dass der Mensch dem Tod, der letztlich die Begegnung mit Gott und dessen Urteil über den Lebensweg des Menschen mit sich brachte, vorbereitet entgegentrat, durch rechtes Handeln, Meditieren und Beten. Ein plötzlicher Tod bedeutete demgegenüber unbereitetes Sterben, den Fortfall der Möglichkeit, sich und dem Priester noch einmal Rechenschaft über das eigene Leben abzugeben und abschließend die Sterbesakramente zu erhalten. Das war es, was Luder mit Anfang zwanzig fürchtete und das ihn in ein Kloster trieb.
Es war, auch dies geht aus dem Schreiben an den Vater hervor, tatsächlich ein Gelübde, das er ablegte, der heiligen Anna oder Gott selbst gegenüber – dies muss offen bleiben. Aber eben ein Gelübde, das offenbar die Errettung aus dem Gewitter mit dem Weg in das Kloster verband. Es war, auch dies benennt Martin Luther ausdrücklich, ein „gezwungenes und erdrungenes Gelübde“26 und als solches, das musste ihm bewusst sein, nicht bindend. Das mittelalterliche Kirchenrecht wusste sehr wohl zwischen einem aus freiem Entschluss abgelegten Gelübde und einem in der Not herausgepressten Gelübde zu unterscheiden, und nur das erste konnte dauerhaft bindend sein.27 Martin Luder hätte, nachdem er den 2. Juli 1505 überlebt hatte, Gott seinen Dank abstatten können, ohne zur Erfüllung des Gelübdes verpflichtet zu sein.
Dass er genau dies nicht tat, das ist die eigentliche Nachricht von Stotternheim. Nur von hier aus erschließt sich das komplexe Geflecht jener Tage, die man sich noch einmal verdichtet vor Augen stellen sollte: Ein junger Mann reist offenbar aus konkretem Anlass zu seinen Eltern. Es gibt Konflikte, die, so scheint es, den gesamten Lebensentwurf in Frage stellen: Studienpläne, Heiratspläne. Auf der Heimreise gerät er in Not und gelobt in dieser Not Gott oder seinen Heiligen einen Lebensweg, der jedenfalls den Wünschen des Vaters – und aller Wahrscheinlichkeit auch der in diesem Falle als Akteurin kaum in den Blick rückenden Mutter – diametral entgegensteht. Er könnte dieses Gelübde widerrufen und tut es nicht. Eben hierin liegt wohl der Schlüssel zum Geschehen. Das Gelübde stellt für Luder einen idealen Ausweg aus der schwierigen Situation dar, in die ihn die Auseinandersetzung mit dem Vater gebracht hatte. Wenn tatsächlich, wie oben dargelegt, manches dafür spricht, dass der Vater von Plänen des Sohnes, Mönch zu werden, wusste, wollte er ihn doch durch Heirat „fesseln“, so wäre nun eben diese vom Vater problematisierte Überlegung durch das Gelübde plötzlich auf eine ganz neue Entscheidungsstufe gestellt. Der von Crotus Rubianus angesprochene göttliche Wille, ja der Zwang, von dem Luther selbst spricht, sie waren nun leitend, nicht die freie Entscheidung des Sohnes selbst – nun kann Luder, der aller Wahrscheinlichkeit nach schon vor dem Ereignis von Stotternheim den Wunsch hegte, Mönch zu werden, tatsächlich besten Gewissens erklären, dass der Klostereintritt nicht freiwillig erfolgt sei, vielmehr nach Gottes Willen erfolgte. An dieser Selbststilisierung hat Luther dann später noch weitergearbeitet. 1531 erklärte er gar in einer den nachzeichenbaren Konflikten mit dem Vater ganz und gar entgegenstehenden Akzentuierung: „Ich bin nicht gern ein munch worden“28. Der Vater, der die Entscheidung anfocht, stand nun nicht mehr dem Willen des Sohnes gegenüber, sondern dem Willen Gottes. Das aber galt nur dann und so lange, wie das Gelübde als bindend empfunden wurde und tatsächlich Gottes Willen darin gesehen wurde.
Dass der Vater auch hier nicht restlos überzeugt war, macht seine Reaktion deutlich, von der wiederum Martin berichtet: „Möchte es nur nicht eine Täuschung und ein Blendwerk gewesen sein“, soll er zu jener Stotternheimer Berufung gesagt haben,29 sogar auf die Möglichkeit einer Verblendung durch den Teufel verwiesen haben,30 ein Satz, der voraussetzt, dass die göttliche Berufung mit ihren Folgen durchaus akzeptiert wurde, ihre Tatsächlichkeit aber in den Augen des Vaters Zweifeln unterlag. Die Absicherung in Gottes Willen, die Martins Entscheidung für das Klosterleben erfahren hatte, funktionierte also nur begrenzt, aber sie reichte aus, um seine eigene Lebenswende zu motivieren. Für ihn zumindest stand der göttliche Wille offenbar fest – auch wenn die Rückschau feststellen kann, dass dieser göttliche Wille möglicherweise allzu gut zu seinem vorherigen eigenen menschlichen Willen passte.
Vor diesem Hintergrund wird man auch die Plötzlichkeit der Geschehnisse von Stotternheim nicht überschätzen dürften: Hier verdichtete sich momenthaft eine Entwicklung, die sich offenbar beim jungen Martin Luder schon länger abgezeichnet hatte, hier fand eine lang angelegte Krise ihre zunächst befreiende Lösung. Der Weg ging ins Kloster.