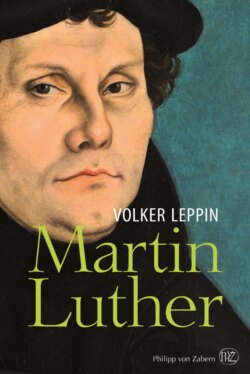Читать книгу Martin Luther - Volker Leppin - Страница 7
Einleitung
Оглавление„Der Luther meiner Kinderstube galt nahezu als Wiedergänger Jesu, als showstopper der Weltgeschichte von Feuer und Schwert. Von Cranach gemalt, hing er an Vaters Arbeitszimmerwand: wie er aus seiner Kanzel auf den todwund geschlitzten Heiland weist, die Wittenberger Christum lehret, Katharina von Bora freit, seinen Kindern Weihnachtslieder dichtet und das protestantische Pfarrhaus begründet, jene feste Burg, in der nun auch ich sicher wohnen durfte. Dieser Kinderluther war ein Held bis zum Finalsatz seines Lebens: Wir sind Bettler, das ist wahr.“1
Ein Halberstädter Pfarrhaus der sechziger Jahre in der Erinnerung des Journalisten Christoph Dieckmann: Lutherverehrung im geteilten Deutschland des 20. Jahrhunderts bis zum Ikonenhaften, Heldenmythen, sicher zugespitzt, und doch: Solche Sätze machen deutlich, unter welchen Schichten heutige Rekonstruktionen Luther hervorzusuchen haben, wenn sie versuchen, ein einigermaßen angemessenes historisches Verständnis erwecken zu wollen, einen „Luther ohne Goldgrund“ (Gottfried Seebaß)2 zu präsentieren.
Der Historiker des 21. Jahrhunderts3 weiß dabei genau, dass er nicht herausfinden kann, „wie es wirklich gewesen ist“; die Diskussionen über Konstruktion und Rekonstruktion in der Geschichtswissenschaft wird heute niemand mehr ignorieren dürfen. Auch der Lutherbiograph wird nicht behaupten dürfen, er biete nun den wahren, den authentischen Luther, und gerade der Lutherbiograph wird dies nicht tun können. Denn über kaum eine Gestalt aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance ist wohl so viel geschrieben worden wie über den Reformator aus Wittenberg, nicht zuletzt die monumentale, dreibändige Monographie, die Martin Brecht rund um das Jubiläum des 500. Geburtstages Martin Luthers vorgelegt hat und die bis heute in ihrer Detailtreue und in der Fülle des verarbeiteten Materials unübertroffen ist.
Wenn nun eine neue Biographie in der Fülle von Literatur einen eigenen Weg gehen will, so besteht er vor allem in einer Art von gedanklichem Experiment: Jeder Biograph steht vor der Schwierigkeit, dass er einen Gegenstand hat, dessen Bedeutung sich eigentlich erst im Vollzug des gelebten Lebens herausstellt. Und wenn man es nicht mit adeligen Herrscherpersönlichkeiten zu tun hat, die schon durch ihre Herkunft für eine hervorgehobene Stellung vorgesehen waren, hat man es mit einer Gestalt zu tun, die die Rolle, aus der ihre Bedeutung erwächst, erst noch gewinnen muss. Der Sohn eines Kleinunternehmers aus Mansfeld war eben nicht von Anfang an für eine Wirksamkeit als Reformator bestimmt. Der Biograph aber, der sich mit ihm befasst, weiß von der ersten Seite an, dass er es mit dem späteren Reformator zu tun hat. Und wenn er sich Luther als lutherischer Kirchenhistoriker zuwendet, so weiß er auch, dass er seinen eigenen Beruf, seine eigene religiöse Position zu guten Teilen dem Wirken eben dieses Reformators verdankt.
Diese Problemlage wird kein Biograph ganz vermeiden können, aber das Wissen um den besonderen Zugang zum Gegenstand lässt sich doch methodisch umsetzen, und eben hier setzt das angedeutete Experiment an. Luther soll auf den folgenden Seiten so lange wir irgend möglich so gelesen werden, als wüsste man nicht, dass sich mit ihm ein Neuaufbruch in Kirche und Gesellschaft, für manche, wohl allzu hoch gegriffen, sogar eine neue Epoche der Weltgeschichte verbindet. Er soll so lange wie möglich als Mensch des späten Mittelalters verstanden werden, der entdeckt, der gelegentlich sogar auch zögerlich entdeckt, der mit seiner Herkunft nicht brechen will – und am Ende wohl auch nicht ganz mit dieser Herkunft bricht.
Das bedeutet auch: Die autobiographischen Spuren, die Luther selbst legt, sind mit Vorsicht nachzuvollziehen, sie können nicht zur Leitmaxime der Darstellung gemacht werden. Denn der späte Luther, der um seine neue Position weiß, deutet im Blick auf das Vergangene seine frühere Existenz in neuen Kategorien, der Reformator behandelt seine vorreformatorische Existenz nach reformatorischen Maßstäben. Wer ihm darin nicht einfach folgen, nicht einfach seine eigene Memoria nachschreiben will, wird jede dieser Äußerungen kritisch gewichten und hinterfragen müssen. Die tiefstliegende Schicht, unter der der Biograph hindurchtauchen muss, ist die Selbstauslegung seines Gegenstandes selbst: Luthers Selbstdarstellung, wie sie in Briefen, Tischreden und anderen Texten so vielfach begegnet. Den Anspruch, einen authentischen Luther zu gewinnen, wird ein Biograph damit, wie schon einleitend gesagt, kaum erheben dürfen. Aber vielleicht einen Menschen, der in seiner Zeit plausibler Kontur gewinnt als ein Luther, bei dem man, wie es oft geschieht, weniger nach dem Fortwirken des Alten als nach dem Beginn des Neuen sucht, den man unterschwellig schon immer nach den Maßstäben seiner späten, reifen reformatorischen Theologie bewertet.
Aus einem solchen Ansatz ergibt sich nicht nur die Methodik einer kritischen Würdigung der Selbstauslegung Luthers, es ergibt sich auch eine bestimmte Disposition des Stoffes. Diese Biographie stellt sich durchaus bewusst in eine gelegentlich kritisierte Tradition, die dem „jungen“, sich entwickelnden Luther mehr Beachtung zukommen lässt als dem reifen Luther, der nicht mehr reformatorische Entscheidungen vor sich hat, sondern auf ihrer Grundlage agiert.4 Die fünfzehn Jahre zwischen 1505 und 1520 nehmen zusammen etwa ebenso viel Raum ein wie das dann folgende Vierteljahrhundert. Das mag irritieren, irritiert vor allem unter dem theologischen Gesichtspunkt der Suche nach einem Übergang zwischen Luther und der lutherischen Konfession, insofern sich beim späten Luther manches herausbildet, was dann in der lutherischen Orthodoxie prägend wird. Aber die eigentlich spannungsvollen und damit biographisch spannenden Jahre sind doch die frühen Jahre5 des Überganges von der Herkunft zur eigenen Gestaltung. Sie sind die Jahre, an denen das Experiment durchzuführen ist, ob es gelingen kann, Luther statt von seinen Folgen von seinen Wurzeln her zu verstehen.
Wenn mit dieser Verortung die Hoffnung verbunden ist, dass diese Biographie einen eigenen Akzent innerhalb der Lutherbiographik zu setzen vermag, so weiß der Autor eines solchen Werkes doch auch, dass er vielen anderen verpflichtet ist. Es sei hier an erster Stelle die Luther-Biographie von Reinhard Schwarz genannt, der von ähnlichen Fragestellungen ausging und damit vor allem für die Hand von Studierenden ein vorbildliches, knappes Lutherbuch vorgelegt hat. Solche Verstehensversuche vom Mittelalter her wären aber auch nicht vorstellbar ohne die Fülle von Beiträgen zum Verhältnis von Spätmittelalter und Reformation, die in den vergangenen Jahren unsere Kenntnis des spätmittelalterlichen Umfeldes Martin Luthers erheblich erweitert haben. Das Literaturverzeichnis und die Fußnoten weisen aus, wie viel diese Biographie anderen zu verdanken hat. Die Forschungsrichtung, der sie neben dem akademischen Lehrer Gottfried Seebaß folgt, ist in besonderer Weise mit den Namen Berndt Hamm, Helmar Junghans, Ulrich Köpf, Heiko Augustinus Oberman und dem eben schon genannten Reinhard Schwarz verbunden. Von ihnen hat der Autor dieser Biographie gelernt, Luther dort zu suchen, wo er hingehört: am Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit.