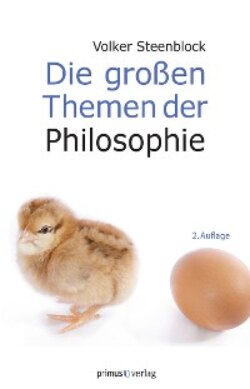Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Jeder philosophiert!
ОглавлениеUnd doch besteht ein Zusammenhang: Diese alltagsweltlichen Situationen artikulieren leichter, was im Alltag häufig verschüttet ist: die letzte Ebene unserer Auffassungen, die „Grundkoordinaten“ unserer Einstellungen und Wertungen, von denen aus wir unser Leben gestalten. Manchmal sind es auch Ausnahmesituationen: Erschütterungen, Zweifel, Konflikte, Ängste, Todeserfahrungen, aber auch Erfahrungen von Glück und Staunen, von Überschwang und Liebe, in denen sich die Möglichkeit eröffnet, in eine Dynamik des eigenen Denkens hineinzukommen und ihm die Fragen und Antwortversuche der Philosophiegeschichte zu vermitteln.
Philosophieren bedeutet, den Weg vom weniger Bewussten und Unexpliziten zur Reflexion und zum „selbsteigenen Gebrauch der Vernunft“ zu gehen, wie es Immanuel Kant (1724–1804) formuliert hat. Es ist keine geringe Tradition des deutschen philosophischen Denkens, die jeden von uns zu Reflexion und Philosophie auffordert. Wilhelm von Humboldt (1767–1835) hat mit einer solcher geistigen „Arbeit am Ich“ das Wesen des Menschen verbunden (im Anhang an dieses Kapitel: Zum Weiterdenken finden sich Texte hierzu: Sokrates, Kant, Hegel, Humboldt).
Hierzu bedarf es der Philosophie als Fachwissenschaft, wenn man so will: der professionellen Philosophen. Die sind aber für unsere aus dem Lebensalltag erwachsenden Fragen kein ganz einfacher Partner. Man muss nämlich gar nicht besonders böswillig sein, um zu finden, an der Universität würden vor allem abstrakte und entlegene Detailprobleme behandelt, kurz: etwas, das mit unseren Fragen und unserer Wirklichkeit nicht allzu viel zu tun zu haben scheint. Was Fachphilosophen schreiben, lesen zumeist Fachphilosophen: Kritiker haben von den Universitätsphilosophen schon einmal gesagt, dass sie einen Selbstbedienungsladen beliefern, in dem sie selbst die einzigen Kunden sind. So nachvollziehbar aber dies Ungenügen an manchen Spezialitäten des Forschungsbetriebes in Vergangenheit und Gegenwart sein mag, so blind die akademische Philosophie oftmals für die Lebenswelt ist: so leer droht auch eine alltagsweltliche Reflexion zu bleiben, die sich nicht zugleich abarbeitet an den Inhalten der philosophischen Tradition. Diese Inhalte kennen zu lernen – so sagt es Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) – heißt Philosophieren.
Als Universitätsdisziplin muss die Philosophie auch praxisbezogene Themen erst einmal argumentativ und wissenschaftlich behandeln; noch manche erfolgreiche Einführung in die Philosophie hält es in diesem Sinne äußerst solide.5 Die Philosophie muss zugleich aber sehr wohl, wie man gesagt hat, „menschlich mit Menschen über Menschliches reden“ – sie entstammt ja der Öffentlichkeit! Einer der frühen Orte des Philosophierens ist die Agorá in Athen, auf der ein Sokrates seine Mitbürger mit Philosophie konfrontiert: er begibt sich auf den Markt, in das Zentrum des öffentlichen Lebens. Heute müsste man in die Einkaufszonen unserer Städte oder in die Medien gehen, um die Menschen so zu erreichen. In diesem Sinne öffnet sich die Philosophie gerade in den letzten Jahren einem breiten interessierten Publikum. Seminare und Kurse zu den „Großen Themen“ an den Bildungsorten füllen sich, neue Zugangsweisen erschließen sich vom Philosophieren mit Kindern über die Schulen und das Studium im Alter bis zum Internet.
Zur Philosophie hinzuführen, unternimmt seit langem ein traditionsreiches Genre von „Einleitungen“. Bereits Friedrich Paulsen, einer der ersten Pädagogen und Philosophen an der Berliner Universität, ein Pionier, hat sich hierum bemüht.6 Ein frühes, schon hilfreicheres Beispiel ist auch die „Einführung in die Philosophie“ von Karl Vorländer, auf den zudem eine erfolgreiche Philosophiegeschichte zurückgeht. Unter dem gleichen Titel hat der Philosoph Karl Jaspers (1883–1967) in der ihm eigentümlichen Diktion einen „Wille[n] zur philosophischen Lebensführung“ gefordert. Für die Gegenwart schon des 20. Jahrhunderts muss Jaspers eine „Selbstvergessenheit im Verzehrtsein durch den Betrieb“ konstatieren: „Geordnet durch die Uhr, abgeteilt in absorbierende oder leerlaufende Arbeiten, die immer weniger den Menschen als Menschen erfüllen, bringt sie es zu dem Extrem, dass der Mensch sich als Maschinenteil fühlt, das wechselnd hier und dort eingesetzt wird, und, wenn freigelassen, nichts ist und mit sich nichts anfangen kann. Und wenn er gerade beginnt, zu sich zu kommen, will der Koloss dieser Welt ihn doch wieder hineinziehen in die alles verzehrende Maschinerie von leerer Arbeit und leerem Vergnügen der Freizeit.“ Hier gegen bedarf es einer besonderen Anstrengung, eines „Sichherausreißens“ und des Entschlusses zur „philosophischen Lebensführung“. Jaspers fordert: „Nicht vergessen, sondern innerlich aneignen, nicht sich ablenken, sondern innerlich durcharbeiten, nicht erledigt sein lassen, sondern durchhellen, das ist philosophische Lebensführung“.7