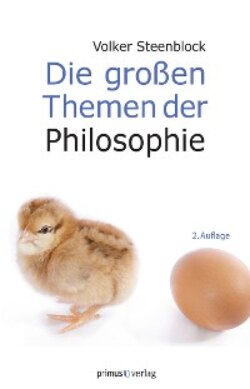Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Ein Prinzip als Urgrund der Welt
ОглавлениеDie ersten Naturphilosophen des alten Griechenland gehören zugleich zu den ersten Philosophen überhaupt. Sie sind als „Vorsokratiker“ berühmt geworden, suchen sie doch bereits im 6. vorchristlichen Jahrhundert – noch vor dem Auftreten des Sokrates – nach einem „Urstoff“ bzw. dem Urgrund aller Dinge, der „hyle“. Die frühen Naturphilosophen vollziehen damit einen in der Geschichte des Denkens überaus wichtigen und grundsätzlichen Schritt: Sie verwirklichen die über die Göttergeschichten des Mythos hinausweisende Abstraktion, die Vielfalt der Phänomene in der Welt nicht mehr durch den Rekurs auf göttliches Wirken, sondern aus einem natürlichen Prinzip abzuleiten. Als solches Prinzip werden etwa „Wasser“ (Thales), Luft (Anaximenes), ein Urfeuer in wohl auch übertragenem Sinne (Heraklit) und die vier „Urelemente“ Wasser, Luft, Feuer und Erde (Empedokles) angegeben, aber auch schon „Atome“ (Leukipp, Demokrit).
In der „klassischen“ Zeit des griechischen Philosophierens tritt zunächst vor allem der große Platon (427–347 v. Chr.) auch als Naturdeuter auf. Sein naturphilosophisches Hauptwerk ist der „Timaios“, in dem der beinahe Siebzigjährige eine Vision formuliert, die von einem Schöpfergott über die Darstellung der um die Erde konzentrisch angeordneten und die Planeten tragenden „Sphären“ bis zur gegen Demokrits Atomismus gerichteten Theorie des Aufbaus der Materie aus den „platonischen“ Körpern reicht. Für Jahrhunderte war der „Timaios“ die im lateinischen Westen einzig bekannte Schrift des Philosophen; zu ihrer hohen Einschätzung als Platons Hauptwerk mag die scheinbare Antizipation des christlichen Schöpfergottes beigetragen haben. Wie beschreibt Platon im „Timaios“ die Welt? Sie erscheint als das Werk eines Handwerker-Gottes, der in bester Absicht die Dinge nach dem Bild der Ideen gestaltet hat, dabei in der Sphäre materialer Notwendigkeiten aber sozusagen Abstriche machen musste. Dieser Demiurg ist keiner der Götter der griechischen Religion und natürlich auch noch nicht der jüdisch-christliche Gott, der alles aus dem Nichts erschaffen hat. Aufgabe der Wissenschaft ist für Platon die Anschauung („Theorie“) des ewigen, geordneten, planvollen und schönen Kosmos. Dabei hat er die Ewigkeit und Göttlichkeit der Planeten in folgenreicher Weise mit der Kreisbewegung gleichsetzt.
Für Platons Schüler Aristoteles (384–322 v. Chr.), der eher als sein Lehrer bereits als Naturwissenschaftler gelten kann, zerfällt der Kosmos in zwei ontologisch durchaus verschieden aufzufassende Regionen: in die sublunare Welt („unter dem Monde“) und in die Sphären des Himmels, die durch die Bahn des Mondes von der sublunaren Welt getrennt sind. Die Welt der Sphären war dabei für Aristoteles die der vollkommenen, weil nämlich keinerlei Veränderungen unterworfenen Kreisbahnen; die sublunare Welt dagegen eher das Reich der Kontingenz und des Unberechenbaren.
In seiner kosmologischen Lehrschrift „peri uranou“ (lat. „De caelo“, „Vom Himmel“) hat Aristoteles grundlegende Elemente seines Weltbildes, so die Lehre von der Ewigkeit (dem „Timaios“ widersprechend), Einmaligkeit und Begrenztheit des Kosmos, von der Erde im Mittelpunkt (!) und von den natürlichen Bewegungen dargelegt. Er sagt, dass „der gesamte Himmel weder entstanden ist noch untergehen kann, wie einige meinen, sondern dass er einer ist und ewig und in seiner ganzen Dauer weder Anfang noch Ende hat und in sich selbst die unbegrenzte Zeit fasst und umgreift“.2 Auch der wohl berühmteste Astronom der Antike, Klaudios Ptolemaios (um 100–170 n. Chr.) aus Alexandria, Verfasser des durch seine arabische Vermittlungsgeschichte außerordentlich wirkungsreichen „Almagest“ (eigentlich: „Syntaxis Mathematica“), eines Handbuchs der Astronomie, vertrat die geozentrische Auffassung von der Bewegung der Sonne um die Erde.
Die Natur („physis“) war bei alledem für die Griechen nicht das objektivierte Sein „da draußen“. Sie fühlten sich weit eher „geborgen“ in einem „Kosmos“, einer lebendigen, durchseelten, schönen, ja heiligen Ordnung, wie der Philologe Wolfgang Schadewaldt (1900–1974) formuliert hat.3 Als ob irgendein „geheimnisvolles Tabu“ ihnen den weiteren Schritt verwehrte, so formuliert es Schadewaldt, haben die Griechen in der Kosmologie keinen Sinn für das Unendliche entwickelt, in den Naturwissenschaften kein konsequentes Experimentieren und in der Wirtschaft schließlich keine Arbeitsorganisation durch Technik im modernen Sinne (dies Letztere kann freilich auch handfestere sozioökonomische Gründe haben, standen doch in der Sklavenhaltergesellschaft genügend Arbeitskräfte zur Verfügung, so dass es der Maschinenerfindung auch nicht unbedingt bedurfte). Bemerkenswert bleibt, dass die griechische Technik kaum einen Ansatz zu jener besonderen Entwicklung zeigt, die unsere Zivilisation auszeichnet, freilich ihr auch zu schaffen macht. Auf Goethe vorweisend sind es für Schadewaldt vor allem ein Sinn für die Rückbindung menschlichen Tuns an das Ganze des Alls und eine Ablehnung der „Hybris“, des Übermutes, des Maßlosen im „überhandnehmenden Maschinenwesen“, die die Griechen davon abhielten, den berechtigten Urauftrag der Technik, die Daseinssicherung und -erleichterung des Menschen, in einer Weise zu übersteigern, die in Entfremdung umschlage und schließlich die Gefahren von Nuklearkraft und Genbiologie auf unser Haupt ziehe. Das Erkennen, das einer naturphilosophischen Grundauffassung im Sinne des Aristoteles entspricht, besteht weniger in einem aktiven Konstruieren von Hypothesen und einem experimentellen Befragen der Natur, als vielmehr in einem „schonenden“, anschaulich-gedanklichen Nachvollzug der Naturbewegungen. Die solchermaßen beschriebene Natur ist und bleibt sozusagen „frei“, weil die Erkenntnis sie dort aufsucht, „wo sie […] den ihr angehörigen Gebilden die Macht verleiht, sich selbst zum Wesen zu einigen“.4 Je mehr in der zivilisatorischen Entwicklung seither die Natur in die Gewalt des Menschen gebracht, zugerichtet und in Teilen zerstört worden ist, um so mehr mag man auch in einer Gegenbewegung, ganz wie bei Schadewaldt, das Naturverhältnis der Antike als eine bleibende und dauernde Anfrage an unser Naturverständnis empfinden können.
Unsere von ökologischen Problemen geplagte Zeit hat nun freilich Naturausbeutung, Rodungen (für den Schiffsbau) und Wüstungen – und damit sich selbst – eben doch auch in der Antike vorgefunden. „Spectant victores ruinam naturae“ – „siegesgewiss blicken sie auf den Zusammenbruch der Natur“, hat schon der antike Autor Plinius der Ältere, der im Jahre 79 beim Vesuvausbruch ums Leben kam und durch seine „Naturgeschichte“ („Naturalis historia“) in 37 Büchern bekannt geworden ist, in geradezu prophetischer Manier bemerkt. Plinius hat sich weiter gefragt: „Was für ein Ende soll die Ausbeutung der Erde in all den künftigen Jahrhunderten noch finden?“5