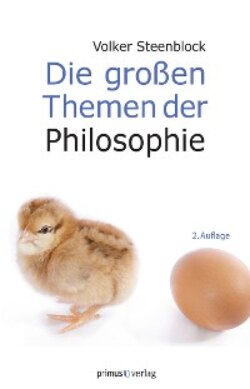Читать книгу Die großen Themen der Philosophie - Volker Steenblock - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Heidegger und die Überbietung der Metaphysik
ОглавлениеFinden die einen die Metaphysik also unwissenschaftlich, so ist sie für eine berühmt gewordene Einzelstimme aus Deutschland zu wissenschaftlich. Der Versuch des Seinsdenkers Martin Heidegger (1889–1976),4 die Metaphysik, der er „Seinsvergessenheit“ vorwarf, in seiner „Fundamentalontologie“ noch einmal „meta-metaphysisch“ zu überbieten, resultierte aus der Befürchtung, sie verstelle gerade den Blick auf das Eigentliche. Für den späteren Heidegger sind Metaphysik, Wissenschaft und Technik allesamt Ausdruck seinsgeschichtlichen Verfalls.5 In West wie Ost sah er eine Entwicklung zur Selbstzerstörung des Menschen statthaben. Hierzu ist es wichtig zu bedenken, dass Heidegger diese Wirkung der neuzeitlichen Wissenschaft und Technik als eine Folge dem verhängnisvoll vom Eigentlichen abgewichenen Wirken der Metaphysik seit Plato zuschrieb. Was gerade so schmerzlich auseinandergebrochen war: die Metaphysik und die Wissenschaft, das war für Heidegger im Grunde alles ein und dasselbe und beides letztlich verderblich. Man hat am Beispiel eines Zeitungsphotos, das eine hochmoderne technische Großantenne und eine kleine alte Dorfkirche zusammen zeigt, darauf hingewiesen, dass jene Bereiche (also Wissenschaft und theologische Metaphysik) – für uns offensichtliche Gegensätze – für Heidegger eng zusammengehören. Das folgende Zitat mag vielleicht verdeutlichen, welche grundsätzliche Fragedimension Heidegger bei ihnen vermisst:
„Einer sagt z.B.: ich denke, heute Nacht schneit es; wer so spricht, denkt nicht, er meint bloß. Allein dieses Meinen darf uns beileibe nicht als etwas Geringes gelten. Unser tägliches Tun und Lassen bewegt sich in diesem Meinen, und zwar notwendig. Sogar die Wissenschaften halten sich darin auf. Inwiefern ist dieses Meinen einseitig? Gehört es nicht zu den obersten Leitsätzen der Wissenschaft, ihre Gegenstände möglichst vielseitig und sogar allseitig zu erforschen? Wo bleibt da etwas Einseitiges? Genau dort, wo der Bereich ihrer Forschung liegt. Die Geschichtswissenschaft durchforscht z.B. ein Zeitalter nach allen nur möglichen Hinsichten und erforscht doch nie, was Geschichte ist. Sie kann das gar nicht wissenschaftlich erforschen. Auf historischem Wege wird ein Mensch niemals finden, was Geschichte ist; so wenig wie jemals ein Mathematiker auf mathematischem Wege, d.h. durch seine Wissenschaft, also zuletzt in mathematischen Formeln zeigen kann, was das Mathematische ist. Das Wesen ihrer Bereiche, die Geschichte, die Kunst, die Dichtung, die Sprache, die Natur, der Mensch, Gott – bleibt den Wissenschaften unzugänglich. Zugleich aber fielen die Wissenschaften fortgesetzt ins Leere, wenn sie sich nicht innerhalb dieser Bereiche bewegten. Das Wesen der genannten Bereiche ist die Sache des Denkens. Insofern die Wissenschaften zu dieser Sache keinen Zugang haben, muss gesagt werden, dass sie nicht denken. Wird dies ausgesprochen, dann hört sich das zunächst leicht so an, als dünke sich das Denken den Wissenschaften gegenüber überlegen. Dieser Dünkel wäre, wo er bestehen sollte, unberechtigt; denn gerade weil das Denken sich dort bewegt, wo es das Wesen von Geschichte, Kunst, Sprache, Natur denken könnte, es aber noch nicht vermag, weiß das Denken immer wesentlich weniger als die Wissenschaften. Diese tragen ihren Namen mit vollem Recht, weil sie unendlich viel mehr wissen als das Denken. Und dennoch gibt es in jeder Wissenschaft eine andere Seite, auf die sie als Wissenschaft niemals gelangen kann: das Wesen und die Wesensherkunft ihres Bereiches, auch das Wesen und die Wesensherkunft der Wissensart, die sie pflegt und noch anderes. Die Wissenschaften bleiben notwendig auf der einen Seite. Sie sind in diesem Sinn einseitig, aber so, dass die andere Seite gleichwohl stets miterscheint“.6
Wenn die Tradition der Metaphysik nach dem Urgrund des Seienden gefragt hatte, so hatte sie dieses Begründende letztlich immer als eine neue Art – wenn auch eine qualitativ andere und das uns umgebende Seiende ermöglichende Art – von Seiendem gedacht. Zu fragen ist aber streng und radikal nach dem Sein als Sein. Heidegger möchte an der abendländischen Tradition der Metaphysik nicht mehr festhalten, weil diese die Frage nach dem Sein inzwischen mit verstelle und selbst zu einem Teil der „Seinsvergessenheit“ geworden sei. Heideggers Denken ist in der Gegenwart ebenso einflussreich bei einigen Denkern wie insgesamt in seinem fundamentalontologischen Totalanspruch hoch umstritten und viel gescholten. So verwendet Heidegger zu seiner „Überhöhung des Seinsbegriffs“, wie auffällt, häufig ein intransitives und passives Vokabular, das darauf hofft, und mag das noch so selten geschehen, „in die Wahrheit des Seins“ zu gelangen. Für dieses wahrhafte Philosophieren muss auch eine neue angemessene Sprache gefunden werden. Hierzu entsteht der ebenso berühmte wie berüchtigte „Heidegger-Jargon“, der einem Witz zufolge ins Englische nicht übersetzbar ist – und ins Deutsche auch nicht. In der Künstlichkeit seiner Diktion erscheint, wie man bemerkt hat, keine Substantivierung unnatürlich genug. Freilich gilt bei aller Kritik auch: Trotz der Unterschiede zu Heidegger und Polemiken gegen ihn zielt auch die „negative Metaphysik“ etwa des Heidegger-Antipoden Theodor W. Adorno (1903–1969) auf das, „was die Metaphysik immer schon gemeint und immer schon verfehlt“ hat7 – und damit auf Intentionen, die für die philosophische Diskussion bleibend aktuell geblieben sind.
Neben Heidegger hat es noch weitere Wiederbelebungsversuche in einer Phase der „Renaissance“ der Metaphysik gegeben. Sie haben aber keine dauerhafte Wirkung erzielt.