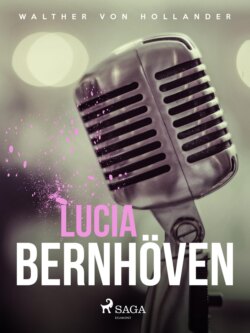Читать книгу Lucia Bernhöven - Walther von Hollander - Страница 10
3
Оглавление1944, in der Nacht vom 26. zum 27. Januar, hatte Lucia von Tweeren begonnen, über die zwanzigjährige Lucia Bernhöven zu schreiben, über das vergangene Ich also, das schwesterliche Schatten-Ich, das neben ihr saß und ihr die schreibende Hand führte. Jetzt, da sie das Geschriebene überlas, war es der 27. Januar, 10 Uhr etwa. Es war wieder sehr kalt geworden. Draußen auf dem See, der der Plüggen hieß, tummelten sich die Dorfkinder mit Schlitten und Schlittschuhen. In ihre dünnen, kreischenden Stimmen, die heraufklangen, mischte sich die herrische Befehlsstimme der kleinen Bettine, ihrer Tochter. Die Sonne schien ins Fenster, wärmte die Hände. Sie starrte auf die schwarzen Buchstaben. War es richtig, war es wahr, was sie geschrieben hatte? Gab es die überschwengliche, die das Herz sprengende Liebe von drei ewigen Minuten, oder war alles durch die Erinnerung versüßt, durch die Erfahrung zu spöttisch angeblickt, durch die Feuer, durch die sie hindurchsah, falsch, bengalisch beleuchtet? Kann man sich überhaupt erinnern, und das heißt doch, in die Vergangenheit zurücktreten, das dazwischen Erlebte ablegen, oder zeigt die Erinnerung nur das, was nach dem Erlöschen der Feuer noch leuchtet?
Der 27. Januar. Sie lächelte. Sie hörte die – in Bettine, der Achtjährigen, auferstandene – etwas schnarrende, schneidige Stimme ihres Vaters: »Am heutigen Tag, dem Geburtstag Seiner Majestät unseres allergnädigsten Kaisers und Herrn, Wilhelms II.«
Sie stand am Rande eines Exerzierfeldes, zwölf Jahre alt, ein Barett aus Schwanenfedern auf dem Kinderkopf, ein pelzbesetztes Plüschjäckchen über den Kinderschultern. Die Sonne schien. Die Helme der Soldaten blitzten. Es blitzten die Degen der Offiziere. Der Vater, Bernard Bernhöven, Major und Bataillonskommandeur, saß auf seinem Rappen. Der Adjutant, Leutnant von Scheffke, auf einem Schimmel hinter ihm, die silberne Adjutanten-Schärpe »auf Taille«. Und weiter die schnarrende Stimme. Hochrufe. Kommandos. Dröhnender Parademarsch. Das kleine Mädchen in dem Schwanenbarett stand dicht hinter dem Vater, der die Parade abnahm, und die fünfhundert Männer, die mit ausgestreckten Beinen vorbeistampften, blickten zu ihm auf. Fünfhundert Männer. Warum taten sie das? Der Vater sah sehr stattlich aus, wenn er seinen Degen vor der Fahne senkte. Aber er war nicht immer so großartig. Sie schaute die Mutter an. Die machte ihr undurchdringliches Kirchengesicht. Das feierliche Gesicht. Die Kapelle schwenkte jetzt ein. Die Trompeten blitzten in der Wintersonne. Die Stiefelsohlen der Soldaten krachten. Die Kinder rasten hinter der Kapelle drein. Nur Lucia blieb Hand in Hand mit der Mutter zurück. »Warum weinst du?« fragte die Mutter streng. »Man weint nur, wenn man allein ist.« Und Lucia, die Zwölfjährige, antwortete: »Ich bin ja allein.« Sie standen tatsächlich allein auf dem Exerzierfeld. Ganz fern bumsten noch die Pauken. Dann war alles still. »Komm«, sagte die Mutter. Und sie gingen durch die beflaggte Stadt, um den See herum zur grauen Villa der Bernhöven hinauf. Ein Ritter mit Windfahne stand auf dem Dach. Der Wind kam von Osten.
Aber zurück nach Jena. Ungefähr – wenn man auf die Wirklichkeit kommen will, muß man der Reihe nach erzählen. Muß man? Gibt’s die Reihenfolge? Das ist schwer zu sagen. Mal treten die einen Jahre nah an uns heran, mal die anderen, und mal ist es ein Gemisch von Jahren und Erlebnissen, eine Kette, und man denkt, man hat den Faden in der Hand, das Leitseil (oder das Leid-Seil?), an dem man über Schroffen durch den Nebel getastet ist, ohne abzustürzen. Daß man vielleicht doch aus einem Grundmotiv heraus gehandelt hat, von einem primum movens getrieben. Ich kann das primum movens nicht entdecken – schrieb sie jetzt nieder. Die Verwirrungen, in die ich getrieben wurde, entwirrten sich »ohn’ mein Verdienst und Würdigkeit«. Ich entkam. Geschlagen, zerschlagen oft, aber ich entkam.
Sie stand auf und schob ein paar neue Buchenscheite in den kleinen Ofen. Sie prasselten und knackten. Der Teetopf auf dem Ofen begann zu dampfen und zu singen. Sie goß sich ein, hielt die immer noch frierenden Hände um die heiße Tasse, wandte sich wieder den Blättern zu und schrieb weiter. Sie schrieb, nein, sie malte versonnen, spielerisch-kalligraphisch und mit großen Buchstaben: »Es war mein schicksal und ist es geblieben, immer lieben zu müssen, wenn die liebe vorbei war.«