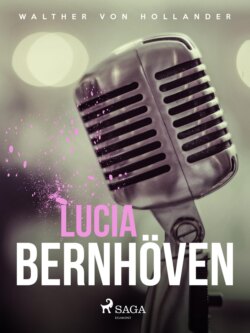Читать книгу Lucia Bernhöven - Walther von Hollander - Страница 8
1
ОглавлениеEigentlich waren es drei Feuer, durch die die Frau hindurchsehen mußte, um den Jenaer Frühling 1920 zu erspähen und heranzurufen. Das erste Feuer brannte in dem kleinen Kanonenofen der Mansarde im Hause des pommerschen Bauern Mowranke. Der rote Schein aus den Ritzen flackerte zuweilen über das Gesicht eines achtjährigen Mädchens, das friedlich in dem breiten Bett in der Ecke schlief. Sonst lag das Kindergesicht im Dunkeln. Denn die Kerze auf dem Tisch war zum Bett hin mit einem dunkelblauen Papierschirm aus einem Heftdeckel abgeschirmt. Die Frau, die an dem birkenen polierten kleinen Tischchen saß, hieß damals Lucia von Tweeren. Sie war – man schrieb den 26. Januar 1944 – fast 44 Jahre alt. Ihr Alter wuchs genau so wie dieses elende Jahrhundert. An jedem Tag, an dem sie ein Datum über einen Brief setzte, schrieb sie zugleich auf, wie alt sie war.
Sie saß in einem wattierten hellblauen Morgenrock, der an der unteren Kante Brandspuren und Brandlöcher zeigte. Sie saß auf einem hölzernen Küchenstuhl, dessen Lehne ein Herz hatte von der gleichen Form und Größe, wie sie die Lokustür hinten im Garten schmückte. Da sie damals sehr mager war, hatte sie sich ein großes Kissen untergelegt, dessen Ränder gleichfalls angesengt waren. So wurde sie denn im Schreiben, wenn sie herabsah (und sie dachte immer mit gesenktem Kopf nach), an das zweite Feuer erinnert, durch das sie in die Vergangenheit blickte.
Es war das Feuer in der Nacht vom 22. zum 23. November 1943 in Berlin. Sie hörte jetzt das Knistern und Krachen im Dachgebälk des Hauses in der Ansbacher Straße. Sie sah sich hustend im Rauch stehen. Die Fenster klirrten und zersprangen von der Hitze. Es war taghell. Denn auch drüben die Häuser und jenseits die Häuser brannten.
Lucia warf sinnlos, wahllos ein paar Sachen hinaus, Bücher z. B. Aber die geliebtesten Bücher ließen sich nicht finden. Das Kissen, auf dem sie jetzt saß, den Hausrock, der sie jetzt umhüllte, drei Männeranzüge (ich muß doch was für Rüdiger retten), Schuhe, eine Puppe (Püppi genannt, ein häßliches, zerzaustes Bündelchen). Das Bild, das Theo Grain von ihr gemalt hatte, junges Mädchen auf einer Veranda, riß sie von der Wand und warf es dann achtlos ins Zimmer zurück. Bettine mußte doch Kleider haben. Nein – die nicht rauswerfen, unter den Arm damit! Unter den anderen den Silberkasten mit dem Wappen der Tweerens. Den Leuchter noch, den peltzerischen Leuchter von der Mutter.
Und nun hinunter! Unerträglich der Rauch im Treppenhaus. Das hölzerne Geländer brannte schon. Ein Wahnsinn, wegen der paar Sachen zu verbrennen und Bettine unten allein zu lassen! Frau Querke, die Hausmeisterin, würde ja auch nur an ihre Sachen denken und das Kind, mein Himmel, das Kind! Sie rannte die Treppen hinunter, indem sie sich gegen die Wand drängte, damit das Feuer des Geländers sie nicht faßte. Im zweiten Stock sperrten Möbel den Weg. Diese Wahnsinnigen! Sie würden auf ihren Kommoden verbrennen. Aber Lucia hatte viel Kraft, wenn’s darauf ankam. (Ja, nur, wenn’s darauf ankam!) Wütend, schimpfend überkletterte sie die Hindernisse. Jetzt war die Treppe frei. Nur ein paar Menschen rannten auf und ab. Sie trugen läppische Wassereimer und Sandtüten, um das Feuer zu löschen, oder sie schleppten Stehlampen mit riesigen Papierschirmen hinab, Vogelkäfige, goldgerahmte Bilder. Eine Bande von kindischen Verrückten. Und Lucia von Tweeren, kindisch verrückt, zwischen ihnen. Endlich kam sie auf die Straße. Kein Wind mehr. Die Häuser brannten hell und feierlich. Die Dachbalken krachten, wie wenn ein Riesenhund sie mit seinen Kiefern zermalmte. Sie schrie nach Bettine, der Tochter. Ein dünnes, vergnügtes Stimmchen antwortete. Auf einem breiten, schäbigen Sessel saß sie, die verschmutzte, die verdreckte Puppe im Arm. Über den Kinderschultern den Hausrock, unter dem anderen Ärmchen das Kissen und einen verdreckten Band Rilke: ‚Von der Armut und vom Tode‘. »Püppi ist gerettet«, sagte Bettine wichtig, »und Papis Anzüge hat ein Herr aufgehoben.«
In diesem Augenblick brach der Dachstuhl des Hauses ein. Drüben auf der anderen Straßenecke flogen auch die brennenden Balken auf die Straße, und gleichzeitig gellten die Warnsirenen von neuem. Wohin jetzt? Wieder in einen Keller. An den brennenden Häusern entlang, die Flugzeuge brummend darüber. Da ... Lichter ... die Weihnachtsbäume, grelle Lichtkugeln, heller als die Brände. Hinein in einen Keller, ins Dunkle! Aus.
Das also war das zweite Feuer, durch das sie hindurchsah, während draußen der Plüggen, der große See, unter dem Hauch eines plötzlichen, verwirrten Tauwindes aufseufzte und zerbrach. Die Eisschollen knisterten und krachten wie die Dachbalken in der Ansbacher Straße. »Eis und Feuer sind dasselbe.« – Wer hatte das gesagt? Kein sehr tiefsinniger Spruch. Ja, richtig, er stammte von einem Privatdozenten der Philosophie, den sie jetzt durch das dritte Feuer hindurch erblickte. Es war das Sonnenwendfeuer 1920, hinter dessen Flammen das Gesicht des Universitätsphilosophen Springmeier auftauchte, eines kleinen, dicken, fröhlichen Mannes, der wie ein Gummiball durch das Feuer hüpfte, vor Lust krähend wie ein junger Hahn und immer wieder andere blumenkranzverzierte Damen mit sich zerrend.
Warum erblickte die Frau durch die drei Feuer hindurch gerade das faunisch-harmlose Gesicht Springmeiers, der nur eine kleine Nebenfigur dieses Festes war, eine Randfigur jenes Sommers? Sie zögerte lange. Dann schrieb sie schwerfällig und wider Willen: Weil die Hauptfiguren genau so erloschen sind. Ja, erloschen. Hinter den Feuern nicht mehr zu sehen. Gesichtslos, augenlos. Und hatte denn damals nicht das Herz geflammt? War es nicht verwirrt von einer süßen Erschütterung? Nachfühlen, nachspüren! Jetzt erinnerte sie sich wieder. Ganz warm spürte sie die gleiche Entzückung.