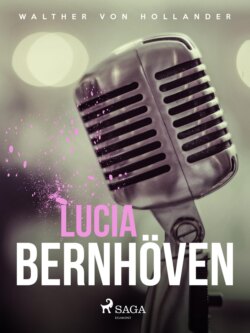Читать книгу Lucia Bernhöven - Walther von Hollander - Страница 6
3
ОглавлениеSie stand mit einem Seufzer auf, trat an den Tisch und legte mit schnellen, etwas fahrigen Bewegungen die Fotografien in den Standrähmchen um. Dadurch wurde ich erst auf die Bilder aufmerksam. Soviel ich sehen konnte, waren es die Bilder von zwei Männern und zwei Kindern. Unter den Büchern holte sie eine große Schreibmappe hervor, kam zurück und setzte sich wieder. »Nein, es geht nicht«, sagte sie mehr zu sich, »was für ein Blödsinn.«
»Also ist es ein Selbstporträt, eine Selbstbiographie oder so was Ähnliches?« fragte ich. Sie nickte: »Alle Frauen, die schreiben, schreiben Selbstbiographien. Die meisten Männer übrigens auch. Was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie gedacht, gefühlt, na, und vor allem, was sie gelitten haben. Höchst langweilig. Kein Mensch interessiert sich für die Halsschmerzen des anderen. Ist es nicht so?«
»Es sei denn, er liebte ihn«, sagte ich, weil ich sie in ihrem Monolog unterbrechen wollte. Sie sprach nämlich nicht eigentlich zu mir, sondern zu sich selbst, und es war die Fortsetzung vieler Selbstgespräche in einer nicht durchbrechbaren Einsamkeit.
Lucia nickte. Dann sah sie mich wieder mit ihrem durchdringenden, spöttisch-leuchtenden Blick an: »Und wer sich für die Halsschmerzen des Geliebten interessiert, der tut’s aus Ärger und Eifersucht. Die Halsschmerzen lenken den Geliebten doch von der Liebe ab, ja, sie sind ein Raub an der Liebe. Daher der Kummer.« »Liebe als Egoismus zu zweien ... da ist was dran«, sagte ich, eigentlich mehr, um die etwas zäh gewordene Unterhaltung fortzuspinnen. Die Bernhöven aber fuhr mir ziemlich ärgerlich ins Wort. Sie wollte keine Konversation mit mir treiben. Dazu sei meine Zeit zu schade und ihre auch. An geistreichen Anmerkungen zum Leben, an halbgaren Aphorismen mangle es ihr nicht. Die könne sie am laufenden Band produzieren. Das war eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit. Denn ich hatte mich ihr ja wahrhaftig nicht aufgedrängt. Sie hatte mich aufgelesen und mitgeschleppt. Und ich sagte ihr das deutlich.
Sie hörte sich das freundlich an. »Nun geben Sie mir doch noch einen Schnaps«, sagte sie, »wir kommen langsam in das Stadium ehrlichen Gespräches.«
Ich schenkte ihr ein, und wir stießen miteinander an. »Wenn ich grob sein muß«, sagte ich ihr, »so bin ich durchaus nicht ehrlich, sondern höchstens gereizt und nervös«, und reichte ihr die Hand zur Versöhnung. »Und nun wollen wir anständig und kameradschaftlich miteinander reden. So geradeaus, wie es nur Menschen vermögen, die sich nicht kennen.«
Sie nickte, behielt meine Hand in der ihren, betrachtete einen Augenblick neugierig die Linien der Innenfläche, ließ plötzlich los und ging zum Ofen, um ihn polternd und rackelnd wieder in Gang zu setzen. Sie kam zurück, setzte sich auf die Lehne ihres Sessels und sagte vorsichtig tastend: »Finden Sie nicht, daß man sich in den ersten Minuten des Kennenlernens am besten kennt? Da hat man noch die Übersicht über das Ganze, den ersten, frischen Eindruck. Die vielen ablenkenden Einzelheiten sieht man noch nicht. Vorhin, als Sie hereinkamen, mit einem Blick das Zimmer abtaxierten und es mit mir verglichen ... wußten Sie da nicht ziemlich genau, wer ich bin?«
Ich mußte das zugeben. Sie war mir, je länger wir miteinander gesprochen hatten, um so unklarer geworden. Die scharfen Konturen ihres Bildes waren schon wieder etwas verwischt. Jetzt hätte ich nur noch einzelne Charakterzüge beschreiben können, sehr vage Eindrücke von allerlei Gegensätzlichkeiten. Ungebärdig etwa und sehr beherrscht, unkonventionell und an den Formen hängend. Einsam und sehr an das Leben gebunden. Sehr empfindsam und dem Groben zugeneigt. Aber auch äußerlich sehr gegensätzlich: sekundenlang erregend schön, anziehend, ja verführerisch, und gleich darauf wieder durchschnittlich aussehend, etwas zu männlich und betont uneitel. »Sie haben recht«, sagte ich, »ich kenne Sie nicht mehr. Wir können also ruhig von unbekannt zu unbekannt sprechen. Sie können mir z. B. was vorlesen. Ich werde es anhören, meine Meinung sagen und es wieder vergessen. Wahrscheinlich werden wir uns nie wiedersehen.«
Sie lächelte ein liebliches Lächeln, und ich mußte an Rabners, des Journalisten, Anrede »Eure Lieblichkeit« denken. »Wahrscheinlich nicht«, sagte sie, »denn sicherlich sind Sie darin ebenso wie ich: Sie suchen keine Freundschaften. Sie suchen überhaupt keinen Menschen mehr. Aber das Pech will’s, wenn man sie nicht sucht, findet man sie, ja, man stolpert über sie. Hoffentlich erschreckt es Sie nicht, wenn ich Ihnen sage: Wir sind bereits befreundet. Ob wir wollen oder nicht. Stimmt’s?«
Und da ich nicht gleich zustimmte, trat sie zu mir, legte mir die Hände auf die Schulter und setzte sehr herzlich hinzu: »Es ist, ich schwör’ es Ihnen, keine Liebeserklärung, obwohl man sich ja auch in Sekunden hoffnungslos oder hoffnungsvoll ineinander verlieben kann. Es ist wortwörtlich eine Freundschaftserklärung, und Sie können nicht umhin, zuzustimmen. Also trinken Sie auf unsere Freundschaft.« Ich prostete ihr zu. Sie hatte recht. Wir waren befreundet, und wir sind es bis auf den heutigen Tag geblieben, obwohl wir uns nur selten sehen, obgleich wir uns niemals besonders drum bemüht haben, uns zu treffen oder zu sprechen. Es ist eine verläßliche, gute und fruchtbare Freundschaft geworden.
Wir hatten wohl fünf Minuten friedlich miteinander geschwiegen. Sie aß ihr Käsebrot recht unachtsam, und ich rauchte vor mich hin. Dann bat ich sie, sie möchte mir nun endlich vorlesen. Aber sie lehnte das ab. Nein, sie könne es nicht. Aber vielleicht würde sie mir etwas schicken. Es seien auch erst hundert oder hundertzwanzig Seiten, Anfänge, Versuche, ein ewiges Ringen mit der Unehrlichkeit, mit der Beschönigung, mit den überlieferten Gefühlen, mit dem, was sein sollte und in der Tat nicht ist. »Was wirklich ist«, sagte ich, »das ist also der Titel.« »Der Arbeitstitel«, verbesserte sie mich, »wie man das bei schlechten Filmen sagt, wenn man nicht weiß, was man eigentlich ausdrücken will. Die Richtschnur oder, wenn Sie wollen, der Ariadnefaden im Labyrinth. Es ist soviel Unsinn über die Frauen zusammengeschrieben worden, und dieser Unsinn hat soviel Unheil angerichtet, und da dachte ich ... naja, da dachte ich eben ...«
»Sie dachten, Sie könnten den Frauen helfen, wenn Sie einmal schrieben, was wirklich ist.«
»Nein, das überlasse ich Ihnen«, lachte sie, »ich wollte mir selbst helfen. Eine männliche Münchhausenillusion – sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf holen. So einfach ist das nicht. Zunächst schlägt man um sich und sinkt immer hübsch weiter hinein.«
Sie schloß die Mappe auf. Da lagen vier große Briefumschläge, jeder beschriftet mit einem Kapiteltitel. Sie nahm zwei Umschläge heraus. »Sehen Sie ... das ist ordentlich der Reihe nach erzählt. Das Mutterhaus zum Beispiel. Ja, es war kein Vaterhaus. Mein Vater war mir fremd wie ein Fidschiinsulaner. Er war wohl auch so primitiv. Und hier haben Sie die Studienjahre. Erste Liebe inklusive. Ich hab’ sogar meinen Doktor gemacht. Summa cum laude. Zu meinem größten Erstaunen. Über Rilke natürlich. War damals so. Und hier ...« Sie packte die Umschläge plötzlich ärgerlich zusammen und schloß die Mappe. »Nein, das ist eben nicht richtig. Es geschieht gar nicht alles so hübsch und wohlgeordnet hintereinander. Oder doch nur im Anfang. Nachher – das finde ich so unheimlich –, nachher ist das Vergangene, das Gelebte, immer gegenwärtig. Oder ist es nicht so?«
Sie wischte sich über die Augen. »Ich bin sehr müde, lieber Freund«, sagte sie und erhob sich. »Wir müssen uns trennen. Schade. Es war schön mit Ihnen. Wie es eben immer schön ist, wenn man über sich selbst schwätzt.«
Sie zog sich ihren Mantel an und begleitete mich hinunter, das heißt, sie lief mir genau so voran, wie sie es beim Kommen getan hatte, um den Geiz des Hauswirtes zu überlisten. Draußen zog sie aus ihrem Mantel einen der großen Briefumschläge. Sie sagte: »Immerhin ... lesen Sie es. Es ist die Geschichte einer Jugendliebe. Von fernher gesehen. Und da dürfen Sie schon mitschauen.«
Damit umarmte sie mich herzlich und war gleich im Hause verschwunden. Ich sah noch, wie die Hausbeleuchtung ein paarmal an und aus ging. Sie war also immer noch dabei, den Geiz des Hauswirts zu überlisten.
Als ich nachher in einem kalten Hotelzimmer in meinem klammen Bett den Briefumschlag öffnete, fielen mir dreißig Blätter in Quartformat entgegen, schönes, glattes Friedenspapier, das sie mit einer exakten und schwungvollen Schrift vollgemalt hatte.
Ja, die Blätter waren eigentlich nicht beschrieben, sondern glichen eher kleinen Gemälden aus Schriftzeichen. Wie die Zeilen sehr genau voneinander abgesetzt waren, wie die Absätze gegeneinandergestellt, wie die Buchstaben mal aneinandergereiht waren, mal flüchtig auseinanderliefen ... das gab jeder Seite ein anderes, ein eigenwilliges Gesicht. Das reizte zum Lesen. Ich begann trotz meiner Müdigkeit gleich mit diesem Manuskript. Der Titel des Kapitels lautete:
»Jenaer Frühling 1920 – durch zwei Feuer gesehen«. Unerwarteterweise schrieb sie nicht in der Ichform, sondern in der allein epischen dritten Form. Das hatte ich am wenigsten erwartet.