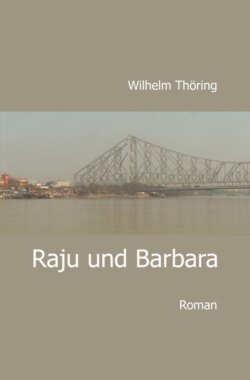Читать книгу Raju und Barbara - Wilhelm Thöring - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
11
ОглавлениеIn Deutschland bereiten sich die Menschen auf Weihnachten vor. Als Barbara noch drüben lebte, da hat sie sich nicht viel aus diesem Fest gemacht, dem viel Arbeit, Hetzen und Laufen, Überlegen und Putzen und andere Vorbereitungen vorausgingen. In diesem Land mit seinem ungewohnten Klima überfällt sie Wehmut, wenn sie an Straßen und Schaufenster denkt, die mit Kerzen und Tannengrün und vielen anderen Besonderheiten geschmückt sind, die zu diesem Fest gehören, dazu die besondere Stimmung, die über dieser Zeit liegt. Sie denkt auch zurück an ihre Kindheit. Wie erfüllt und selig konnte sie sein, wenn es auf Weihnachten zuging und so viel Geheimnisvolles in der Luft lag. Hier hat sie monatelang unerträgliche Hitze oder Regengüsse, die mit Sonnenschein wechseln, und um diese Zeit sind die großen Kaufhäuser in Kolkata und anderswo mit bunten Luftschlangen und Luftballons und überreich mit farbigen Lichterketten geschmückt ... Drüben, denkt sie, könnte es frieren, vielleicht sogar schneien, da ist die Luft frisch und klar und voller Gerüche
Sie hat Raju gefragt, ob es in Indien auch Tannenbäume gäbe – Raju wusste es nicht.
„Warum fragst du danach“, wunderte er sich. „In Deutschland hast du auch nichts danach gefragt. In den ersten beiden Jahren hatten wir einen Baum, danach nicht mehr.“
Aber diesmal hätte sie gerne einen in der Wohnung, antwortete sie, worauf er sie nur seltsam angesehen hat.
Einen Tag vor Weihnachten hat Raju sie mit einem Tannenbaum besonderer Art überrascht. Ashim hat drei größere Baumzweige zusammenbinden und sie in die Form einer Tanne schneiden müssen, den hat Raju, geschmückt mit elektrischen Kerzen und bunten Stanniolgirlanden, mit Nüssen und Datteln, vor das Gartenfenster des Wohnzimmers gestellt. Oben, wo an deutschen Weihnachtsbäumen ein Stern oder eine Spitze aufgesteckt wird, hat er eine Schleife drapiert, auf der zu lesen ist: Fröhliche Weihnachten! Und darunter hat er dasselbe auf Bengali geschrieben.
„Eine Tanne ist hier nicht zu bekommen“, sagte Raju, der wie ein kleiner Junge vor ihr stand und sich freute, dass ihm die Überraschung gelungen war. „Vielleicht hätte ich in einem der großen Kaufhäuser einen künstlichen auftreiben können, aber solche hast du nie gemocht. So hat Ashim dir das hier gebastelt! Er hat keine Nadeln, aber die Form eines Weihnachtsbaumes. Im nächsten Jahr hast du einen richtigen Weihnachtsbaum, wie er in deutschen Häusern steht. Versprochen, Bärbel, versprochen!“
Rajus Eltern, denen dieses Fest nicht fremd ist, zeigten sich verwundert, dass in einem indischen Haus solche Moden eingeführt werden sollen. Der Vater meinte, der Baum gehöre nicht auf einen Tisch, er gehöre auf den Fußboden, dann wäre er auch für den Hund zu gebrauchen. Und doch saß er die ganze Zeit so, dass er dieses fremde, eigenwillige Gebilde ansehen konnte. Ja, an diesen Tagen hielten sich die Schwiegereltern viel länger beim Sohn auf, als sie es sonst taten.
Am Abend des zweiten Weihnachtstags, den sie vom Morgen bis zum Dunkelwerden wegen der angenehmen Temperatur auf der Terrasse zugebracht haben, will Doktor Sharma sich aus seinem Korbsessel erheben, um sich ein wenig im Garten die Füße zu vertreten. Er stützt sich mit beiden Armen auf die Lehne, dann fällt er wieder zurück. Auch beim zweiten Versuch kommt er nicht auf die Beine, er stürzt sich auf die Armlehne und kippt mitsamt dem Sessel um. Barbara und Raju führen ihn nach oben in sein Schlafzimmer, aber der alte Mann wehrt sich; er will nicht von ihnen wie ein Kind ins Bett gebracht werden, mault er. Sie bleiben eine geraume Weile bei ihm, und als sie gehen, setzt sich die Mutter zu ihm aufs Charpoy.
Am darauf folgenden Tag, bevor es hell wird, steckt die Mutter ihren Kopf durch das Moskitonetz ihres Sohnes, um ihn zu wecken. Sie versucht zu flüstern, doch sie ist so laut, dass Raju und auch Barbara sofort hellwach sind. Barbara schlägt das Moskitonetz zurück:
„Was ist, Raju? Was will die Mutter?“
„Der Vater ...“
„Was ist mit ihm?“ Barfuß, ohne sich etwas überzuziehen, läuft Barbara ins Schlafzimmer der Alten.
Doktor Sharma liegt mit offenem Mund, die Augen aufgerissen und starr gegen die Zimmerdecke gerichtet, auf seinem Bett, neben ihm steht die Tasse mit kaltem Tee vom gestrigen Abend. Raju befühlt den Vater, er legt ein Ohr auf seine Brust, dann nimmt er den Spiegel von der Wand, den er ihm dicht vor den Mund hält, um zu sehen, ob sich Atemspuren darauf zeigen.
Der Mutter, die auf der anderen Bettseite hockt und den Sohn beobachtet, sagt er, dass der Vater gestorben sei. Die alte Frau seufzt auf, sie zieht den Schleier tief ins Gesicht und zieht sich in ihr Schlafzimmer zurück, als könne sie es hier nicht mehr aushalten; geräuschvoll schließt sie ihre Tür ab, um nicht gestört zu werden. Erst ist von ihr nichts zu hören, dann fängt sie zu jammern an; sie ist aber sofort still, als die Kinder an ihre Tür klopfen, um mit ihr zu reden.
Nein, sie öffnet nicht, sie will allein sein.
Raju hat alles für den toten Vater getan, was ein indischer Sohne in einem solchen Fall zu tun hat. Weil Rahul mit seiner nichtsnutzigen Frau wieder irgendwo durchs Land zog, fiel ihm die Aufgabe zu, den Vater in angemessener Weise einzuäschern. Die in ein weißes Laken eingeschnürte Leiche wurde zu einem Ghat an den Fluss getragen, wo sie, wie es der Brauch verlangt, ins Wasser getaucht wurde; reichlich Holz ist aufgeschichtet worden, die Priester waren bestellt, um das ihre zu tun – einen Hammer auf dem Schoß, saß Raju beim Scheiterhaufen, bis die Flammen getan hatten, wozu er sie entzündet hatte. Den Hammer brauchte er nicht, denn der Schädel des Vaters hatte sich von selbst geöffnet, um die Seele frei zulassen. Als die Flammen erloschen waren, wurde die Asche zusammengekehrt und in eine Urne gepackt. Die Asche will sie nicht hier in Kolkata dem Wasser übergeben, sondern in Varanasi, dem heiligsten Wallfahrtsort im ganzen Land.
Durch den Tod des Vaters tauchte Raju wieder tief ins Indische, das seit Urzeiten das Leben dieser Menschen, das ihr Denken und Handeln bestimmt. Er ist für Barbara auch äußerlich fremd geworden mit seinem glänzenden, rasierten Schädel und der verbliebenen Haarsträhne am Hinterhaupt. Manchmal erschrickt sie, wenn sie ihn sieht, ein andermal beschleicht sie Angst vor seinem Aussehen.
Mit Verwunderung sah Barbara diesen Wandel, der sich durch Tod und Ritus an ihrem Mann vollzog. Ihr kam es vor, als glitte Raju Tag für Tag weiter von ihr weg, und die Stütze, deren sie so sehr bedurfte und die er ihr zugesagt hatte, vermochte er nicht mehr zu sein.
Durch die Urne, ein irdenes schmuckloses Gefäß etwa so groß wie eine mittlere Konservendose, die hinter Blumen verdeckt im Bücherregal steht und auf den Tag wartet, um in den Ganges entleert zu werden, ist der alte, zornige Mann für Barbara ebenso stark und lebhaft gegenwärtig wie zu Lebzeiten. Ihr ist, als verfolge der Schwiegervater sie immer noch mit seinen Blicken und als habe er sogar daran etwas auszusetzen, wenn sie sich in diesem Zimmer aufhält.
„Seit Tagen bist du wortkarg wie jemand, der schmollt, und jetzt sitzt du eingepackt wie eine Kranke auf der kühlen Terrasse, Bärbel!“
Barbara fährt zusammen, denn Raju ist leise gekommen, er geht barfuß, als dürfe er seit dem Tod des Vaters keine Schuhe mehr tragen.
„Du hast mich erschreckt“, sagt sie. „Raju, ich bitte dich: wenn du die Asche nicht hier in den Fluss geben willst, der doch ein Seitenarm des Ganges und ebenso heilig ist – lass uns bald nach Varanasi fahren, dass wir sie dahin bringen, wo du sie dem Wasser übergeben willst, wo sie hin gehört.“
Raju setzt sich ihr gegenüber, er ist verschwitzt, schiebt die Unterlippe vor und macht sich damit nur noch hässlicher, findet Barbara.
Er sagt leise und es klingt, als wollte er sie um etwas bitten: „Zuerst muss die nötige Zeit verstreichen; nach dreizehn Tagen darf die Asche dem Wasser übergeben werden. Und wenn ich fahre – Bärbel, ich werde auch dahin allein fahren müssen. Ich habe dir gesagt, dass Frauen bei religiösen Zeremonien nicht zugegen sein dürfen ...“
„Auch dabei nicht?“
„Ja, auch dabei nicht, so ist es bei uns! Auch die Mutter bleibt hier, sie kennt es nicht anders.“
„Soll sie hier alleine sitzen? – Eure Religion geht hart mit den Frauen um ...“
Raju hebt ratlos die Schulter. „Wenn du hier bleibst, dann ist sie nicht allein. Man sagt, wenn bei solchen Handlungen Frauen dabei sind, dann gibt es ein Malheur in der Familie.“
„Ich bin keine Hindufrau.“
„Aber eine Frau!“
Barbara wirft die Decke von den Schultern und läuft einige Male durchs Zimmer, und dabei stößt sie hervor: „Raju, wie kann ich deine Mutter trösten? Jede spricht eine andere Sprache. – Bitte, nimm mich mit. Ich halte mich abseits. Ich stehe irgendwo als zuschauende Touristin. Es ist wichtig für mich, zu sehen ...“
Barbara bricht ab und setzt sich wieder in ihren Sessel, bis an die Augen hat sie sich in ihre Decke eingehüllt, so dass er nur wenig von ihrem Gesicht sehen kann.
„Wenn du mitfährst, Barbara, dann wird die Mutter jedes Missgeschick, jedes Unheil, das uns vielleicht treffen wird, allein der Tatsache zuschreiben, dass du dabei gewesen bist, als ich Vaters Asche der heiligen Mutter Ganga übergeben habe.“
Der Tag ist gekommen, dass Raju seine Sohnespflicht dem
Vater gegenüber erfüllen kann, und somit auch der Wunsch Barbaras, die kleine Dose mit dem unangenehmen Geist des Schwiegervaters wegzutragen, um sie dem Fluss übergeben zu können.
Einen Tag, bevor es soweit ist, kommt Raju aus Kolkata zurück und winkt ihr aus dem Auto mit Papieren zu. Neben dem Wagen herlaufend, den Kali sehr vorsichtig, weil beide Hunde ihn umspringen, durch den Hof zur Garage fährt, ruft sie:
„Was hast du da?“
„Zwei Fahrkarten nach Varanasi! Bärbel, du wirst mitfahren und dir die heilige Stadt ansehen, während ich Vaters Asche dem Ganges übergebe, so werde ich das der Mutter erklären. Das wird sie vielleicht verstehen.“
Raju hat Karten für den Doon Express gekauft, der nicht in der Frühe nach Varanasi fährt, sondern am Nachmittag, so dass sie ihr Ziel am anderen Morgen gegen sieben erreichen. Sie hoffen, die Nacht über durchschlafen zu können; ausgeruht werden sie sich in Varanasi nach einer Bleibe umsehen.
„Rahul“, jammert die Mutter, und dabei hält sie Rajus Hand fest, „Rahul hätte niemals seine Frau dazu mitgenommen. Aber diese europäische Frau setzt alles durch, was sie sich vorgenommen hat, und du lässt sie gewähren! Sie lebt nun schon so lange Zeit in unserem Land, aber seine Ordnungen gelten ihr noch immer nichts. Sie legt es geradezu darauf an, Unglück ins Haus zu holen. Ja, das Unglück hat damit begonnen, dass sie Rahul, meinen Ältesten, fortgetrieben hat, dass er bei der Einäscherung nicht tun konnte, was seine Pflicht gewesen wäre.“
Eine Weile hat Raju sich ihre Klagen angehört, dann meinte er, er hätte ihr alles erklärt, und Barbara würde sich vernünftig verhalten und sich bei der Puja nicht am heiligen Fluss sehen lassen. Die Fahrkarten nach Varanasi wären gekauft und er werde mit seiner Frau fahren und die Sache zu Ende bringen.
Eine Weile jammerte die Mutter noch, dann ergab sie sich ins Unabänderliche und sagte: ja, sie wäre es gewohnt, dass man weder auf Sitten noch auf sie selbst Rücksicht nähme.
Barbara, die die meiste Zeit hinter der weißen Mauer ihres Anwesens lebt und nur selten in die Betriebsamkeit der Stadt kommt, ist vom Lärm auf dem Bahnhof Varanasi Junction ganz verwirrt, greift nach Rajus Hand, als könnte sie im Getümmel verloren gehen.
„Mir wird geradezu schwindelig“, sagt sie. „Lass uns einen Imbiss einnehmen.“
Ein missmutiger Rikschafahrer bringt sie zu einer dunklen, schmierigen Spelunke, die ungesäuertes Fladenbrot, Chapatis, anbietet und Samosas, Teigtaschen mit Gemüsefüllung; auch Tee ist zu haben. Beflissen taucht ein fast schwarzer, halbnackter Mensch aus dem Dunkel auf und langt unter den Tisch, an den die Gäste sich gesetzt haben. Da hat er einen speckigen Lappen an einem Nagel hängen, mit dem er über die Tischplatte fährt. Nachdem er den Lappen wieder an seinen Nagel gehängt hat, schleicht ein Köter unter den Tisch, um den Lappen abzulecken.
„Hier bringe ich keinen Bissen herunter“, stöhnt Barbara, und erhebt sich voller Ekel; und Raju geht es nicht anders; beide flüchten auf die Straße und lassen sich zum Bahnhof zurückfahren, wo Raju ein Fremdenverkehrsamt gesehen hat, das ihm Gasthäuser und Hotels in der Altstadt nennt.
Sie entscheiden sich für ein Hotel an den Ghats, wo Tag für Tag die Feuer der Einäscherungen brennen; ganz in der Nähe liegt der heiligste aller Badeplätze, wird ihnen gesagt. Da könnte er zu einem rituellen Bad ins Wasser steigen, erklärt Raju, denn so schnell wird sich ihm nicht noch einmal eine solche Gelegenheit bieten.
In der Frühe des nächsten Morgens drängt Raju zum Aufbruch; heute soll die Asche seines Vaters in die Fluten des heiligen Ganges gesenkt werden.
Im Speisesaal wartet der Boy mit einem kleinen Imbiss und heißem Tee, wie Raju es gewünscht hat.
Raju ist in Eile; er ist unruhig und will schnell einen Priester und ein Boot mieten, damit auch diese letzte Sache zu einem guten, zu einem würdigen Abschluss kommt.
Er geht, und Barbara folgt ihm unauffällig und in größerem Abstand; eine Touristin, die zufällig am Ghat herumschlendert.
Der Fluss und die Häuser an seinen Ufern liegen im fahlen Licht der Morgensonne. An einem Ghat sieht Barbara zwei brennende Scheiterhaufen, in geziemendem Abstand hocken männliche Angehörige und sehen zu; sie warten darauf, dass die Asche zusammengekratzt wird.
Die Ghats sind Durchlässe zwischen der Häuserzeile am Westufer des Flusses; sie sind gleichsam Tore, an denen die gläubigen Hindus über viele Stufen zum Fluss hinuntersteigen, wo sie sich reinigen und beten.
Rajus Ziel ist nicht weit von den beiden brennenden Scheiterhaufen, da wird er die Asche seines verstorbenen Vaters den Fluten übergeben. Aufrecht, mit im Licht glänzendem Schädel steigt er die Stufen zum Fluss hinunter. Langsam, die Hände aneinander gelegt und in die Höhe reckend, steigt Raju zum Bad ins heilige Wasser, zum Bad, das Körper und Seele von allem Schmutz, von aller Sünde reinigen soll.
Aus einer kleinen Gruppe Brahmanenpriester, die schweigend an einer Mauer steht, lösen sich, als sie Raju erkennen, zwei ältere, wild aussehende Männer. Sie gehen mit nacktem Oberkörper, die weiße Brahmanenschnur quer über Brust und Rücken, und mit weiß bemalten Armen. Über die Stirn läuft ein breiter weißer Strich, aus dem das Tika, der rote Punkt als drittes untrügliches Auge, hervorleuchtet, das die Wahrheit trotz aller Täuschungen erkennt.
Raju verneigt sich vor ihnen und berührt ihre Füße, dabei scheint er das Gleichgewicht zu verlieren; ungerührt steht der Priester über ihm.
Zu den hinduistischen Kulthandlungen für einen Verstorbenen, der Puja, wie alle religiösen Zeremonien heißen, wird nicht nur dem Verstorbenen, sondern auch den Vorfahren Respekt gezollt. Dazu gehören Waschungen, gehören lange Gebete, Lesungen und geweihtes Wasser, Räucherwerk und Blumen, sowie Reiskuchen und Süßigkeiten.
Barbara sieht oben an eine Hauswand gelehnt zu, aber sie versteht nichts von dem, was sie sieht, obwohl Raju ihr alles erklärt hat. Was da vor sich geht, ist fremd, der Priester verrichtet es mechanisch, ohne den feierlichen Ernst, den sie bei religiösen Zeremonien erwarten würde. Ob er nun betet oder die heiligen Sanskritverse rezitiert – er ist mehr an dem interessiert, was um ihn herum geschieht.
Seine Teilnahmslosigkeit an dem, wozu er von Raju angeworben worden ist, erschreckt sie.
Als das beendet ist, besteigen die Männer das bestellte Boot und werden ein Stück weit in die Flussmitte gerudert. Steif, mit starrem Blick sieht Raju in die Ferne, als suche er nach einem Platz, der dem toten Vater während des Wartens auf seine Wiedergeburt behagen könnte. Als sie fast die Mitte des Flusses erreicht haben, lässt Raju, auf ein Zeichen des Priesters, die Asche des Vaters aus der tönernen Urne ins trübe und graue, ins heilige Wasser rieseln. Es ist der jüngere und hübschere der beiden Priester, der bisher nichts sprach, auch nicht gebetet und gelesen hat, sondern nur darauf acht gab, was der ältere tat und dass vom Angehörigen des Toten kein zeremonieller Fehler begangen wurde.
Der leitende Priester rezitiert aus den heiligen Texten, leiernd und hastig und den Kopf nach diesem und jenem drehend, wie er es die ganze Zeit getan hat. Dazu räuchert er und lässt immerzu das hell klingende Glöckchen ertönen.
Barbara sieht Staub aus der Urne rieseln, und alle schauen dem Staub nach, der eine Weile auf den Wellen schaukelt, dann ist er wie ein Dunst verschwunden; nur die Öllämpchen sind da und die Blüten der Tagetes, die von Raju der Asche hinterher gesendet wurden. Die Urne ist ihm beim Entleeren aus den Händen gefallen und mit einem glucksenden Laut verschwunden. Jetzt erinnert Raju sich, dass seine Frau oben zwischen den Häusern steht, er wendet den Kopf, nickt ihr zu und wendet sich gleich wieder ab.
Noch am selben Tag hat Raju sein Bad im Ganges genommen.
Alles ist für den verstorbenen Doktor Sharma gehalten worden, wie es sich gehört, obwohl Raju sagte, ihm bedeute das nichts, er täte es nur wegen der Mutter: Sie haben gefastet, haben nach den Vorschriften die Zeit ohne Fleisch und ohne Fisch eingehalten, sie haben keine weiten Reisen unternommen und des Toten gedacht.
Dagegen hatte seine Mutter nichts einzuwenden, das wäre ein guter Brauch, sagte sie und sie freue sich auf den Tag, an dem wieder Fleisch und Fisch auf den Tisch käme.