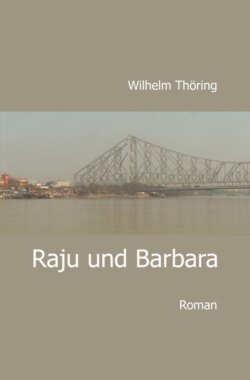Читать книгу Raju und Barbara - Wilhelm Thöring - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеMit einem Besuch bei Frau Mamtani hat Barbara nicht lange gewartet. Eines Vormittags hat sie Frau Mamtani angerufen und sie sind übereingekommen, sich am übernächsten Tag zum Tee zu treffen. Um Schwierigkeiten zu umgehen, hat Frau Mamtani dem Chauffeur den Weg in seiner Sprache beschrieben; und Kali hat nur wenig notiert, denn er kenne die Gegend, hat er Frau Mamtani erzählt, er habe da vor einigen Jahren gewohnt; und so war er für diese Fahrt sofort bereit und wartete darauf, dass es bald losgehe.
Das Haus, in dem Frau Mamtani wohnt, ist dem sehr ähnlich, in dem die Treffen der Pastorin Rosenberg stattfinden: Es ist groß und dunkel, im Flur hängt ein schwerer Geruch von Gewürzen, von Fäulnis und Unrat und voll von Ausrangiertem und jeglicher Art Müll. Oben über dem Geländer zeigt sich Frau Mamtanis Kopf.
„Frau Sharma? Drei Treppen müssen Sie steigen. Ich wohne in der dritten Etage. Seien Sie vorsichtig! Sie sehen ja, was hier herumliegt!“
Müll liegt auf jeder Etage, und je höher sie kommt, umso mehr liegt da herum, ist Barbaras Eindruck.
Strahlend streckt Frau Mamtani ihr beide Hände entgegen. Sie hat sich fein gemacht, als wollte sie ausgehen.
„Willkommen in diesem vor Dreck und Speck strotzenden Haus! Wie schön, dass Sie das Treffen nicht auf die lange Bank geschoben haben, Frau Sharma. Bitte, treten Sie ein. – Der Mensch, der den Müll zu entsorgen hatte, ist einfach abgetaucht“, erklärt sie.
Frau Mamtani scheint die Reinlichkeit und Ordnung ihrer eigenen Wohnung gegen den Dreck im Treppenhaus setzen zu wollen. Sie ist eingerichtet wie manche kleinbürgerliche Wohnung irgendwo in einem deutschen Nest: Frau Mamtani hat sie vollgestopft mit dunklen, geschweiften Möbeln. Überall steht Nippes auf Häkeldeckchen zwischen Fotografien und einer Unzahl von kleinen, zum Teil leeren, Blumenvasen, und neben dem Fenster tuckert sogar eine Kuckucksuhr durch die Zeit.
„Von allem indischen Kram hatte ich die Nase voll“, sagt Frau Mamtani. „In allen Räumen hatte mein Mann Indisches aufgestellt – sogar im Klo! Shiva, Shiva, und nochmals Shiva! Und dazwischen Kali, die Schreckliche, der Affengott Hanuman, Vishnu und Ganesh, Sie wissen, der mit dem Elefantenkopf – dazu die vielen, vielen Kultgegenstände! Oft war mir, als wäre ich schon im indischen Jenseits gelandet, glauben Sie mir!“
Sie rückt Barbara einen Stuhl hin und eilt etwas aufgescheucht in die Küche, um Tee zu kochen.
Barbara sieht sich um: Es stimmt, nirgendwo ist eine der vielen indischen Gottheiten zu sehen. In ihrer Wohnung sind selbstverständlich welche zu finden, keine Allerweltsfiguren, die an jeder Ecke zu haben sind. Raju ist wählerisch beim Kauf gewesen, unaufdringlich und gut dosiert stehen sie bei uns in den Regalen, findet Barbara.
Beim Tee erzählt Frau Mamtani, dass sie nach dem Tod ihres Mannes, der ein guter, verständnisvoller und großherziger Mensch gewesen sei, von einer großen Sehnsucht nach Dingen überfallen worden wäre, die man mit Deutschland verbindet. Um in Indien überleben zu können, wie sie sich ausdrückt, hätte sie zum Deutschen zurückfinden müssen. So hätte sie sich kurz entschlossen von allem gelöst, was an ihren Mann erinnerte. Und das wären vor allem die Götterstatuen und das indische Mobiliar gewesen.
„Haben Sie nicht daran gedacht, nach Deutschland zurückzukehren?“
„Hab’ ich, meine liebe Frau Sharma, hab’ ich! Aber wohin sollte ich denn ziehen? Von meinen engen Verwandten ist niemand mehr da. Eine Nichte gibt es, ein paar Cousins vielleicht, oder auch nicht. In Deutschland wäre ich fremder, als ich es hier bin.“
Ungeniert und etwas neugierig betrachtet Frau Mamtani ihr Gegenüber. Und plötzlich hellt sich ihr Gesicht auf und sie muss lächeln.
„Ich habe den Verdacht, Frau Sharma, Sie haben, als Sie sich für Indien entschieden hatten, an veränderte Lebenssituationen ebenso wenig gedacht wie ich damals. Es ist so: die wenigsten denken daran, dass sie ihr Leben völlig umkrempeln müssen!“
Barbara, die darauf nicht antworten möchte, weil es sich so verhält, wie Frau Mamtani sagt, hebt ihre Tasse an die Lippen und schaut Frau Mamtani von unten herauf an: Ja, es ist, wie Sie sagen, das wäre ihr vorschnell über die Lippen gekommen. Aber Frau Mamtani hat vielleicht gar keine Antwort erwartet, denn sie fährt rasch fort:
„An der Seite unserer Männer gehen wir für dieses Land auf, weil sich der Reiz der Männer wie selbstverständlich auf Land und Brauchtum überträgt. Sind sie gestorben und haben uns allein gelassen, dann flattern wir hilflos zwischen Himmel und Erde. Und das Schlimme ist: Wir wissen nicht, wo der Himmel ist, wo die Erde. Dann gleichen wir dem Treibsand, der kein Ziel, nirgendwo eine Bleibe hat. Um die Füße wieder auf den Boden zu bekommen, das braucht seine Zeit.“
Wieder lächelt Frau Mamtani; aber ihr Lächeln gilt nicht der Besucherin, sie lächelt in sich hinein, so wie jemand lächelt, der sich eingesteht: ja, es hat mich große Mühe gekostet, bis ich zu mir selbst gefunden habe.
Schweigend hängen beide Frauen ihren Gedanken nach. Der Kuckuck springt aus dem Türchen und schluchzt seine Gluckser in den dunklen, stillen Raum.
„Verrückt, nicht wahr?“
Frau Mamtani legt den Kopf zurück, damit sie die Uhr sehen kann. „So etwas Urdeutsches, Provinzielles in einem Haus in Kolkata! Wäre mir früher jemand mit so etwas gekommen – Frau Sharma, ich hätte es schleunigst verschenkt oder in einen Basar gegeben. Und jetzt habe ich mir mitten im tiefen Indien mein verabscheutes Deutschland gebaut. Die Uhr, Tischdecken und gestickte Sofakissen, die Bilder – Sehen Sie einmal: Hier eine Heidelandschaft, drüben eine verlorene Hütte in den Alpen. Aber ich fühle mich wohl zwischen diesem Zeugs, so ist es! – Nun habe ich nur von mir gesprochen, Frau Sharma – erzählen Sie mir doch von sich, aus Ihrem Leben drüben, und wie Sie hier leben!“
Das Leben, das Frau Mamtani ‚drüben’ nennt, sagt Barbara, das wäre für sie so entfernt, wie Kilometer zwischen Indien und Deutschland lägen, obwohl sie noch gar nicht so lange in diesem Lande wären, so dass mit der Zeit die Gesichter der Menschen verblassten, mit denen sie damals in Deutschland zusammen gewesen ist.
Sie ist vorsichtig mit dem, was sie preisgibt, denn Frauen dieses Schlages, die können hartnäckig sein im Nachfragen.
„Und hier in Indien“, hakt Frau Mamtani nach. „Wie leben Sie in diesem sonderbaren Land? – In dieser Stadt? Kolkata ist keine Stadt, es ist ein Monstrum, das frisst und frisst und frisst ... Die Stadt ist wie eine furchtbare Göttin, wie Kali. Ja, damit habe ich die Stadt immer verglichen.“
„Wir leben recht angenehm in dieser Stadt. Weit weg von ihrem fressenden, gierigen Maul“, antwortet Barbara und erzählt, dass sie ein großzügiges Haus in einer ruhigen Gegend bewohnen, weitab vom Trubel der Stadt mit ihrem Gestank und Heidenlärm. Zum Haus gehöre ein weitläufiger Garten mit etlichen uralten Palmen und Bäumen, und sie hätten Personal, wie sie es nie für möglich gehalten hätte; aber hier wäre ja alles bezahlbar, nein billig ...
„Nein, wir fühlen uns wohl, da wo wir wohnen“, sagt sie. „So haben wir es uns immer gewünscht.“
Frau Mamtani nickt zu allem, was Barbara ihr erzählt. Das Personal zu führen, ohne sich direkt verständigen zu können, das stelle sie sich schwer vor, sagt sie. Da sei wohl ständig der Mann gefordert. Ihr sei es nicht anders ergangen, darum wäre sie sogleich daran gegangen, die heimische Sprache zu erlernen. Denn ihr Mann wäre nur gelegentlich verfügbar gewesen.
„Warten Sie mit dem Erlernen der Sprache nicht zu lange, Frau Sharma. Einmal könnte sich beim Personal Schlendrian einschleichen, zum anderen gewöhnt man sich daran, alles dem Mann zu überlassen. Und ob der die Anweisungen gibt, wie Sie es sich wünschen ...“ Sie hebt wissend die Schulter. „Bei uns hat es anfangs damit überhaupt nicht geklappt. Wenn Sie so weit sind – ich weiß einen guten, einen fähigen Lehrer.“
Beim Abschied äußert Frau Mamtani den Wunsch, einmal zu einem Gegenbesuch kommen zu dürfen.
„Ich gestehe, ein wenig neugierig bin ich schon, wie nichtindische Frauen sich in diesem Land, in seiner stark geprägten Gesellschaft einrichten“, gesteht Frau Mamtani.
Barbara streckt ihr die Hand hin und lächelt dazu, nicht zustimmend, sondern so, als wollte sie sich das überlegen.
Im Treppenhaus ist ein junger Bursche dabei, den Müll von Etage zu Etage nach unten zu schmeißen. Als Barbara an ihm vorübergeht, drückt er sich mit gesenktem Kopf wie ein ängstliches Tier ans Geländer.
Von oben hört sie Frau Mamtani rufen: „Ach, erbarmt sich nun endlich jemand des Drecks? Das wurde auch Zeit!“
Etwas oberhalb der Straße wartet Kali im Wagen. Langsam und über das ganze Gesicht lachend öffnet er ihr den Schlag, und während sie heimwärts fahren, erzählt er der Memsabib lebhaft, mal mit dem einen, dann mit dem anderen Arm in der Luft herumfuchtelnd, was er in dem Viertel gesehen und erlebt hat, in dem er einmal wohnte.
Barbara lacht ebenfalls und nickt dazu, als verstünde sie alles. Und das freut Kali sehr.