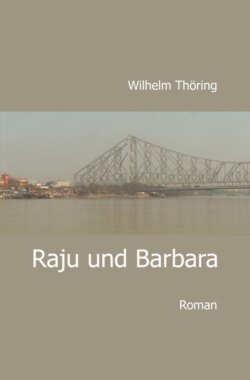Читать книгу Raju und Barbara - Wilhelm Thöring - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеNach diesem Besuch wird Rahul lange nichts mehr von sich hören lassen, so dass Raju ihn wieder auf Reisen vermutet, irgendwo im weiten Indien oder in einem anderen Land.
Der alte Doktor Sharma ist eines Tages ausgegangen, und als er wiederkam, verkündete er, dass er die eitrige Wunde einer Frau behandelt hätte, und weil es weit und breit keinen Arzt gebe, werde er sich hier einen Patientenkreis aufbauen. Die Wunde, die sich quer über das Gesäß der Frau hinzieht, müsste öfter behandelt werden; dazu könne die Frau nicht bis in die Stadt laufen. Hier wäre ein Arzt unerlässlich; auch wenn er alt sei – solche Arbeit könne er durchaus noch tun, sagte er zum Sohn, denn sein ganzes Leben lang hätte er ja nichts anderes gemacht, als die unterschiedlichsten Krankheiten geheilt. In diesem Bereich, wo sie wohnen, da wäre er in die richtige Ecke gekommen. Und ein wenig Geld, das könne er auch gebrauchen.
„Willst du regelmäßig zu den Menschen gehen?“
„Zu ihnen gehen? Der Arzt geht nicht zu den Kranken – die kommen zu ihm!“
„Aber wo willst du sie behandeln, Vater?“
„Hier im Hof.“
Raju verschlägt es die Sprache. Fassungslos hebt er abwehrend die Hände, will etwas entgegnen; und als der alte Mann das bemerkt, blickt er ihn entrüstet und strafend an und lässt ihn stehen, schnippt mit den Fingern gegen die Kübelpflanzen an der Terrasse, und lässt sich wie zum Trotz krachend in einen Sessel fallen.
Hoffentlich kann der Vater den Plan noch eine Weile für sich behalten und posaunt ihn nicht gleich ins Haus hinein, dass Barbara es hört. Unruhig geworden, wandert Raju durch den Garten, ängstlich von Ashim beobachtet, weil der befürchtet, etwas falsch gemacht zu haben. Raju grübelt, wie er den Vater von diesem Einfall mit den Patienten abbringen kann; es darf nicht sein, dass Barbara es durch ihn erfährt, er muss dem Vater zuvorkommen.
Mit einem Buch in der Hand tritt Barbara aus der Tür. Doch weil der Vater, der sich auf der Terrasse niedergelassen hat, es nicht leiden kann, dass eine Frau sich länger mit Büchern beschäftigt, überlegt sie es sich anders und wandert lesend durch die Blumenbeete, bis sie bei Raju ist.
„Wenn der Vater auf der Terrasse sitzt, dann lässt er mich nicht lesen. Sonst spricht er kaum mit mir – dann aber hat er mir allerlei zu erzählen.“
Wenn Raju mit ihr allein ist, sprechen sie Deutsch; ist der Vater bei ihnen, dann wird Englisch gesprochen. Barbara achtet darauf, dass beim Vater nicht der Verdacht aufkommt, er würde ausgeschlossen oder als hätten sie etwas über ihn oder die Mutter zu besprechen. Raju legt seinen Arm um sie und führt sie wie ein Verliebter durch den Garten, so dass der Vater auf der Terrasse darüber die Stirn runzelt, denn ein indischer Mann zeigt für seine Frau keine Gefühle in Gegenwart anderer, es schickt sich nicht; noch weniger schickt es sich, wenn eine Frau ihre Gefühle zeigt; und diese Frau, die der Sohn geheiratet hat, kennt darin überhaupt keine Hemmungen.
„Ja, es ist für dich nicht leicht mit den beiden“, beginnt er. „Ich glaube, sie hätten auch in jungen Jahren nichts zugelassen, was vom Gewohnten abgewichen wäre. Ich frage mich manchmal, wie es für ihn während seiner Studienjahre in London gewesen ist. Er erzählte oft, dass er nicht nur Umgang mit Indern hatte; er ist sogar in englische Familien eingeladen worden und hat sehen können, dass sie anders leben. Und das scheint ihn sogar beeindruckt zu haben, so habe ich ihn damals verstanden. Vielleicht wäre er im Westen auch ein Westler geworden, wie ich einer geworden bin. Aber hier – da ist er ganz schnell wieder zu einem Inder geworden, durch und durch Inder ...“
„Und du?“
Raju lacht auf. „Ja, ich bin Inder, aber in der umgekrempelten Jacke fühle ich mich wohl, sehr wohl, Bärbel.“
Aneinandergelehnt betrachten sie ihr Haus. Wie es zwischen den Palmen und Büschen, den Bäumen und vielen Blumen leuchtet! Barbara versteht, dass die wenigen Freunde Rajus, die bis jetzt hergekommen sind, ihren Besitz nicht nur bewundern, sondern sie auch deswegen beneiden. Und mit Rahul und seiner bequemen, seiner faulen Savita ist es wohl ebenso. Irgendwo in einem südlichen Bezirk Kolkatas haben beide vor nicht langer Zeit eine bescheidene, mehr eine kümmerliche Wohnung bezogen, wie der Vater Raju erzählt hat. Aber so etwas wäre nicht von Bedeutung, sagte er, dafür reisten sie viel und würden sich bilden.
„Es ist doch ein Paradies, in dem wir wohnen, findest du nicht auch, Bärbel?“
Sie sieht ihn von der Seite an und schweigt dazu. Ja, von außen betrachtet, ein Paradies, möchte sie ihm antworten – im Innern aber geht es zu, wie in jedem anderen Haus, da gibt es Fremdheit zwischen den Menschen und Missverständnisse, auch Machtgedanken und offene Reibereien ...
„Ja, der Vater“, beginnt Raju. „Was der nur manchmal für Einfälle hat!“
„Was hat er denn für Einfälle?“
„Er möchte, weil es hier keinen Arzt gibt, wieder Kranke behandeln.“
„Das ist kein schlechter Einfall, Raju. Er ist geistig auf der Höhe, ist rüstig ... Wenn er sich unten bei den Händlern eine kleine, einfache Praxis einrichtet, nur einen Raum, der würde genügen ...“
„Barbara, er will es hier machen!“
„In unserem Haus?“
„Im Hof.“
Sie macht sich aus seiner Umarmung frei, lässt den Kopf sinken. Gegen den Boden spricht sie schließlich: „Hat er dich gefragt?“
„Nein.“
„Und wie denkst du darüber?“
„Ich denke, Barbara, wir müssen es verhindern. So etwas bringt nicht nur Unruhe ins Haus, es bringt auch Ärger. Du weißt, wie einfache Leute sein können: Die öffnen jede Tür, kriechen vor Neugier in jeden Winkel, müssen alles befummeln und stecken auch schon einmal etwas ein!“
Bärbel lässt noch immer den Kopf hängen. Der Vater auf der Terrasse hat sich aufgerichtet, um besser sehen zu können, was die beiden hinter den Büschen machen.
„Wie soll ich das verhindern können?“, fragt sie. „Ich kann das nicht, ich bin nur eine Frau. Hier trifft alle Entscheidungen der Mann. Du musst es verhindern, Raju!“
Jetzt, da es heraus ist, und sie es weiß, fängt Raju an zu schwitzen. Diese Aufgabe muss er übernehmen, er, der jüngere Sohn. – Wie kann er den Vater dazu bringen, von diesem Vorhaben, wie er es sich denkt, abzulassen? Raju wirkt ziemlich hilflos, und leise, beinahe verzagt sagt er:
„Ja, ich muss wohl mit ihm sprechen. Es wird nicht leicht sein, so eigensinnig wie er ist ...“
Wann Raju mit seinem Vater gesprochen hat, weiß Barbara nicht. Sie bemerkt aber, dass der alte Mann noch stiller geworden ist und mit mürrischem, hartem Gesicht herumläuft; und auch das bemerkt sie, dass Vater und Sohn darauf bedacht sind, nicht für längere Zeit allein in einem Raum sein zu müssen. Während der Mahlzeiten unterhält Raju sich nur mit ihr, der Vater schweigt. Ob die Mutter etwas weiß? Die hockt gleichmütig und abwesend dazwischen und ist ebenfalls still. Aber das ist sie ja meistens.
Ja, er hätte noch am selben Tag mit dem Vater gesprochen, sagt Raju später, als Barbara ihn danach fragt. Der habe ruhig zugehört und am Ende gemeint, wenn er in diesem Haus wohne, dann sei es wohl auch sein Haus, in dem er die Freiheit hätte zu tun, was er für richtig erachte.
„Das hat er gesagt, Raju?“
Raju wiegte den Kopf. „Ja, so sieht es der Vater. – Ich habe ihm begreiflich gemacht, dass dieses Haus nicht von mir, sondern von dir gebaut und bezahlt worden ist. Über viele, viele Jahre hätten wir deinen Verdienst dafür gespart.“
„Das hast du ihm auch gesagt?“
„Er muss es wissen, bevor er sich noch andere Verrücktheiten einfallen lässt. Ich hätte ihn früher auf diese Sachlage hinweisen sollen ...“
„Ist er böse geworden?“
„Nicht mit Worten, aber er hat mich angesehen, als wollte er mich mit seinen Blicken vernichten. Er hält mich für einen Waschlappen.“
„Hat er das gesagt?“
„Er hat es mir indirekt durch Rahul sagen lassen, und der hat mir durch die eine oder andere kränkende Bemerkung dasselbe zu verstehen gegeben.“
Es ist Juni geworden und es wird nicht lange mehr dauern, bis der Monsun beginnt. Für Doktor Sharma spielt das Wetter keine Rolle: irgendwo in einem Winkel leiden Menschen und warten darauf, dass ihnen geholfen wird.
Wenn es ihm in den Sinn kam, dann stand er in den letzten Tagen oft vor dem Tor und sprach Leute an, vor allem die herumreisenden Händler; warum er das tat, behielt er für sich.
„Jetzt ist es Zeit, dass ich mich um die Kranken kümmere“, sagt er in die aufgeschlagene Zeitung; er sitzt mit seiner Frau auf der Terrasse und liest, oder er tut nur so und beobachtet, was um ihn herum geschieht. „Mehr als einen Tisch und zwei oder drei Stühle brauche ich nicht. Die kann einer von den Leuten nach draußen vor das Tor tragen. Meine Sprechstunden halte ich nur an zwei Nachmittagen, das genügt.“
Die Mutter hat, während der Vater das sagt, ihre Zeitung zusammengefaltet und ist ins Haus gegangen.
„Als Arzt, der großes Ansehen genoss, willst du dich herabwürdigen und draußen vorm Haus im Straßenstaub wie ein Quacksalber sitzen“, empört sich Raju. „Heruntergekommen wie Schuhflicker, wie Frisöre und primitive Zahnzieher, die an jeder Ecke der Stadt herumlungern?“
„Wenn ihr mir nicht einen besseren Platz gebt, dann behandle ich eben auf der Straße! Dürfen die Leute nicht sehen, dass für meine Arbeit in diesem Haus kein Platz ist?“
„Vater, ich habe versucht, dir klarzumachen, warum wir die Leute nicht im Hof, schon gar nicht am Haus haben wollen. Als du noch praktiziert hast, Vater, da hast du auch niemanden in die Wohnung gelassen. Der Mutter hast du gesagt: Unterstehe dich, jemanden einzulassen, es ist mancher Spitzbube darunter. – Außerdem setzt bald der Monsun ein, da kannst du lange auf deine Patienten warten.“
Barbara, die Pflanzen in Schalen umtopfte, bekam mit, wie Raju dem Vater in Bengali, erregt und heftig geworden, widersprach; jetzt erzählt er ihr von dem Wortwechsel, und Barbara hört zu, als spräche er davon, etwas im Garten zu ändern oder einen Busch umzupflanzen. Ganz bei der Arbeit, die ihre volle Aufmerksamkeit verlangt, lässt sie keine Regung erkennen; ohne eine Bemerkung einzuwerfen, pflanzt Barbara einen kleinen Trieb nach dem anderen in die Schalen und Töpfe und begutachtet sie sehr genau. Aber sie drückt die kleinen Pflänzchen fester in die Erde als nötig. Nach einem langen Schweigen meint sie:
„Raju, der Monsun wird es nicht zulassen, dass er stundenlang vor dem Tor sitzt, und hinterher hat er die ganze Sache vergessen. Er hat uns schon öfter mit den verrücktesten Einfällen überrascht, die er nicht in die Tat umgesetzt hat, weil sie ihm aus dem Gedächtnis gefallen sind. Lassen wir ihn. Du hast ihm gesagt, wie wir darüber denken. Jetzt hat er Zeit, sich alles noch mal durch den Kopf gehen zu lassen.“
„Ja, ich hoffe, dass er noch mal darüber nachdenkt. – Eigensinnig ist er schon immer gewesen, auch in jungen Jahren, erzählt meine Mutter. Er sorgte dafür, dass sie alle möglichen Annehmlichkeiten hatte – aber dafür erwartete er von ihr völlige Selbstaufgabe. Es durfte nur das getan werden, wozu er Ja und Amen gesagt hat.“
Raju zögerte, unschlüssig und wartend lehnte er gegen den Stamm der Kokospalme, er schien noch etwas auf dem Herzen zu haben.
„Er ist heftig geworden, geradezu böse“, fängt Raju an. „Es ärgere ihn, sagte er, dass er in einem Haus leben müsste, das nicht sein Sohn gebaut hat, sondern du, die ausländische Frau. Aber es wäre trotzdem das Haus seines Sohnes, denn ich wäre dein Mann. Und weil er mein Vater ist, wäre das Haus auch sein Haus. Daran ließe sich nichts drehen und biegen. Er ließe sich nicht vorschreiben, was er tun dürfe oder zu lassen hätte. Ich hätte alle alten und bewährten Ordnungen vergessen, wäre im Ausland verdorben worden und ließe allen Respekt ihm, dem Vater gegenüber, fehlen. Mit unserem Haus würden wir etwas vortäuschen, was keiner von uns in seinem Herzen besäße: Wärme und Demut! Es täusche nur Glanz und Würde vor! Er werde die Kranken behandeln, daran könne ihn niemand hindern. Er werde sie auch in den Hof holen ... Er schimpfte geradezu und warf die Tür zu und ließ mich stehen.“
Barbara wischte die Hände an der Schürze ab. „Ach, wie schrecklich! Wird er das wirklich tun, Raju?“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht wird er es versuchen ...“
„Ich habe mein Leben hinter mir, Raju ... Ich bin hergekommen, um es in Ruhe und Frieden beschließen zu können, mit dir, Raju, mit dir! Dass es das eine oder andere Problem geben wird, wenn wir die Eltern zu uns holen, das war vorauszusehen. Aber so etwas ...“
Sie wandte sich plötzlich ihm zu, als hätte sie einen wilden Entschluss gefasst:
„Ich möchte ihn nicht daran erinnern müssen“, stieß sie hervor, „wie wir zu diesem Haus gekommen sind.“
„Ich habe ihn noch einmal daran erinnert, dass das Haus von dir gebaut worden ist, Bärbel, und dass du dein Haus in Deutschland verkauft hast. Dieses Haus gehört dir! – Wie soll der alte starre Mann das begreifen. Er denkt indisch, nicht europäisch ...“
Doktor Sharma hat nicht mehr von seinen Absichten gesprochen. Hatte er sie jetzt schon vergessen? – Als endlich der Monsun kam, saß er lange Zeit auf der Terrasse und betrachtete den sich verändernden Himmel, genoss die Schauer und freute sich, dass sie von allem den Staub wuschen.
Nein, das, was er sich vorgenommen hatte, das war dem alten Doktor Sharma nicht aus dem Gedächtnis gefallen. Gegen Ende eines angenehmen Tages musste Ashim ein kleines Tischchen und zwei Stühle auf die Straße tragen. Da saß Doktor Sharma, seinen Arztkoffer neben sich auf dem zweiten Stuhl und sah zu, wie Ashim eine Papptafel gleich neben das Eisentor an die Mauer nagelte, auf die Doktor Sharma in englischer Sprache mit großen fetten Buchstaben geschrieben hatte:
Doktor Sharma, Arzt für alle Krankheiten,
Behandlung hier
Die Leute, die vorübergingen, blieben stehen und rätselten, was das zu bedeuten hat, denn das Schild konnten sie nicht lesen.
„Geh, hole mir noch einen Karton“, befahl Doktor Sharma dem Ashim. „Ich muss das auch in Bengali und Hindi schreiben, damit die wenigen Tölpel, die in die Schule gegangen sind, es lesen können.“
Ashim gehorchte, und sein Schild betrachtend sagte Doktor Sharma sich: „Aber das englische Schild muss bleiben! Es verrät, dass ich ein richtiger, ein ordentlicher und gebildeter Arzt bin! Die fremden Schriftzeichen haben für die Leute etwas Geheimnisvolles, sie fordern Respekt!“
Wenn die Straßenhändler die Schilder sehen, dann werden sie sich an den alten Doktor erinnern und die Leute, die einen Kranken im Haus haben, darauf aufmerksam machen.