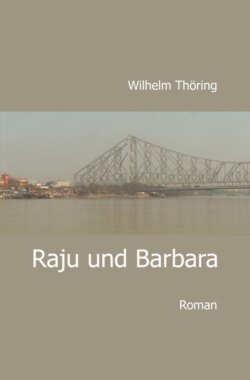Читать книгу Raju und Barbara - Wilhelm Thöring - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление„Raju, du musst der Ninu erklären, was sie tun soll!“
Barbara steckt sich die Haare fest, die sie nervös machen, weil sie ihr immerzu ins Gesicht fallen. Sich mit beiden Armen auf die Tischplatte stützend, lacht Ninu sie an und bewegt die Lippen, als könnte sie nicht sagen, was sie loswerden möchte.
„Was soll sie denn tun“, fragt Raju vom oberen Treppenabsatz, wo er in ihrem eigenen Bad Spiegel und Konsolen anbringt. Die Bohrmaschine noch in der Hand, voll weißen Staubs, kommt er herunter, setzt sich auf die vorletzte Stufe und schüttelt den Kopf über Barbaras festgeklemmte Haare.
„Du siehst fremd aus“, sagt er. „Die Frisur steht dir nicht!“
„Sie soll zuerst die Gläser spülen, danach das Geschirr, zuletzt Besteck, Töpfe, die Pfannen ...“
Raju erklärt Ninu, was die Memsabib, die Hausfrau, von ihr erwartet. Aufmerksam, ihre dunklen Augen weit aufgerissen, hört Ninu zu, dann wendet sie ein, es wäre alles sauber, denn alles hätte in Papier gepackt in den Kisten gelegen, nichts von dem, was sie abwaschen soll, wäre benutzt worden. Und um Raju zu überzeugen, hält sie ihm eine Tasse hin. Aber weil das von ihr verlangt wird, füllt sie die Schüssel mit kaltem Wasser und macht sich an die Arbeit; und wieder muss Raju ihr erklären, dass weiße Frauen zum Abwasch heißes Wasser nehmen, dazu ein Reinigungsmittel, keinen Sand. Ninu tut, was man von ihr erwartet, aber es ist ihr anzusehen, dass sie sich darüber sehr wundert und nichts begreifen kann.
„Bärbel, es wird sich nicht umgehen lassen, dass du auch noch Bengali lernst ...“
„Ja, das habe ich mir vorgenommen, aber alle diese sonderbaren Schriftzeichen – das lerne ich nie!“ ruft sie entsetzt und schlägt auf die Zeitung, die Raju mitgebracht hat. „Für so etwas bin ich schon zu alt!“
„Nicht die Schriftzeichen, Bärbel, es reicht, wenn du etwas Bengali verstehen und sprechen kannst! Und davon nur das, was im Alltag gebraucht wird.“
Ja, das will sie versuchen, sagt sie, denn es wäre zu lästig, ihn immer als Dolmetscher an der Seite haben zu müssen.
Der Tag geht zu Ende; sie sitzen auf der Terrasse, wo sie vorerst die Korbmöbel hingestellt haben, die für das elterliche Wohnzimmer vorgesehen sind. Raju will die getane Arbeit in diesem Haus mit einem Whisky feiern, Barbara hält ein Glas Limonensaft zwischen den Händen. Beide schweigen, sie hängen ihren Gedanken nach. Im Nu ist es dunkel geworden; wie ein Boot taucht der Mond zwischen den Bäumen auf. Jenseits ihrer Gartenmauer wird es lebhaft auf der Straße. Manchmal knattert ein Moped vorüber. Hinter dem Eisentor bleiben Menschen stehen, sie rufen, sie versuchen es zu öffnen, und weil sich nichts rührt, gehen sie weiter.
„Ja, hat der Mensch noch Töne“, fährt Raju in die Höhe und rennt mit der Taschenlampe und dem Besen durch den Garten auf die nördliche Mauerseite zu. Er beleuchtet zwei Jugendliche, die von der oberen Kante einen dicken langen Bambusstab in den Garten herabgelassen haben, an dem sie herunterzugleiten versuchen. Raju schimpft und droht ihnen mit dem Besen, und die Jungen nehmen lachend Reißaus und lassen den Bambusstab, wo er ist.
Am anderen Tag ist Raju auf Barbaras Drängen mit einer Taxe ins Zentrum gefahren, um sich in einer Tierhandlung nach einem Wachhund umzusehen. Papageien, die hätte er bekommen können, und alle möglichen Vögel, große und kleine, Zierfische, niedliche Kätzchen und Schoßhündchen, doch einen Wachhund, der ihm ungebetene Gäste fernhalten könnte, den fand er nicht. Ihm wurde die Adresse eines Niederländers genannt, der würde große, wachsame und scharfe Hunde züchten. Raju ließ sich zu ihm fahren, und hier fand er, wonach er suchte: Deutsche Schäferhunde, Dobermänner, zwei gefleckte Doggen und eine Riesenschnauzerhündin, die ihre kaninchengroßen herumtapsenden Jungen in der Wurfkiste bewachte. Schnauzer, ja, das wären verlässliche und wachsame und verteidigungsbereite Hunde, wurde Raju versichert, doch als Wach- und Schutzhund wäre der Riesenschnauzer mit keinem anderen zu vergleichen. Er könne sich unter den Jungen jetzt schon einen aussuchen, der würde mit einem farbigen Band gekennzeichnet, und in acht Wochen, wenn sie entwöhnt sind und der Mutter lästig werden, dann gehöre der Hund ihm.
Von dem Tag an, da die Jugendlichen versuchten, in seinen Garten zu steigen, sieht Raju an jedem Abend nach, ob hinter der Mauer Bambusstangen liegen oder gar eine Leiter.
Schon an einem der nächsten Tage sind sie zu einem Hund gekommen – einem Hund, wie sie keinen haben wollten: Raju verhandelte vor dem Tor mit einem Mangohändler. Der Mann zeigte sich nicht ehrerbietig und nannte einen unverschämten Preis, er hielt Raju wohl für einen Angestellten des vornehmen Hauses. Das änderte sich, als Barbara, die weiße blonde Frau erschien. Für die Memsabib wäre diese Frucht gerade richtig, sagte der Händler und bot eine große, reife Frucht zu einem annehmbaren Preis an.
Während Raju noch verhandelte, verteidigte auf der anderen Straßenseite einer der hier üblichen vielen Straßenköter, ein rötlichbraunes Tier, seinen ergatterten Bissen vor einem anderen. Mit eingekniffenem Schwanz und fletschenden Zähnen starrte er den Rivalen an und bemerkte nicht das Auto, das einem vorüber ziehenden Ochsenkarren ausweichen musste. Ein Aufjaulen, ein nicht enden wollendes Winseln – das Auto hatte ihn an der linken hinteren Flanke erwischt. Der Hund versuchte seine verletzte Stelle zu lecken, während der andere sich mit dem Bissen davonmachte.
Barbara lief hinüber. Zuerst sprach sie auf den Hund ein, der blickte zu ihr auf, duckte sich, als erwarte er Schläge, ließ sich von ihr streicheln und wurde ruhig und leckte einige Male über ihre Hand; und als sie ging, folgte er ihr, den Körper nachschleifend, hinter das Tor. Barbara holte eine Schale Milch, kauerte sich zu ihm und begann, während er die Milch schlabberte, auf ihn einzureden.
„Den werden wir nicht mehr los“, sagte Raju und gab Ninu, die aus dem Haus gekommen war, die Mangos, die sie zubereiten solle. „Wenn er wieder gesund ist, dann werde ich mit ihm weit von hier wegfahren und ihn freilassen.“
Barbara, die nie ein Tier um sich hatte, schwieg dazu. Sie untersuchte die Verletzung, und der Hund ließ es zu und leckte ihr wieder die Hände. Zu sehen war nichts, aber das Tier hinkte, es konnte mit der linken Hinterpfote nicht auftreten.
„So lange du magst, darfst du bei uns bleiben“, flüsterte sie dicht über dem Tier, dass sie es mit ihren Haaren berührte. „Wenn du erst einmal bei uns bleibst, dann brauchst du einen Namen, du kleiner Pechvogel. Zuerst werde ich dich von deinen Flöhen befreien, und dann wollen wir sehen, ob du erzogen werden musst ... Und wenn dein größerer Kumpan kommt, den wir schon gekauft haben, dann ... Na, wir werden sehen.“
Ninu hat einen Tisch in den Garten tragen müssen, der mit einem Plastiktuch abgedeckt wurde. Auf dem Tisch liegt der Hund ohne Namen und erwartet, was mit ihm gemacht wird: Barbara sieht zuerst nach der Verletzung, dann sucht sie sein Fell nach Zecken und Flöhen ab, und zuletzt wird er gründlich eingepudert. Und das mag er überhaupt nicht. Er niest und prustet und würde vom Tisch springen, wenn er alle vier Pfoten gebrauchen könnte.
Das Haus ist seit etlichen Tagen schon ganz nach Barbaras Vorstellungen eingerichtet. Bilder und Spiegel, Zierrat und Blumenvasen sind da, wo sie sie hinhaben wollte. Sein Inneres spiegelt die Atmosphäre eines deutschen Hauses. Dieses jedoch ist großzügiger, geräumiger und eindrucksvoller, so dass kein Inder es wagen würde, unbefangen hineinzugehen. Auch Ninu wagte sich das erste Mal nicht so ohne weiteres hinein – sie trat vorsichtig auf, sah sich um, blickte hierhin und dorthin, als könnte sie plötzlich von etwas Gefährlichem angesprungen werden. Ihre Scheu war aber bald verflogen, und jetzt bewegt sie sich in allen Räumen ebenso sicher wie die Memsabib, die Hausfrau.
Heute Morgen ist Raju sehr zeitig mit der Taxe in die Stadt gefahren. Er hat sehr geheimnisvoll getan und nahm, obwohl Ninu zusah, Barbaras Gesicht zwischen seine Hände und küsste sie. Das hat er in Deutschland zu vermeiden gewusst, hier in Indien, noch dazu in Gegenwart der Haushilfe, ist das gegen jede Sitte. Aber Raju hat es getan! Entsetzt wandte Ninu sich ab; als sie jedoch allein war, hat sie laut zu lachen angefangen. Gegen Mittag ist sie nach Hause gegangen, und als sie die Memsabib sah, da brach sie wieder in Gelächter aus.
Barbara ist durch den Garten gegangen, hat verwelkte Blüten entfernt und hier und da den Pflanzen etwas Wasser gegeben. Den Garten möchte sie auch noch verändern. Vielleicht ist Raju zu erweichen, einen Teich anzulegen. Und an ganz bestimmten Stellen möchte sie Blumen haben, auch solche, die in Deutschland in ihrem Garten wuchsen. Mit einem Buch, das über Gewächse und Gartenarbeit informiert, sitzt sie jetzt auf der Terrasse. Dicht an sie geschmiegt liegt der hinkende, rotbraune Hund ohne Namen. Seit jenem Tag, an dem er angefahren wurde, weicht er nicht von ihrer Seite. Ins Haus jedoch wagt er sich nicht. Er bleibt im Garten, auch des Nachts. Dann liegt er dicht vor der Terrassentür. Er ist gelehrig und wachsam, der sofort meldet, wenn jemand der Mauer oder dem Tor zu nahe kommt. Beide fragen sich aber, ob er sie auch verteidigen und angreifen würde.
Barbara wird mit Raju besprechen, ob das Klima hier für Blumen aus Deutschland geeignet ist, ob sie hier gedeihen? Es müssen Knollen oder Samen sein, denen eine lange Reise nichts anhaben kann. Und wenn er einverstanden ist, wird sie eine Liste anfertigen und ihren Bruder Reinhold in Deutschland bitten, ihr alles, was möglich ist, nach Indien zu schicken.
Am Tor hält ein Auto. Der Hund ohne Namen reckt sich, er spitzt die Ohren und unterdrückt ein Bellen: Es ist Rajus Stimme, Rajus Schritt, den er hört. Sich die Hände reibend kommt Raju auf die Terrasse zugestürmt. Wieder nimmt er ihr Gesicht in die Hände und drückt seine Lippen auf ihre Stirn.
„Morgen musst du mit mir in die Stadt fahren, Bärbel. Ich kann mich ohne dich nicht entscheiden.“
„Wozu musst du dich entscheiden?“
Er legt ihr einen Finger auf den Mund. „Nicht fragen, sich einfach überraschen lassen ...“
Raju fällt in einen Sessel, in dem er es aber nicht aushält. Unruhig und voller Spannung läuft er die Terrasse in ihrer ganzen Größe ab, dass der Hund vor ihm in den Garten flüchtet. Er nimmt das Gartenbuch, schlägt es aber nicht auf; er besieht abwesend die zum Kreis eines Jahres angeordneten Blumen auf dem Deckel, dann legt er es gleich wieder auf den Tisch.
„Wenn du so etwas liest, Bärbel, dann hast du auch etwas vor“, sagt er nach einer Weile. „Willst du hier in Indien den Landschaftsgärtner spielen?“
Was sie ihm darauf antwortet, hört er nicht. Raju muss sich bewegen, er muss laufen, als müsse er sich von irgendeinem Druck befreien.
Barbara ist in der Küche, sie kocht Tee; jetzt ist Raju in den Garten gegangen, und der Hund winselt vor der Tür, weil er sich vor dem unruhigen Mann ängstigt. Sie wird nicht weiter in ihn dringen – sie kennt ihn und hat es gelernt, zu warten. Morgen wird er ihr offenbaren, welches Geheimnis ihn so sehr in Unruhe versetzt hat.
Vor dem Dunkelwerden hat Raju am nächsten Tag eine Taxe kommen lassen, die beide ins Zentrum fahren musste, direkt vor das Haus eines Autohändlers. Dass das Geheimnis ein Auto sein wird, das hat sie vermutet. Denn ohne Wagen ist das Zentrum Kolkatas von ihrem Wohnort so weit entfernt, wie Indien von Deutschland, oder der Mond von der Erde, hat er einmal geäußert. Ohne Auto würde das Leben für sie sehr, sehr schwierig sein.
Unterwürfig, die Hände an der Hose abreibend, läuft ein Verkäufer herbei, der sich vor Barbara verneigt und Raju wie einen Bekannten begrüßt. Zielsicher geht Raju auf einen japanischen Geländewagen zu. Raju lehnt sich dagegen und sagt, fast ein wenig enttäuscht:
„Bärbel, du sagst gar nichts dazu!“
„Ich habe geahnt, was du im Schilde führst.“
„Ach ja, deine scharfen, sensiblen Sinne ... Wie findest du den Wagen? Im Preis ist er äußerst günstig, denn das ist ein Vorführwagen. Bärbel ...“
„Raju, ist er nicht ein bisschen groß? Wir sind nur zwei Personen ...“
„Noch sind wir zu zweit. Aber wenn die Eltern bei uns wohnen – wir werden sie doch auf die eine oder andere Tour mitnehmen. Und dann sind da noch die beiden Hunde.“
Als sie in der Taxe nach Hause fahren, ist Barbara sehr still. Mit dem Autokauf war sie sofort einverstanden; aber es reißt ein großes Loch in das, was ihnen von ihrem Ersparten geblieben ist; wiederum hat Raju recht: Ohne Wagen geht es hier nicht.
Raju, der vorne neben dem Fahrer sitzt, dreht sich besorgt nach ihr um. „Was bedrückt dich, Bärbel?“
„Der Verkehr. An solches Gewühl bist du nicht gewöhnt, Raju. Ich werde immer in Sorge sein, wenn du mit dem Wagen in die Stadt fährst. Diese Gelassenheit“, sie nickt zum Fahrer hin, „die hast du wohl nie besessen. Und wenn – dann hast du sie in Europa verloren.“
Raju lacht. „Auch das wird sich lösen lassen.“