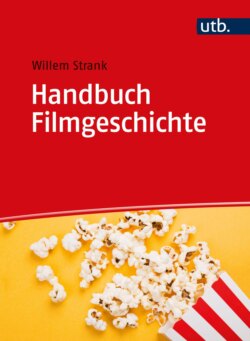Читать книгу Handbuch Filmgeschichte - Willem Strank - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1900er: Deutschland
ОглавлениеUm den Aufbau der Filmindustrie in Deutschland nachvollziehen zu können, müssen wir noch einmal kurz ins späte 19. Jahrhundert zurückreisen. Am 15. Juni 1896 entwickelt Oskar Messter (1866–1943) seinen ersten Filmprojektor und beginnt damit etwa ein Jahr nach den Brüdern Skladanowsky mit dem Filmdreh. Im Jahr 1900 gründet er dann die Projection GmbH, die er 1902 in Messters Projection GmbH umbenennt. Diese ist deshalb historisch relevant, da sie eine frühe Vorläuferfirma der späteren Ufa ist, deren Gründung ebenfalls unter anderem von Messter verantwortet werden wird. Messter ist jedoch auch im inhaltlichen Bereich sehr umtriebig und entwickelt etliche Trick- und Filmtechniken, die er sich minutiös patentieren lässt, z. B. die Praxis der Aufnahme von einem fahrenden Zug aus. Messter sorgt 1903 außerdem für den Anfang der Filmkarriere Carl Froelichs, der für die Projection GmbH als Kameramann von Dokumentarfilmen tätig wird. Froelich wird später nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt werden, da er neben Veit Harlan eine der zentralen Regiepersönlichkeiten des Spielfilms in der Nazizeit sein wird.
Zunächst produziert Messter kleinere „Aktualitäten“, ehe er 1897 auch erste kleine fiktionale Formate realisiert. Am 4. Mai 1897 wird von ihm die erste Großaufnahme des amtierenden Kaisers Wilhelm II. gefilmt, was eine weitere Distanzverminderung darstellt, da hierdurch eine nur zu offiziellen Anlässen aus der Ferne sichtbare Persönlichkeit für ein breiteres Publikum auf reproduzierbare Weise nahbar gemacht wird. Wilhelm II. versteht es schon früh das neue Medium für sich zu nutzen, indem er seit 1895 für etliche Nachrichtenfilme – z. B. bei der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals – zur Verfügung steht und sich damit als tatkräftiger, präsenter Herrscher inszeniert.
Auch der Boom von aktuellen Tagesereignissen auf Film basiert auf dieser Reduktion von Distanzen: Plötzlich kann das Publikum mit nur leichter Verspätung an den wichtigen Ereignissen der Zeit visuell teilhaben. Filme wie Die Kaiserflottenparade von Helgoland (1904) oder Sprengung eines Fabrikschornsteins (1908) sind typisch für diese frühe Phase des deutschen Films. Bemerkenswert ist mitunter die kurze Produktions- und Redaktionszeit, welche eine große Nähe dieser Aktualitäten zur zeitgenössischen Presse suggeriert. Beispielsweise wird bereits acht Tage nach der berühmten Scharade eines einfachen Bürgers, der sich am 16. Oktober 1906 als „Hauptmann von Köpenick“ ausgibt und mit dieser Amtsanmaßung die preußische Liebe zur strengen Hierarchie ad absurdum führt, eine Dokumentation darüber gedreht, was bis dahin als sehr geringe Verzögerung gilt. Das Hannoversche Tageblatt vom 24. Oktober 1906 trägt diesem Umstand Rechnung: „Der falsche Hauptmann von Köpenick gab gestern in unserer Stadt eine Gastrolle. […] Während sich die Droschke nach rechts wandte, wandte er sich nach links und war wieder verschwunden. Aber nicht schnell genug, um nicht auf die Platte gebannt zu sein. Denn fürsorglich hatte man einen Apparat zur Aufnahme kinematographischer Bilder aufgestellt, und [Produzent Carl] Buderus waltete seines Amtes, um die ganze Sache getreulich festzuhalten.“ (zit. nach Jacobsen 2004, 26)
1908 wird erstmals ein Unglück live gefilmt, was mit Blick auf unsere heutige Nachrichtenkultur eine traurige Pionierleistung darstellt: Die Berliner Hochbahnkatastrophe wird von Carl Froelich und Oskar Messter auf Film gebracht, die zu jenem Zeitpunkt bereits ein eingespieltes Team sind.
Eine weitere große Innovation Oskar Messters sind die sogenannten Tonbilder, die er seit dem 29. August 1903 in Berlin aufführen lässt. Der dafür entwickelte Biophon, ein Kofferwort aus Bioscop und Grammophon, synchronisiert die beiden erwähnten Geräte miteinander und produziert somit eine sehr frühe Form des Tonfilms. Eines der wenigen erhaltenen Tonbilder ist das Rauschlied aus der Operette Künstlerblut von 1906, das Alexander Girardi in Wien einsingt. Der Film ist von Oskar Messter und der Ton von der Gramophone Concert Record. Neben bereits etablierten Operetten-Stars beginnt mit den Tonbildern der Aufstieg von Henny Porten (1890–1960), die später noch eine bemerkenswerte Spielfilmkarriere haben wird. Die Tonbilder sind aufgrund ihrer technischen Limitiertheit stets sehr kurz und bleiben ein Trend der 1900er-Jahre – am Ende der Dekade sind sie wieder vom Markt verschwunden und der Tonfilm kehrt erst zwölf Jahre später auf die Leinwände in Deutschland zurück.
Der größte Konkurrent Messters zu jener Zeit ist Alfred Duske, der seit 1905 seine eigene Firma betreibt. Duske feiert große Erfolge mit den Komikerfilmen um Martin Bendix, der als „der Urkomische“ stets die Hauptrolle bekleidet. Er produziert ebenfalls eine große Zahl an Tonbildern. Die seit 1898 existierenden Firmen Deutsche Mutoskop- und Biograph GmbH und Deutsche Bioscop-GmbH, die nach ihren anfangs verwendeten US-amerikanischen bzw. deutschen Patenten benannt sind, sind ebenfalls zwei in der Branche allgegenwärtige Produktionshäuser. Die Bioscop landet ihren größten Coup jedoch 1911, als sie nach dem Welterfolg von Afgrunden (Abgründe) Urban Gad und Asta Nielsen nach Deutschland holt und sie zu großen Stars der deutschen Filmindustrie aufbaut.
Wie in anderen Ländern auch findet der Film in den 1900er-Jahren auch in Deutschland seine Heimat in eigens für ihn errichteten Lichtspielhäusern. Gibt es in Berlin 1905 noch 16 Kinos, sind es 1907 bereits 139. Wiederum zwei Jahre später gründet sich 1909 der „Zweckverband der Theaterbesitzer“, um eine ständige Vertretung des neuen Berufszweigs zu gewährleisten. Da die Branche allmählich sehr lukrativ ist, wird von Staatsseite 1910 die Einführung einer „Lustbarkeitssteuer“ überlegt, die das Kino in eine erste Krise zu stürzen droht. Der Trend wird dadurch jedoch nicht gebrochen: Am 3. September 1910 wird am Nollendorfplatz im „Mozartsaal“ des Neuen Schauspielhauses der erste Kinopalast eingeweiht, der 925 Besucher:innen Platz bietet. Die selbstbewusste Integration des Films zwischen Kunstmusik (Mozartsaal) und Theater (Schauspielhaus) ist symptomatisch für jene Zeit. Bereits seit 1906 existieren jedoch – beispielsweise mit Union-Theater (bekannt als U.T.) – ebenfalls erste Kinoketten wie heute Cinemaxx oder Cinestar: Das ist keineswegs eine neumodische Entwicklung. Bis 1913 wird die Zahl der Kinos in Berlin auf 206 steigen. Allerdings sind weit über 80 Prozent der gezeigten Filme Importprodukte – noch 1914 werden nur zwölf Prozent der Filme in Deutschland produziert.
Auf diese oft als Findungsphase des deutschen Films skizzierten 1900er-Jahre folgt ein oft als Jahre des Umbruchs skizziertes Jahrzehnt. Ein Problem dieser Darstellung ist, dass es aufgrund der wenigen vorhandenen Filme aus jener Zeit äußerst schwierig ist, im Rückblick ein zusammenhängendes Bild der frühen deutschen Filmproduktion zu zeichnen. Ein wichtiger Faktor bei der retrospektiven Unterteilung in eine vorläufige und eine eigentliche Phase des deutschen Films, wie sie von Tom Gunning für den US-Film 1986 ( 1890er-Jahre) heftig kritisiert werden wird, ist sicherlich der Beginn des deutschen „Kunstfilms“ im Jahre 1910 mit Peter Ostermayrs Die Wahrheit, der mindestens ebenso sehr wie der Ausbau des Mozartsaals zum Kinopalast vom neuen Selbstbewusstsein des deutschen Kinos um die Jahrzehntwende hin zu den 1910er-Jahren zeugt.