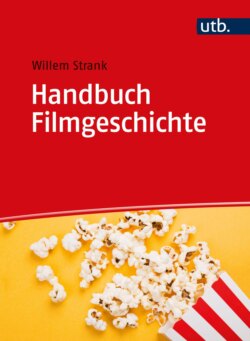Читать книгу Handbuch Filmgeschichte - Willem Strank - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1910er: Deutschland
ОглавлениеWährend der Film in den USA als Unterhaltungsmedium angekommen ist, hat er in Deutschland Anfang der 1910er-Jahre noch immer große Probleme mit mangelnder Anerkennung. Immer noch wird er von vielen Seiten als triviale Alternative zum Theater wahrgenommen, die besonders verhasst ist, weil sie den altehrwürdigen Kunstformen Konkurrenz bereitet. Diese Stimmungslage kulminiert im Mai 1912 in dem Boykott von Kinos durch die Theaterschaffenden. Bereits einige Monate später lässt sich jedoch ein Umschwung feststellen: Die Theaterschaffenden integrieren sich nunmehr sukzessive in die Filmindustrie und werden als Drehbuchautor:innen, Schauspieler:innen und Regisseur:innen reihenweise angeworben.
Das deutsche Starsystem dreht sich anfangs um seinen dänischen Import Asta Nielsen. 1911 drehen sie und ihr Ehemann Urban Gad ihren ersten Film in Deutschland, Heißes Blut. Eine zeitgenössische Rezension in der Zeitschrift deutscher Lichtbildtheater-Besitzer bemerkt überschwänglich: „Es ist schon viel darüber geschrieben, daß dramatische Films für das Lichtbild nicht am Platze wären. Heißes Blut beweist das Gegenteil, namentlich dann, wenn eine Künstlerin wie Asta Nielsen die Trägerin der Hauptrolle ist. Die Handlung ist überwältigend“ (zit. nach Jacobsen 2004, 26), und bezieht sich damit direkt auf die schwelende Diskussion um das Kino als Stätte des Kultur- und Sittenverfalls. Am 12. Februar 1912 wird das neue deutsche High-End-Studio mit 300 Quadratmetern Atelier, Außengelände mit Zirkusrund und arabisch-orientalischer Straße in Babelsberg eingeweiht, als die Dreharbeiten für den neuen Film mit Asta Nielsen, Der Totentanz, beginnen.
Um 1912 werden eine Zeit lang historische Filme der Mutoskop- und Biograph GmbH populär; so erscheint in jenem Jahr z. B. Paul von Woringens Theodor Körner über einen Dichter, der am Freiheitskrieg gegen Napoleon teilnimmt. Von Woringen bringt dadurch die Ideologeme von Kunst und Nationalismus argumentativ zusammen, was im Nachhinein am Vorabend des Ersten Weltkriegs wie eine Ankündigung erscheint. Franz Porten dreht im selben Jahr den Zweiteiler Film von der Königin Luise. Mehrteiler und Historiendramen bleiben bis heute beliebte ‚deutsche Genres‘. Ebenfalls im Jahre 1912 dreht auch Harry Piel (1892–1963) seinen ersten Film für die Deutsche Vitascope, Schwarzes Blut. Piel macht fast alles – zumindest aber Drehbuch, Regie und Produktion – in Personalunion. In dem Dreißigminüter geht es um einen Asiaten, der nach Deutschland reist, um sich für etwas noch Unbekanntes zu rächen. Piel hat später eine sehr wechselhafte Karriere als Regisseur und Schauspieler und wird sowohl mit der Dietrich als auch für die Nationalsozialisten arbeiten.
Die Rolle der Frau in der Filmindustrie wird insbesondere innerfilmisch verhandelt: Asta Nielsens Figur in Urban Gads Die Sünden der Väter (1912) wird nicht nur als „Film über eine Frau und ihre Geschichte, sondern auch [als] ein Film über die Rolle der Frau innerhalb der ästhetischen Produktion“ begriffen. „Asta Nielsen spielt ein Malermodell, das am Ende das Bild zerstört, das der Mann von ihr malte“, bringt Heide Schlüpmann die Handlung auf den Punkt (Schlüpmann 2004, 520). Senta Eichstaedt bekommt als Detektivin in der „Nobody-Serie“ von 1913 die Rolle einer arbeitenden, mobilen Frau zugeschrieben, die zudem über häufige point of view shots durch ein Fernglas immer wieder die Blickmacht über die Situation erhält. Auch wenn die Position der Drehbuchautorin nicht unüblich ist, kommen hingegen auf 80 bekannte Regisseure der 1910er-Jahre etwa zwei Regisseurinnen. Aus heutiger Sicht am bekanntesten sind darunter wohl Rosa Porten (1884–1972) und Hanna Henning (1884–1925). Rosa Porten ist die ältere Schwester von Henny Porten; Rosas Drehbuch zu ihrem ersten Film Das Liebesglück der Blinden (1911) verhilft Henny zum Starstatus. 1918 dreht sie in dreifacher Funktion als Regisseurin, Drehbuchautorin und Kamerafrau Erste Liebe. Porten muss sich aufgrund der sexistischen Vorbehalte der Gesellschaft gegenüber Filmemacherinnen ihren credit oft mit ihrem Ehemann Franz Eckstein teilen; Drehbücher schreibt sie aus denselben Gründen häufig unter dem Pseudonym Dr. R. Portegg. Hanna Henning arbeitet ab 1911 für eine kleine Produktionsfirma namens Bubi-Film und gründet 1915 die Hanna-Henning-Film; 1917 werden beide zu Bubi-Film Henning & Co. fusioniert. Ihre bekanntesten Filme sind Unverstanden (1915), Im Banne des Schweigens (1916) und Mutter (1917); ihr Œuvre ist wechselweise nicht überliefert oder versauert in Archiven.
Nach dem Bruch und der Versöhnung mit dem Theater und der Etablierung ernsthafterer Stoffe im Jahre 1912 wird 1913 das Jahr des „Deutschen Autorenfilms“, was nicht zu verwechseln ist mit deutlich späteren Begriffen wie demjenigen der Auteur-Theorie. Autorenfilme sind Adaptionen von literarischen Vorlagen und weisen Drehbücher von wohlbeleumundeten Theaterschriftsteller:innen auf. So z. B. Der Andere (1913) von Max Mack, eine Art Jeckyll-und-Hyde-Geschichte, deren Drehbuch eine Vorlage von Paul Lindau adaptiert. Für Die Landstraße aus demselben Jahr (1913) schreibt Lindau gar selbst das Drehbuch. In dem Film von Paul von Woringen geht es um einen fälschlich des Mordes verdächtigten Protagonisten, dessen Unschuld erst durch das Totenbettgeständnis des Mörders am Ende des Films bewiesen werden kann. Mit Abstand am bekanntesten wird Stellan Ryes Der Student von Prag (1913) mit einem Drehbuch von Hanns Heinz Ewers. Inhaltlich scheint der Film bereits auf den deutschen Expressionismus der 1920er-Jahre vorauszudeuten; es geht um einen Teufelspakt, im Zuge dessen ein Student für Reichtum sein Spiegelbild verkauft. Der deutsche Autorenfilm ist eine extrem kurzlebige Bewegung und 1914 im Prinzip schon wieder vorbei.
Die Etablierung des Starsystems ist jedoch für die Industrie gleichbedeutend mit einem großen Aufschwung um 1914. Asta Nielsen erfreut sich weiter ungebrochener Popularität und Henny Porten (1890–1960) beginnt zu jener Zeit ebenfalls wie erwähnt ihre illustre Karriere. Paul Wegener (1874–1948) beginnt sein Konzept der „kinetische(n) Lyrik“ umzusetzen und bringt dafür Natur und Technik, Realität und Phantastik dialektisch zusammen – Beispiele dafür sind Der Golem (1914) oder Rübezahls Hochzeit (1916). Ernst Lubitsch (1892–1947) etabliert sich derweil als Meister der grotesken Komödie und entwickelt das sogenannte „Filmlustspie“-Genre. Diese Komödien mit anarchischem Einschlag haben in Deutschland wenig später schon keinen Platz mehr, beeinflussen aber das britische und amerikanische Kino, insbesondere nach Lubitschs Emigration. Lubitschs Filmkarriere beginnt damit, dass er als Varieté-Komiker in Filmen die Hauptrollen übernimmt, im weitesten Sinne wie eine Art deutscher Chaplin. Seinen Durchbruch markiert die Premiere des Riesenerfolges Die Firma heiratet: Drei Kapitel aus dem Leben einer Probiermamsell am 21. Januar 1914 (unter der Regie von Carl Wilhelm), der so ein riesiger populärer Erfolg wird, dass noch im selben Jahr, am 30. Juli 1914, das Sequel Der Stolz der Firma: Die Geschichte eines Lehrlings, ebenfalls im Gespann Wilhelm/Lubitsch realisiert, in die Kinos kommt. Lubitsch wird bald auch als Regisseur tätig. Er filmt 1916 sein Regiedebüt Schuhpalast Pinkus (manchmal wird ihm auch Fräulein Seifenschaum von 1914 zugeschrieben) und produziert bereits am Ende der Dekade eine ganze Reihe seiner späteren Klassiker wie Die Austernprinzessin (1919).
Der deutsche Krimi etabliert sich – oft in Serienform – ebenfalls zu jener Zeit und ist in den Zehnerjahren bereits sehr erfolgreich. Oft haben die Regisseure stilisierte englische Künstlernamen und die Detektive heißen z. B. Stuart Webbs, was die anfängliche Anknüpfung an die angelsächsische Tradition untermalt. Sie sind fast allesamt Großstadtgeschichten und damit Vorläufer anderer urbaner Filmgenres, die sich besonders in den 1920er-Jahren etablieren.
Auch in Deutschland findet der Film in den 1910er-Jahren eine verbindliche Sprache, die dem internationalen Continuity-Stil sehr ähnlich ist. Besonders Kameramann Emil Schünemann versucht sich an einer größeren Beweglichkeit der Kamera und beginnt damit eine Bewegung, die 1924 in Murnaus Der letzte Mann mit seiner sogenannten „entfesselten Kamera“ kulminieren wird. Und auch die Filmlänge wächst im Gleichschritt mit dem internationalen Standard an: Zwischen 1911 und 1914 entwickeln sich auch in Deutschland die abendfüllenden Mehrakter oder: Spielfilme. Die allmähliche Etablierung des Films löst zugleich den Beginn der Filmkritik und -publizistik in Deutschland aus; der Autorenfilmer Max Mack z. B. veröffentlicht 1916 sein berühmtes Filmbuch Die zappelnde Leinwand.
Mit Kriegsbeginn nehmen die Importe von Filmen aufgrund von punktuellen Verboten ab, wovon die deutsche Filmproduktion quantitativ gesehen indessen profitiert – ähnlich wie in Schweden oder Russland etabliert sich ein weitgehend isoliertes Nationalkino. 1916 werden Importe letztlich gänzlich verboten und die nationale Filmindustrie geht – anders als stark vom Export abhängige Filmländer wie Frankreich – unterm Strich gestärkt aus dem Ersten Weltkrieg hervor.
1915 gründet Erich Pommer die „Decla-Film-Gesellschaft“, ein ästhetisch gesehen recht eigenständiges Studio. Durch den Kriegsverlauf fühlt sich jedoch Erich Ludendorff, Erster Generalquartiermeister beim Chef des Generalstabs, veranlasst, 1917 eine „Vereinheitlichung der deutschen Filmindustrie“ zu fordern, vornehmlich für Propagandazwecke oder, wie es Ludendorff selbst ausdrückt: „um nach einheitlichen großen Gesichtspunkten eine planmäßige und nachdrückliche Beeinflussung der großen Massen im staatlichen Interesse zu erzielen.“ Daraus geht die Ufa (Universum Film AG) hervor, in der wiederum alle wichtigen Filmproduktionsfirmen, auch die Decla, aufgehen. Am 18. Dezember 1917 erfolgt der Eintrag ins Berliner Handelsregister. Auch wenn dieses Monopol bereits zur Tonfilmzeit punktuell angegriffen wird und in der Nachkriegszeit allmählich ins Bröckeln gerät, existiert die Ufa auch heute noch (als UFA). Die große Überschaubarkeit ist anhand von über 800 Produktionsfirmen anno 2020 allerdings vorbei. Die UFA ist zudem schon lange nicht mehr in den Top 5 der deutschen Produktionsfirmen vertreten, an deren Spitze relativ konstant die Constantin Film thront.