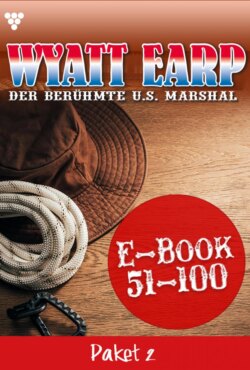Читать книгу Wyatt Earp Paket 2 – Western - William Mark D. - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEine wahre Höllenglut lastete auf dem engen Innenhof des aus gewaltigen Quadersteinen errichteten Südteils von Fort Worth.
Ein Mann hatte sich in eine Mauernische gepreßt und versucht, den winzigen Schatten auszunutzen, der den Fenstervorbau nach unten warf. Es war ein großer hagerer Mensch Ende der Zwanziger mit blondem strähnigem Haar und kalkigem, eingefallenem Gesicht. Er trug eine zerfetzte graue Joppe, ein vielfach mit Flicken besetztes Hemd und völlig abgewetzte Schuhe.
Jack Hardac, der Lebenslängliche, befand sich schon fast drei Jahre hier im Straflager. Da seit dieser Zeit keine Sträflinge mehr in Fort Worth eingeliefert worden waren, die lebenslänglich hatten, wurde dieser ›schwerste‹ Häftling immer allein zu dem viertelstündigen täglichen Spaziergang geführt. Zwei Jahre lang auch war er allein von einem schwerbewaffneten Wächtertrio in die gelben Steinbrüche sieben Meilen westlich vom Lager gebracht worden, wo er vom frühen Morgen bis in die späte Nacht Gesteinsbrocken aus der glühenden Felswand brechen mußte. Dann war Hardac schwerkrank geworden. Trotzdem hatten sie ihn weiter in die ›Steine‹ getrieben. Immer öfter war der unselige Gefangene zusammengebrochen. Bis er dann eines Morgens überhaupt nicht mehr von seinem Lager hochkonnte. Der Lagerarzt war ein alter Veterinär; er machte sich endlich die Mühe, von der Meldung des Sergeanten Notiz zu nehmen, und ließ sich den Sträfling Nummer 77 bringen. Ergebnis der Untersuchung: Hardac wurde von der Arbeit ausgeschlossen und hatte in seiner Zelle zu verbleiben.
Das jedoch war für den seit frühester Jugend an die freie Natur und die frische Luft gewöhnten Oregon Man die schlimmste Strafe. Täglich führten ihn zwei Wächter in den Hof: für eine ganze Viertelstunde. Anfangs versuchte der magenkranke Sträfling in diesen fünfzehn Minuten die Kraft und Stärke zu schöpfen, die er zur Selbsterhaltung noch benötigte. Aber dazu war die Viertelstunde viel zu kurz.
Der Gefangene 77 verfiel mehr und mehr.
Und an ernstliche ärztliche Hilfe dachte niemand.
War er doch ein Lebenslänglicher. Ob er nun gesund wurde oder nicht – sein Leben war ja ohnehin verwirkt. Da war es doch immer besser, wenn er bald starb.
Auf diesem Standpunkt stand der Veterinär Guadelmy. Und auch Captain Miller, der Leiter des Straflagers. Und mit ihnen sämtliche Leute vom Wachpersonal.
Verzehrte er doch nur ein unnötiges Brot, erforderte strengste Bewachung und nicht selten hatten sie ihn aus der Zelle in den Gitterkorridor schleppen müssen, da er zur Zellenreinigung oft einfach unfähig war.
War es da nicht tatsächlich das beste, wenn er bald starb?
Yeah, so sah es Ende der Siebziger Jahre in dem berüchtigten Straflager Fort Worth aus.
Ganz sicher wäre das Dasein des Lebenslänglichen Jack Hardac, des Strafgefangenen mit der Nummer 77, lautlos zu Ende gegangen, wenn nicht Sam Mitchell gewesen wäre, der
baumlange schwarzhäutige Wachsoldat von Fort Worth, mit dem seine weißhäutigen Kollegen nur die nötigsten Worte wechselten.
Der schwarze Sam war höchstwahrscheinlich der einzige Mensch, der in dem Straflager so etwas wie ein Herz in seiner Brust hatte. Und obgleich auch der lebenslängliche Hardac ihn zu Zeiten, als er noch gesund und stark war, nicht anders behandelt hatte als die andern, empfand der dunkelhäutige Wächter jetzt Mitleid mit dem hinfälligen Gefangenen.
Immer, wenn der schwarze Mitchell Dienst hatte, konnte Hardac etwas aufatmen. Vor allem, wenn der Schwarze seinen täglichen Spaziergang einmal allein zu bewachen hatte. Dann zwang er den Gefangenen nicht, wie es die anderen taten, den sinnlosen Rundgang zu machen; im Gegenteil: Hardac konnte sich in den schmalen Winkel unter dem Fenstervorbau lehnen, wo er Schutz vor den sengenden Strahlen der Sonne fand.
Auch in der Zelle suchte der schwarze Sam dem Gefangenen jede mögliche Erleichterung zu verschaffen. Er kam häufig, um – was nicht gestattet war – das Fenster zu öffnen, brachte zuweilen verstohlen einen Becher mit Milch oder auch ein Stück Brot. Aber all dies war natürlich nur möglich, wenn Mitchell allein Wachdienst hatte. Das kam so gut wie nie vor und daß es doch zuweilen ge-schah, war der Tatsache zuzuschreiben, daß die anderen Wächter sich hin und wieder ein paar bequeme Stunden auf Kosten der Schwarzen machten. Dies sollte sie alle, vor allem aber Sam Mitchel, teuer zu stehen kommen.
An diesem Tag war es wieder einmal so. Sam Mitchell hatte den Lebenslänglichen allein zu bewachen, da die beiden anderen, Tim Holloway und Jonny Enkers, unten in der Wachstube saßen und pokerten.
Hardac lehnte in der Gesteinsnische und sog die Luft vorsichtig in seine schmerzenden Lungen. Den Schmerz im Magen spürte er schon gar nicht mehr, weil es ein ständiger Schmerz geworden war, weil er Tag und Nacht bei ihm weilte. Aber wenn er in den Hof geführt wurde und die Luft einatmete, die hier herrschte, schmerzte sein ganzer Brustkasten. Und bald verursachte die von den Steinen zurückprallende Hitze ihm auch einen hämmernden Kopfschmerz.
Jack Hardac war ein gebrochener Mann. Er wußte das. Und dennoch gab er sich nicht auf. Tag und Nacht während seiner gesamten Haftzeit lag er auf der Lauer, in gesunden und kranken Tagen. Er hatte sie nie aufgegeben.
Auch jetzt noch nicht, da er doch wie ein Sterbender in der Mauernische lehnte. Hätte Sam ihm nicht in den letzten Wochen öfter einen Becher Milch, eine Sonderbrotration und zuweilen sogar ein Stück Käse gebracht, dann wäre er jetzt sicher nicht mehr auf den Beinen gewesen.
Das Geschick des Gefangenen, das seit Jahren unverändert hoffnungslos war, sollte sich noch an diesem Tag, in dieser Viertelstunde noch, entschieden ändern.
Pinky Bludschun war es, der diese Änderung herbeiführte. Bludschun war ein vierkantiger Bursche mit verschlagenem pockennarbigem Gesicht und klobigen Fäusten. Er hatte eine niedrige Stirn und unter dem aufgeworfenen Mund saß ein weit vorspringendes Kinn. Er war dreiunddreißig Jahre alt und seit einiger Zeit Chief Sergeant des Staflagers.
Es war ein unseliger Zufall, der ihn ausgerechnet an diesem Tag durch den Innenhof des Südcamps führte.
Hardac hatte seine Schritte gehört. Aber es war zu spät gewesen, sich noch aus der Mauernische zu lösen. Er hoffte inständig, Bludschun möge ihn nicht entdecken.
Aber da hatte er sich getäuscht. Der Chief Sergeant entdeckte ihn sofort und steuerte mit harten wütenden Schritten auf ihn zu.
Vier Yards vor ihm blieb er stehen. Bludschun hielt diese Distanz vorsichtshalber immer ein, aus Erfahrung. Er hatte es schon erlebt, daß ihn Männer, die müde, krank und zusammengebrochen wirkten, noch ansprangen, als er auf zwei Yards an sie herangekommen war.
Aus schmalen, schrägsitzenden Augen musterte der pockennarbige Oberwächter den Sträfling. Plötzlich zuckte seine Rechte zum Gürtel und riß die Bullpeitsche hoch.
Hart und klatschend traf der erste Hieb den Gefangenen auf den Schädel. Der zweite riß eine blutige Furche in sein Gesicht, und der dritte betäubte ihn fast.
Da stand wie aus dem Boden gewachsen der schwarze Sam vor dem Sergeanten.
»Was soll das?« kam es heiser über seine wulstigen Lippen.
Bludschun warf den Kopf herum und starrte den Neger an.
»Ach, du dreckiger Halunke hast hier die Wache? All right! Nimm das als Anzahlung!«
Er riß dem Schwarzen die Peitsche durchs Gesicht. Und als er zum zweiten Schlag ausholen wollte, wurde sein Arm in der Luft aufgehalten.
Sam Mitchell hatte das Ende des fingerdicken Lederriemens erwischt und hielt es fest.
Da stieß Bludschun die Linke zum Coltknauf.
Er hatte die Waffe schon fast aus dem Halfter, als ihn die schwere Faust des Negers traf und von den Beinen riß.
Entgeistert über sein eigenes Vorgehen, starrte der Schwarze auf den Wächter-Boß nieder.
Die Bullpeitsche lag am Boden.
Und der Colt…?
Die Waffe war bis auf sieben Inches vor den rechten Fuß des immer noch halb betäubt in der Mauernische lehnenden Sträflings gerutscht.
Nur drei Sekunden waren seit dem Niederschlag Bludschuns vergangen.
Da handelte Jack Hardac.
Er ließ sich nach vorn fallen, riß die Waffe an sich, schnellte unter Aufbietung aller Leibeskräfte hoch und hieb dem Neger, der ihn beschützt hatte, den schweren Revolverkolben mehrmals über den Kopf. Er schlug auch noch zu, als der schwarze Mann längst still am Boden neben dem weißen Wächter lag.
Jack Hardac riß ihm das Bowiemesser aus dem Gurt und warf sich damit auf den von ihm tödlich gehaßten Sergeanten.
Pinky Bludschun war noch nicht aus der Besinnungslosigkeit erwacht, in die ihn der Uppercut des Negers geschickt hatte, als ihn der Tod ereilte.
Der Gefangene sah sich um.
Schweratmend stand er zwischen den beiden Körpern. Dann schnellte er vorwärts auf das Tor zu, das ins Vordergebäude des Südcamps führte.
Halt! Er hielt mitten im Lauf inne.
»Die Schlüssel!« keuchte er tonlos, wandte sich um und lief zurück.
An dem Gurt des toten Sergeanten fand der Mörder ein großes Schlüsselbund, den er hastig an sich riß.
Er kannte die Schlüssel genau. Jahrelang hatte er beobachtet, wer zu welcher Tür und zu welchem Schloß gehörte. Hastig riß er einen großen Schlüssel hoch, stieß ihn ins Schloß und mußte sich dann sehr beherrschen, ruhig umzudrehen.
Obgleich das große Schloß mehrmals täglich bewegt wurde, schien es dem Gefangenen, daß es sich gerade jetzt besonders geräuschvoll gab. Er öffnete das Tor, zog es hinter sich zu und hatte sogar die Nerven, wieder abzuschließen.
Mit dem Schlüsselbund in der Linken, mit dem Colt in der Rechten durchquerte er den ersten Korridor.
An der vorletzten Tür hielt er inne und schob die Klappe zurück. Drüben unter dem Fenster hockte ein grauhaariger Mann in farblosem Leinenzeug der Sträflinge und schien zu schlafen.
Er war vielleicht fünfzig Jahre alt, hatte ein stoppelbärtiges kantiges Gesicht und helle Augen. Von seinem linken Ohr fehlte die obere Hälfte. Als er jetzt aufblickte, stand in seinen Augen namenlose Verwunderung.
Dieser Mann war James Brock, der einstige Sheriff von Santa Fé.
»Hallo, Sheriff!« rief Hardac. »Wollen Sie mit?«
Bei dieser Frage kroch ein diabolisches Lächeln über das Gesicht des Lebenslänglichen.
Brock, den ein seltsames Geschick hierher nach Fort Worth geführt hatte, sprang auf und kam an die Türklappe.
»Hardac! Sie?«
»Yeah, ich.«
»Wie kommen Sie hierher?«
»Ich bin frei!«
Jack Hardac fletschte sein gelbes lückenhaftes Gebiß und schob den Unterkiefer vor.
»Yeah, Sheriff, ich bin frei. In einer Viertelstunde bin ich draußen in der Savanne.«
»Sie sind verrückt!«
Hardac riß den Schlüsselbund hoch und hielt ihn vor die Türluke.
»Hier, Brock, kennen Sie das? Das bedeutete den Weg in die Freiheit.«
James Brock stierte den Oregon Man fassungslos an. Dann brach es plötzlich von seinen Lippen:
»Nehmen Sie mich mit, Hardac.«
Der Mörder Jack Hardac hatte die Luke dieser Zelle nicht ohne Absicht geöffnet. Mit flimmernden Augen fixierte er das Gesicht des einstigen Sheriffs.
»Wo ist das Gold, Brock?«
»Ich weiß es nicht, Hardac.«
»Wenn Sie nicht wissen, wo das Gold ist, kann ich Sie nicht brauchen«, versetzte Hardac schroff.
Da preßte Brock durch die Zähne:
»Well, schließen Sie auf, Sie sollen ein Drittel haben.«
»Die Hälfte«, sagte er eiskalt.
Der Unterkiefer des einstigen Sheriffs bebte.
»Erpresser!«
Als Hardac die Türklappe zustoßen wollte, packte Brock die Hand dazwischen.
»All right«, krächzte er. »Die Hälfte.«
Auch diesen Schlüssel kannte Hardac genau.
Ächzend sprang die schwere Zellentür auf.
James Brock kam so mit, wie er war. Es gab nichts, was er mitzunehmen gehabt hätte.
Hardac zog die Zellentür hinter ihm zu.
Dann gingen sie zusammen weiter. Drei große Gittertüren wurden geöffnet und wieder geschlossen. Einen Augenblick dachte James Brock an zwei Männer, die auch hier im Fort saßen, an zwei Männer, die ihm vielleicht eine wertvolle Hilfe hätten sein können. An Pedro Gonzales, der eine große Ranch unweit von Dallas hatte – und an den Revolvermann Jonny Sullyvan.
Brock wußte die beiden heute im Camp. Sie hatten Reinigungsdienst in den Mittelkorridoren. Aber der einstige Sheriff von Santa Fé verscheuchte diesen Gedanken wieder. Und ganz sicher wären Gonzales und Sullyvan, die beide für fünf Jahre wegen Totschlags ins Straflager geschickt worden waren, nach Verbüßung ihrer Strafe freie Männer gewesen, hätte es nicht den Möder Jack Hardac gegeben.
Der blieb vor dem großen Mitteltor stehen und stieß den Schlüssel plötzlich ins Schloß.
»Was soll das?« zischte Brock. »Zum Ausgang müssen wir diese Treppe hinunter.«
»Yeah, aber da drinnen sind Gon-zales und Sullyvan, und die brauchen wir beide, wenn wir auch nur hundert Meilen zwischen uns und das Fort bringen wollen.«
»Unsinn! Jede Minute, die wir hier vergeuden, kann unser Ende bedeuten«, mahnte Brock.
Aber Hardac öffnete die beiden Schlösser und stieß dann mit einem kräftigen Stoß die Tür auf.
Der untersetzte Wächter, der mit dem Rücken zur Tür gestanden hatte, fuhr herum.
Hardacs Faustschlag hätte ihn nie getroffen. Wer weiß, was schon hier geschehen wäre, wenn James Brock nicht bei ihm gewesen wäre. Der einstige Gesetzesmann hechtete dem Wächter im Flug mit vorgestrecktem Kopf entgegen und rammte ihn wie ein Geschoß nieder.
Da riß Hardac die Klinge aus dem Gurt.
Brock spannte seine sehnige Faust um den Unterarm des Oregonmannes.
»Lassen Sie das. Es ist überflüssig. Er kommt vor einer Stunde ganz sicher nicht zu sich.«
In der Flurmitte knieten in einer unglaublich schmutzigen Wasserlache zwei Männer. Der schwarzhaarige Rancher Gonzales und der graugesichtige Schießer Sullyvan.
»Vorwärts!« zischte Hardac.
Die beiden erwachten aus ihrer Erstarrung und sprangen hoch. Es hatte eine Weile gedauert, bis ihnen völlig klargeworden war, was sich da ereignet hatte.
Gonzales riß die abgesägte Schrotflinte des Wächters an sich.
Und dann stürmten sie los. Auf der Treppe zum Korridor, der zur Wachstube führte, mahnte Hardac zur Vorsicht.
»Die Bande pokert«, zischte er.
Brock entschied sofort, ehe Hardac etwas weiteres sagen konnte:
»Es sind nur zwei. Wir schlagen sie nieder, knebeln und binden sie.«
Hardac schoß ihm einen gehässigen Blick zu.
»Sie sind immer noch ein verdammter Sheriff!«
»Ruhe«, mahnte Gonzales.
Da stieß Brock die Tür zur Wachstube auf, und in Blitzesschnelle waren auch die beiden überwunden.
»Wie wollen wir über den Vorplatz zum Haupttor kommen?« fragte Gonzales unsicher.
»Wir gehen ganz langsam«, schnarrte Hardac.
Die Tür zum Außenhof wurde geöffnet. Wabernde Hitze schlug den vieren entgegen. Der weißgelbe Sand blendete sie. Rings um den Hof standen fugenlos die braungrauen Baracken. Und drüben, fast zweihundert Yards entfernt, war das Haupttor.
Tag und Nacht hielten dort zwei Posten Wache.
Einer lehnte unten sichtbar in der Tornische, und der andere war irgendwo oben auf der Galerie des hölzernen Wachturmes. Die vier Ausbrecher konnten ihn nicht entdecken.
»Wir können hier nicht stehenbleiben«, mahnte Gonzales.
Da hatte Hardac eine neue Idee.
»Wir gehen hintereinander.«
Er selbst blieb neben der kleinen Reihe und führte die Männer wie ein Arbeitstrupp auf das Tor zu.
Der neunzehnjährige Ric Johnson löste sich aus der Türnische und plinkerte den Gefangenen entgegen.
He, was sollte denn das? Seit wann bewegten sich hier im Camp denn die Sträflinge ohne Aufseher?
Johnson nahm sein Gewehr fester in die Hände.
Der Gefangenentrupp hatte ihn jetzt erreicht.
Gonzales und Sullyvan stürzten sich gleichzeitig auf den Wächter.
Lautlos sank der Bursche in sich zusammen.
Eine Minute später hatte Hardac das Haupttor geöffnet.
Dann spielte sich alles rasend schnell ab.
Oben auf der Galerie stand der Texaner Gene Tilburry. Er sah die Männer, wie sie zum Corral stürmten, wo die Pferde standen.
Tilburry begriff nicht sofort.
Als er dann das Gewehr hochriß, warf sich der Rancher mit der Schrotbüchse herum.
Aber der Schuß aus der alten Flinte des Aufsehers löste sich nicht.
Dafür riß die Kugel Tilburrys den Rancher um.
Die anderen waren schon weiter vor.
Hardac kam nur schleppend vorwärts. Als er Gonzales fallen sah, riß er den Colt hoch und schoß. Traf den Posten aber nicht.
»Sullyvan!«
Der Schießer war stehengeblieben.
Hardac schleuderte ihm den Colt zu.
Sullyvan fing ihn auf, sprang zur Seite und schoß zweimal.
Tilburry stürzte, noch ehe er die nächste Kugel hatte abfeuern können, von der Galeriebrüstung herab und schlug krachend auf den glühenden Sand auf.
Die Entsprungenen flüchteten weiter.
Nur Gonzales lag reglos im Sand. Die Kugel hatte ihn rechts in die Brust getroffen. Er war nicht tot, aber doch so sehr verwundet, daß er sich nicht mehr weiterzuschleppen vermochte.
Die Schüsse waren im Camp gehört worden.
Joe Perkins und Elvis Gordon waren nach einer halben Minute am Tor, öffneten und kamen heraus.
Inzwischen hatten die Flüchtlinge den Corral erreicht und schwangen sich auf drei ungesattelte Pferde.
Schüsse krachten.
Gewehrschüsse.
Sullyvan wurde getroffen und rutschte links über den Pferdehals zu Boden.
Da lag er – nahm den Revolver hoch und wartete, bis die beiden Posten in sein Schußfeld gekommen waren.
Hardac starrte mit brennenden Augen zu ihm hinüber.
Aber der Schießer Sullyvan ließ seine Kameraden nicht im Stich. Er schoß auch die beiden nächste Posten kampfunfähig.
Dann richtete er sich auf und versuchte, aufs Pferd zu kommen.
Ein erneuter Gewehrschuß von der Fenz des Camps her warf ihn wieder vom Gaul.
Brock hielt in dreihundert Yards Entfernung an und sah sich nach Hardac um.
Der kam herangeprescht.
»Vorwärts!« keuchte Hardac.
Brock rührte sich nicht.
»Wenn wir fliehen, hängen sie Sullyvan auf.«
»Er ist ohnehin verloren!« krächzte der Mörder Hardac.
»Nein, er ist am Bein und an der linken Schulter verletzt.«
»Wir müssen weg…!«
»Sie hängen ihn!«
»Und wenn wir bleiben, haben wir alle verspielt!«
Der einstige Sheriff sah ihn finster an.
»Verspielt? No, wir bekommen die doppelte Strafe, nichts weiter.«
»Ich habe lebenslänglich!« schrie Hardac und hieb auf sein Pferd ein.
Brock sah ihm nach. Er selbst hatte das beste Tier erwischt und somit die größten Aussichten, zu entkommen.
Aber der einstige Gesetzesmann wandte das Pferd und ritt langsam zum Fort zurück.
*
So unwahrscheinlich es sein mochte und so gering seine Chancen zu sein schienen: der Lebenslängliche Jack Hardac entkam.
Im scharfen Galopp wandte er sich nach Westen und erreichte schnell die offene Savanne.
Zwar folgte ihm schon nach einer Stunde ein Aufgebot von Wachpersonal, aber der schwerverletzte Revolvermann Jonny Sullyvan hatte ein letztes getan, um seinen Mitgefangenen den Weg in die Freiheit zu eröffnen. Er hatte sich, vom Tor her noch unbeachtet, zum Corral geschleppt und mit den beiden letzten Kugeln, die er in der Trommel hatte, den größten Teil der Pferde durch das noch offenstehende Corraltor vertrieben.
Bis die Wachposten die ersten Tiere wieder eingefangen hatten, verging mehr als eine Stunde.
Das sicherte dem Mörder einen enormen Vorsprung, der, wie sich später zeigte, nicht mehr eingeholt werden konnte.
Das Pferd, auf dem Brock gesessen hatte, war den anderen davonstürmenden Tieren augenblicklich gefolgt, als der Sträfling von seinem Rücken gerutscht war.
Die Lage der Zurückgebliebenen war erheblich schlimmer, als Brock angenommen hatte. Er wußte ja nicht, daß Hardac den Chief Sergeanten im Innenhof erstochen hatte.
Der schwarze Wachsoldat Samuel Mitchell gab zwar auch kein Lebenszeichen von sich, als man ihn fand, aber das rührte niemanden im Fort. Man schaffte ihn in die Totenkammer – und die Wächter, die zwei Stunden später davorstanden, stoben entgeistert davon, als sich die unverriegelte Holztür der Totenbaracke öffnete und sich der Schwarze mit verzerrtem Gesicht ins Freie schleppte.
Mitchell hatte die fürchterlichen Schläge mit dem Revolverkolben überstanden. Sein harter kraushaariger Schädel war widerstandsfähiger gewesen, als Hardac geglaubt hatte.
Der schwarze Sam wankte auf das Mannschaftshaus zu und ließ sich auf sein Lager niederfallen.
Aber es hätte nichts an der Lage Brocks und Sullyvans geändert. Der Tod eines Schwarzen wog nichts, auch wenn er zum Wachpersonal des Straflagers gehörte.
In der neuen Verhandlung wurden Sullyvan und Brock zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt und hatten dies noch als große Gnade zu betrachten. Wäre Brock nämlich nicht freiwillig zurückgekehrt, hätte der Revolvermann Sullyvan, wie Brock es vorausgesehen hatte, den sofortigen Tod am Galgen gefunden.
Statt dessen teilte der einstige Sheriff von Santa Fé das Geschick des von ihm verachteten Revolvermannes und hatte die fürchterlichste Strafe entgegennehmen müssen, die ein Mensch in diesem rauhen Land überhaupt bekommen konnte.
Dabei hatte er nur an der Flucht teilgenommen, weil er glaubte, so eine Chance finden zu können, seine Unschuld zu beweisen.
James Brock war unschuldig zu zwölf Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Und ganz sicher ahnte er nicht, daß ausgerechnet der Outlaw Jack Hardac die Schuld an seiner Verurteilung trug…
Wie war das damals eigentlich gewesen?
In der Nacht vom elften auf den zwölften April 1877 war in Beverlys Bank in der Mainstreet von Santa Fé eingebrochen worden.
Sheriff Brock hatte sich sofort an die Verfolgung der Bande gemacht. Bald aber hatte er feststellen können, daß es sich nicht um eine Bande, sondern nur um einen einzelnen Banditen handelte. Er jagte ihn bis hoch hinauf in die Berge New Mexicos, ohne ihn jemals zu Gesicht zu bekommen. Jedenfalls nicht so, daß er ihn hätte erkennen können. Er sah ihn immer nur von hinten.
Eines Abends trieb er ihn nur hundertfünfzig Yards vor sich her eine steile Bergpassage hinauf.
Der Bandit verlor bei der Hetzjagd die drei schweren Goldbeutel –?und entkam.
Brock versteckte die Beute zwischen den Felsen und nahm weiter die Spur des Verbrechers auf.
Aber das Glück war auf Seiten des Banditen. Er entkam in der Nacht. Und James Brock wußte nicht, daß er den seit langem gesuchten Raubmörder Jack Hardac vor sich gehabt hatte. Er folgte ihm noch drei Tage, und als er die Jagd schließlich aufgeben mußte, da er die Spur verloren hatte, machte er kehrt –?und mußte dann feststellen, daß inzwischen ein anderer das Goldversteck aufgestöbert und geleert hatte.
Es gab niemanden in Santa Fé, der dem eisenharten Sheriff den Raub zutraute. Dennoch wurde er einen Monat später von Richter Henry Abraham zu zwölf Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
Jeder in Fort Worth kannte die Geschichte des Sheriffs.
Auch Jack Hardac hatte sie gekannt.
Er war übrigens ein halbes Jahr später oben an der Grenze von Kansas von dem berühmtesten Sternträger des Westens von Wyatt Earp, gestellt und festgenommen worden. Es war seinem Richter nicht allzu schwer gefallen, über den seit langem steckbrieflich gesuchten mehrfachen Mörder das ›lebenslänglich‹ zu verhängen.
So war der Verbrecher nach Fort Worth gekommen. In das gleiche Straflager, in dem auch der Mann saß, dessen Unglück er im Grunde verschuldet hatte.
Hardac hatte den Sheriff nicht etwa aus einer Anwandlung von Mitleid mit sich schleppen wollen, als er floh, es war pure Berechnung gewesen, denn er glaubte, Brock habe das Gold beiseitegebracht.
Ein zweites Mal hatte der Sante Fé-Sheriff dem Verbrecher Hardac sein Unglück zu verdanken.
Der Mörder indessen war entkommen. Da er allen Grund hatte, die Städte zu meiden, wo jeder Sheriff seinen Steckbrief kannte, ritt er weiter westwärts nach Arizona hinüber.
Geradewegs in die Höhle des Löwen…
*
An einem glühendheißen Spätnachmittag ritt ein Mann von Osten her in die Stadt Tombstone ein.
Er war groß, hager, hatte helles Haar und graue Augen. Ein starker Bart verdeckte die untere Hälfte seines Gesichtes. Dieser und das mit Baumrindensaft gefärbte Haar hatten den entsprungenen Fort Worth-Sträfling Jack Hardac so unkenntlich gemacht, daß auch der Sheriff, der seinen Steckbrief lange und eingehend studiert hatte, ihn kaum hätte wiedererkennen können.
Hardac hatte es nicht erst hier in Tombstone erprobt. Er war schon in einigen anderen Städten gewesen und war dort zu der Überzeugung gelangt, daß seine Maske gut war.
Mit seinem Ritt nach Tombstone wollte sich der kaltnervige Verbrecher selbst beweisen, daß er endgültig mit der Vergangenheit abgeschlossen hatte, jedenfalls was seine Angst vor den Männern des Gesetzes betraf. Er wußte genau, wer der Gesetzesmann von Tombstone war. Jeder im Westen wußte es: es war Virgil Earp, der ältere Bruder des berühmten Dodger Marshal Wyatt Earp. Wie Wyatt, so war auch Virgil Earp dafür bekannt, daß er ein scharfer Banditenjäger war.
Hardac fragte einen Jungen nach dem Sheriffs Office.
Dort band er sein Pferd an und öffnete die kleine Officetür, ohne anzuklopfen.
Hinter einem großen Schreibtisch saß ein mittelgroßer etwas kränklich aussehender Mann mit schwarzem Backenbart. Er trug eine graue Tuchhose und ein verschwitztes graues Kattunhemd. Links auf der verblichenen schwarzen Weste hatte er den sechszackigen Stern stecken.
Hardac sah ihn verblüfft an.
Heavens! So hatte er sich Virgil Earp nicht vorgestellt! Dieser Bursche da sah eher aus wie ein kranker Fisch – nicht aber wie der große Banditenschreck Earp.
»He!« sagte Hardac, durch das wenig eindrucksvolle Äußere des Sheriff ermutigt, »wo finde ich hier in diesem Drecksnest ein anständiges Quartier?«
Der Sheriff hatte sich erhoben. Er musterte den Fremden unsicher und entgegnete dann mit quäkiger Stimme:
»Bei Nelly Cashman sind Sie am besten aufgehoben.«
Hardac nickte.
»Yeah, kann sein. Habe den Namen schon gehört.«
Hardac nahm sein Tabakszeug aus der Tasche und drehte sich eine Zigarette.
»Wissen Sie, ich bin fürs Gründliche. Wenn ich in eine Stadt komme, gehe ich gleich zur Polizei und lasse mich beraten. Man wird sonst unnötigerweise hin- und hergeschickt.«
Der vermeintliche Virgil Earp nickte.
Hardac ging langsam zur Tür.
»Und wo gibt’s Essen?«
»Auch dort«, versetzte der Sheriff.
Wortlos stampfte der Oregon Man hinaus.
Er wußte nicht, daß diese Stadt außer dem US Deputy Marshal auch noch einen Town Sheriff hatte; Jonny Behan hieß der Mann, den er eben besucht hatte. Ein weichlicher Bursche, der aber unter dem Schafspelz ein Hyänenherz trug. Behan war ein heimlicher Gegner der Earps und ein Freund der berüchtigten Clanton Brothers, die dem Deputy-Marshal Virgil Earp seit geraumer Zeit schwer zu schaffen machten. John Clum selbst, der Mayor und Herausgeber des Tombstone Epitaph, hatte Behan einen gefährlichen Burschen mit Kindergesicht genannt.
Hardac stieg wieder auf seinen Gaul und ritt zu Nelly Cashmans Hotel. Es war ein ziemlich großer flachgestreckter Bau in Hufeisenform, dessen Besitzerin einmal in die Geschichte der alten Westernstadt Tombstone eingehen sollte.
Hardac trug sich als Jeff Gilbert ins Gästebuch ein und ging auf das ihm von der Hauseigentümerin zugewiesene Zimmer, wo er sein Äußeres überprüfte.
Der entsprungene Bandit war zufrieden. Er konnte überzeugt sein, daß ihn in dieser Vermummung selbst seine eigene Mutter kaum wiedererkannt hätte.
Er legte sich zwei Stunden auf sein Lager, um sich nach dem anstrengenden Ritt auszuruhen. Dann erhob er sich, setzte seinen mißfarbenen Hut auf und ging hinaus.
Immer noch lag die Hitze wabernd in den Straßen Tombstones. Der gelbe Sand war glühendheiß, und von den weißgekalkten Adobewänden prallte die Sonnenglut des Tages zurück.
Welch ein rätselhaftes Geschick hatte den Mann ausgerechnet hierher in diese Stadt getrieben? Weshalb hatte er sich nicht nach Norden gewandt, oder nach Osten? Ausgerechnet hierher, in die Höhle des Löwen, war er gekommen. Siebenundzwanzig Tage nach seiner Flucht.
Er ging mit leise klirrenden Sporen zur Alleestreet und steuerte direkt auf den Crystal Palace zu.
Noch genau eine Stunde sollte seine Freiheit dauern, als die beiden bastgeflochtenen Schwingarme der Pendeltür hinter ihm zufielen.
Er stellte sich zwischen die anderen Männer an die sehr pompöse Theke, bewunderte wortlos den gewaltigen dreiteiligen Spiegel, der ganz sicher im Westen seinesgleichen suchte, und bestellte sich einen Whisky.
Langsam schlürfte er das starke Getränk in sich hinein.
Links neben ihm stand ein ellenlanger Bursche in Kleidung eines Weidereiters. Er hatte ein wahres Bullenbeißergesicht. Triefaugen und Sattelnase. Tief um seine Hüfte saß ein patronengespickter Waffengurt, der an beiden Seiten je einen großen Revolver hielt.
Plötzlich fuhr die behaarte Rechte des Cowboys nach rechts und fegte wie unbeabsichtigt Hardacs Glas vom Thekenrand.
Der Oregon Man war erfahren genug, um nicht zu reagieren.
Er gab dem Keeper ein Zeichen und bestellte sich ein neues Glas. Dann sah er den Riesen an.
Der wischte sich durchs Gesicht und feixte.
»He, da muß doch irgendwo ein Stinktier herumhängen, Boys. Hier ist Schafsgestank in der Luft.«
Das war eine ganz eindeutige Beleidigung; aber der entsprungene Sträfling dachte nicht daran, darauf zu reagieren.
Er trank den neuen Whisky rasch aus und wandte sich um.
An einem der mit grünen Filzstoffen bezogenen Tische sah er einen einzelnen Mann sitzen, der sich offenbar eine Patience legte.
Hardac steuerte auf ihn zu.
Der Cowboy, der sich gerade mit ihm hatte anlegen wollen und schon den Arm nach ihm ausgestreckt hatte, hielt fast erschrocken inne, als er sah, daß der Bärtige auf den Mann am Spieltisch zusteuerte.
Der Mörder Jack Hardac steuerte geradewegs auf das Riff zu, an dem er zerschellen sollte.
Er blieb vor dem Spieltisch stehen und sah dann dem Mann eine Weile zu.
Es war ein schlanker, hochgewachsener Mann mit scharfgeschnittenem ebenmäßigem Gesicht und eisblauen Augen. Er war sauber frisiert, trug einen Bart auf der Oberlippe und hatte im Gegensatz zu seiner Umgebung, von der er schon durch sein elegantes Äußeres abstach, sauber gepflegte nervige Hände.
Was hätte der Bandit wohl gesagt, wenn ihm jetzt jemand erklärt hätte, daß dieser Mann da niemand anders als der berühmte Gambler John Henry Holliday war, der unter dem Namen Doc Holliday im ganzen Westen bekannt und gefürchtet war?
Höchstwahrscheinlich hätte der Outlaw Jack Hardac sich eben noch die Zeit genommen, an den Rand seines schmutzigen Hutes zu tippen und wäre dann eilends geflüchtet.
So aber nahm er sich, ohne zu fragen, einen Stuhl und ließ sich nieder.
»Ist das nicht ziemlich langweilig, Mister, was Sie da tun?« meinte er spöttisch.
Der Fremde beachtete ihn überhaupt nicht. Er legte weiter seine Karten, deckte sie auf und sammelte sie wieder ein.
Dann zündete er sich eine lange russische Zigarette an und nahm einen Schluck von seinem Brandy.
Hardac sagte rauh:
»Machen wir ein Spiel, Mister?«
Da wandte der andere den Kopf, und der Blick seiner kühlen Augen tastete das Gesicht des Verbrechers ab.
»Sicher.«
Sie spielten.
Jack Hardac war ein gerissener Spieler. Und wenn er jetzt etwas brauchte, dann war es Geld. Das war auch der Grund gewesen, der ihn ausgerechnet hierher geführt hatte.
Und dieser geschniegelte Stadtfrack da, der aussah, als wollte er für einen St. Louis-Schneider hier Reklame laufen, der war gerade der Mann nach Hardacs Sinn. Ganz sicher gab es bei ihm einige Böcke zu holen.
Hardac spielte so, wie er immer gespielt hatte: falsch!
Es war immer gutgegangen; viele Jahre hindurch.
Bis zu dieser Stunde.
An der Theke herrschte eine merkwürdige Stille, die Hardac irgendwie unbehaglich anmutete. Aber er sagte nichts. Er spielte weiter –?und suchte seine bösen Tricks anzubringen.
Dreimal war ihm die Sacramentowelle bereits geglückt, ein übler As-Rutscher. Und als er ihn jetzt ein viertesmal einschieben wollte, blickte der Georgier auf.
Ganz leise, ohne jede Erregung und ohne drohenden Unterton meinte er:
»Ich habe die Zahl vier, Mister.«
Hardac zog die Brauen zusammen.
Er verstand – und verstand auch nicht. Deshalb fragte er schroff:
»Was soll das?«
»Well, jeder hängt doch irgendwie an einer Zahl. Bei mir ist es die vier. Verstehen Sie?«
»Nein.«
»All right.« Holliday sah ihm ruhig aber auch fest in die fahlen farblosen Augen. »Sie haben mir dreimal die Sacramentowelle vorgeführt. Nicht ganz schlecht. Aber auch nicht gut genug für wache Augen. Ich weiß nun, daß Sie sie nicht beherrschen, und möchte sie kein viertes Mal sehen.«
Hardac machte den größten Fehler, den er in dieser Situation überhaupt machen konnte. Er sprang auf und warf den Tisch um.
Still saß der Fremde auf seinem Stuhl und sah ihn gelassen an.
»Soll das ein neuer Trick sein?« fragte er kühl.
Soviel Ruhe verschlug dem Oregon Man für einen Augenblick die Sprache. Dann krächzte er:
»Sie haben mich des Falschspiels bezichtigt!«
Holliday zog unwillig die Brauen zusammen und entgegnete fast sanft:
»Aber – was sind das für harte Ausdrücke, Mister. Setzen Sie sich. Und seien sie so gut und stellen Sie den Tisch wieder auf seine Füße.«
»Dreckskerl!« schrie Hardac in rasendem Zorn und stieß die Rechte zum Revolver.
Aber er hielt mitten in der Bewegung inne.
Der Gentleman Gambler hatte plötzlich einen großen vernickelten Revolver mit elfenbeinbeschlagenem Knauf in der Rechten.
»Sie sind ziemlich nervös, Mister. Ich sagte, setzen Sie sich!«
Hardac starrte ihn entgeistert an.
All thousand devils! So etwas hatte er noch nicht erlebt. Wie war der Colt in die Hand des Fremden gekommen? Das grenzte ja schon an Zauberei.
Zounds, er hatte Wes Hardin in Dallas gesehen, Ernie Billinger und Joe Corbet. Auch Jonny Sullyvan war ein Blitzzieher gewesen – aber dieser Mann hier übertraf sie alle.
Hardac hatte plötzlich eine Vision: Er sah wieder den Augenblick, in dem ihm der Dodger Marshal Wyatt Earp oben an der Grenze von Kansas stellte. Er hatte keinen Revolver gezogen. Ganz ruhig hatte er vor ihm gestanden. Und doch war Jack Hardac sicher gewesen, daß der Marshal den Colt gedankenschnell in seiner Faust gehabt hätte, wenn es darauf angekommen wäre.
Jack Hardac hatte es damals nicht darauf ankommen lassen.
Weshalb mußte er in dieser heißen Minute an jene bittere Stunde denken?
Plötzlich wußte er es: Es war etwas in den Augen dieses Gentleman Gamb-lers da, das ihn irgendwie an den Marshal Wyatt Earp erinnerte, an dessen Blick…
Dennoch war Jack Hardac jetzt unbesonnen genug, gallig zu zischen:
»Wir sprechen uns noch, Mister!« Er wandte sich um und stampfte zur Tür.
Doc Holliday federte hoch, ließ den Colt zurück ins Halfter fliegen und folgte dem Banditen.
An der Tür holte er ihn ein und riß ihn an der Schulter herum.
»Hören Sie, Mister. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, die mir das versprachen. Einige davon liegen auf dem Boot Hill.«
Hardac flammte den Georgier an.
»Sie können mich nicht schrecken, Mann!«
»Schrecken? Wer will das? Ich meine nur, wenn Sie mich noch sprechen wollen, können wir das gleich erledigen. Morgen früh kann schon einer von uns tot sein.«
Dieser Blick! Er schien den Outlaw zu durchbohren. Heiser preßte Hardac hervor:
»Sie selbst – Sie haben falsch gespielt!«
Da klatschte eine schallende Ohrfeige in sein Gesicht.
Der Bandit torkelte bis zur Tür zurück.
Damned, nie und nimmer hätte er diesem Dandy eine solche Schlagkraft zugetraut.
Der entsprungene Sträfling sah die anderen Männer in der Schenke an.
»Well, ich verstehe!« stieß er heiser hervor.
»Sie verstehen gar nichts!« entgegnete Holliday schroff.
»Doch, genug, um einzusehen, daß ich ein Riesenochse war, mit Ihnen zu spielen. Das da sind Ihre Freunde, und…«
Holliday warf einen kurzen ironischen Blick zur Tür.
»Meine Freunde?« Er lachte leise und bitter in sich hinein. »Die Boys dort sind so wenig mit mir befreundet wie Sie, Amigo!«
Hardac schrie: »Dreckskerl! Falschspieler…!«
Da blinkte der Colt wieder in der Rechten des Georgiers.
»Noch ein Wort, Bandit – und du rührst keine Spielkarte mehr an!«
Bandit!
Das Wort war dem Verbrecher bis in die Nerven gedrungen. All thousand devils and dogs! Was hatte der Mann da gesagt? Bandit?
Holliday ließ den Revolver verschwinden.
Hinter Hardac war ein Mann in der Tür erschienen. Er war groß, breitschultrig, trug eine schwarze Hose und eine kurze schwarze Weste über seinem grauen Hemd. Links auf seiner Weste blinkte der Fünfzack im Wappen, das Zeichen eines US Deputy Marshals.
Virgil Earp hatte das Geschrei Hardacs bis auf die Straße gehört. Langsam schob er sich an dem Desperado vorbei in den Schankraum.
»Was gibt’s hier?« fragte er ruhig.
Beim Klang dieser Stimme warf der Verbrecher den Kopf herum. Heavens, war das nicht die Stimme jenes Mannes gewesen, der ihn gestellt hatte, damals, oben in Kansas? Der ihm zu dem höllischen Job in Forth Worth verholfen hatte?
Im ersten Moment, als Hardac den Marshal ansah, schrak er bis ins Gebein zusammen. Aber dann wußte er, daß dieser Mann nicht Wyatt Earp war.
Es mußte Virgil Earp sein.
»Dieser Mann da hat falschgespielt, Marshal!« krächzte Hardac gallig.
Virgil rieb sich das Kinn.
»Das ist eine schwere Beschuldigung, Mister«, entgegnete er ruhig. »Vielleicht sollten Sie sich auf Ihren Gaul setzen und davonreiten. Tucson beispielsweise ist auch eine schöne Stadt, oder besser noch Prescot!«
»Nein, ich werde euch nicht den Gefallen tun, zu verschwinden!«
»Und?« Der Deputy Marshal sandte ihm einen ärgerlichen Blick zu. »Haben Sie nicht das Gefühl, Mister, daß Sie damit vor allem sich selbst einen Gefallen tun würden?«
Jack Hardac erkannte die Gefahr noch immer nicht, in die er sich da offenen Auges begeben hatte.
»Nein!« zeterte er. »Ich habe ganz und gar nicht dieses Gefühl. Im Gegenteil. Ich denke nicht daran, euren Trickspieler hier zu schonen. Er hat mich…«
Hollidays Gesicht war wie zu Eis erstarrt. Er hatte einen schnellen Schritt auf Hardac zugemacht.
»Sprechen Sie nur weiter, Mister.«
Der Bandit wich zur Seite.
»Da, Marshal, sehen Sie selbst, er bedroht mich. Er hat mich betrogen, indem…«
Holliday schoß dem Gesetzesmann einen raschen Blick zu.
Und Virgil Earp verstand.
»Sie dürfen diese Beschuldigung nun nicht noch einmal wiederholen, Mister«, sagte er rauh. »Diesen Mann hier kennen wir. Wir wissen, daß er es ganz sicher nicht nötig hat, falschzuspielen…«
»So, ihn kennen Sie? Das kann ich mir denken. Wahrscheinlich bringt er der Stadt eine Menge Geld mit seinen Kunststücken ein…«
Da schoß die Hand des Marshals vor. Er packte den Tramp an der Weste und riß ihn zu sich heran.
»Schluß jetzt, Junge. Ich habe weder Lust noch Zeit, mich hier mit dir abzugeben. Wenn du keine Ruhe geben willst, sperre ich dich ein. – Dieser Mann da ist Doc Holliday. Jeder Junge in der Stadt weiß, daß er einer der größten Kartenspieler des Westens ist. Daß du es nicht wußtest, war dein Pech! Und nun hör genau zu: Du verschwindest jetzt augenblicklich aus der Stadt, sonst sperre ich dich ein.«
Jack Hardac war zurückgewichen. Aus spaltenengen Augen musterte er den Spieler.
War er denn blind gewesen? Völlig blind? Natürlich war dieser Mann da Doc Holliday! Und er hätte es ahnen müssen, wenn er es schon nicht wußte.
Doc Holliday! Dieser Name jagte ihm einen eisigen Schauer über den Rücken. Er senkte den Kopf und wandte sich langsam zum Gehen.
Schweigend ließ der Deputy Marshal ihn ziehen.
Hardac trottete auf die Straße hinaus.
Glühend sprang ihn die Hitze wieder an und trieb ihm den Schweiß aus allen Poren. Er wischte sich über die Stirn und flüsterte die beiden Wörter vor sich hin:
»Doc Holliday!«
Wie war er nur hierhergekommen?
Wie hatte er nur so verrückt sein können, ausgerechnet in diese Stadt zu reiten!
Doc Holliday!
Wie ein Alpdruck lastete dieser Name auf ihm. Er dröhnte ihm im Schädel wie ein nicht endenwollendes Echo.
»He!« rief es ihn da von der anderen Straßenseite an.
Hardac blickte auf.
Er brauchte eine halbe Minute, bis er sich auf das Gesicht des Mannes da drüben besinnen konnte.
Es war der fahlgesichtige, kinnbärtige, schwammige Bursche mit dem Sheriffstern.
Damned! Was bedeutet das?
Hardac hielt auf ihn zu.
»Da drinnen ist Virgil Earl. Und wer sind Sie?«
Der korrupte Sheriff, der seine Existenz in dieser Stadt einem unheilvollen Irrtum des Districts-Sheriffs verdankte, lächelte ölig.
»Ich bin Jonny Behan. Yeah, wir haben hier außer mir auch noch ein Office mit einem US-Sternträger. Ziemlich überflüssig, nicht wahr?«
Daß er in Wirklichkeit der völlig Überflüssigste war, schien dem üblen Menschen, der sich nicht scheute, insgeheim mit einer Bande von Verbrechern zusammenzuarbeiten, gar nicht klar zu sein.
Hardac wandte sich um.
Drüben stand Virgil Earp; die bastgeflochtene Pendeltür schwang hinter seinem Rücken aus.
Und oben, auf dem Vorbau hinter Hardac, entfernten sich Schritte.
Der entsprungene Sträfling brauchte sich nicht erst umzusehen, um sich davon zu überzeugen, daß der ›wichtige‹ Hilfs-Sheriff Behan von Tombstone das Hasenpanier ergriffen hatte.
»Selbst auf die Möglichkeit hin, daß der liebe Jonny Ihnen einen Job angeboten hat, Mister, muß ich bei meinem Entscheid bleiben: »Holen Sie Ihren Gaul und verschwinden Sie.«
Von der einen Stunde, die der entsprungene Flüchtling Hardac noch als freier Mann zu verleben hatte, war bereits die Hälfte verstrichen. Aber auch die andere Hälfte war mit Ereignissen erfüllt.
Jack Hardac senkte den Kopf unter dem Blick Vergil Earps und schob davon.
In der Rage hatte er die falsche Richtung eingeschlagen und sich nach Norden statt nach Süden gewandt.
Er kam in die Fremontstreet und stampfte sie hinunter.
Vor dem Eingang eines großen Wagenabstellplatzes, der auf einem in die Straße hinausragenden Holzschild die Bezeichnung OK Corral trug, stand ein etwa sechzehn- oder siebzehnjähriger Bursche mit langem ungescheiteltem Haar, olivbraunem Gesicht und dunklen Augen. Er trug abgewetzte Weidereiterkleidung und hatte tief über dem rechten Oberschenkel einen Revolver im Halfter stecken.
Dieser Bursche war Billy Clanton, der jüngste der berüchtigten Clanton-Brüder, die zwanzig Meilen vor der Stadt eine Ranch hatten.
Hardac hatte jetzt erst bemerkt, daß er auf dem falschen Weg war. Er wandte sich an den Burschen und fragte nach dem Nelly Cashman House.
Der Bursche, der einen Zigarettenstummel im Mundwinkel hielt, wies über die rechte Schulter.
»Sie können hier durch den Corral gehen, Mister. Da kommen Sie auf die Allenstreet. Da fragen Sie noch einmal.«
Der Oregon Man nickte mit mürrischem Gesicht und durchmaß den Platz, der in weniger als in einem Vierteljahr durch das blutige Gefecht der Earp-Brüder gegen die Clantons berühmt werden sollte.
Jack Hardac hatte die Mitte des Hofes eben erreicht, als ein Reiter in den Eingang gesprengt kam. Es war ein großer Mann, sehr schlank und mit verschlagenem Gesicht.
Es war Phin Clanton, Billys älterer Bruder.
»He, Bill«, schnauzte er den Bruder an, »wie kommst du dazu, den Burschen hier durchlaufen zu lassen?«
Billy schnaufte und zog sich den Hut tief in die Stirn.
»Er fragte nach dem Cashman House…«
»Ist das vielleicht ein Grund, irgendeinen hergelaufenen Kerl hier durchstolpern zu lassen?«
Der Bursche versetzte wütend einem faustgroßen Stein einen Tritt, daß dieser weit über die Straße flog.
»Gehört dieser Platz eigentlich uns?« fragte er ärgerlich.
Phin rutschte aus dem Sattel.
»Nein, das ist auch gar nicht nötig Wir stellen seit Jahr und Tag hier unsere Gäule ab, wenn wir in der Stadt sind, und nicht selten unsere Wagen.«
»Das tun andere Leute auch«, beharrte der Bursche. »Vielleicht hat er auch einen Wagen hier oder einen Gaul.«
Phin stemmte die Fäuste in die Hüften.
»Ach, das ist also möglich? Und darf ich vielleicht fragen, weshalb Ike dich hier ans Tor gestellt hat? Solltest du nutzloser Bursche die Leute nicht hier wegschicken?«
Da warf Billy den Kopf herum und tippte sich unmißverständlich an die Stirn.
»Ihr seid ja alle übergeschnappt«, knurrte er. »Der Corral gehört doch nicht uns. Hier kann jeder für ein paar Cents seinen Gaul unterstellen. Und nicht nur der großspurige Ike Clanton.«
Phins Augen bildete jetzt schmale Schlitze.
»Sag mal, was fällt dir verdammten Kröte eigentlich ein, he? Mir scheint, daß du nach einer Tracht Prügel schreist.«
Da fuhr die Rechte des Burschen zum Revolverkolben.
»Du solltest es wagen, mich noch einmal anzufassen.«
Phin war ein hinterhältiger Bursche. Ein faunisches Lächeln kroch über sein Kreolengesicht. Er winkte ab und meinte: »Du bist ein kleiner starrsinniger Bursche, Billy. Ich glaube ganz sicher, daß du eines Tages genauso sein wirst wie Ike.«
Und da hatte der listige Phin den Nagel auf den Kopf getroffen. Der große Bruder Ike war Billys heimliches Vorbild. Er bekrittelte ihn zwar immer laut, bewunderte ihn aber insgeheim sehr. Und, daß er einmal ein Mann wie Ike werden würde, war der Lebenstraum des kleinen Cowboys Billy Clanton, der fast auf der gleichen Stelle, auf der er jetzt stand, ein knappes Vierteljahr später die tödliche Kugel bekommen sollte.
Jack Hardac hatte dem Gespräch der beiden Brüder aufmerksam zugehört. Das waren also die Clantons. Jedenfalls zwei von ihnen. Hardac hatte schon vor Jahren von ihnen gehört und wußte genau, daß sie die verschworenen Feinde Earps waren.
Ein übler Gedanke hatte sich in sein Verbrecherhirn eingeschlichen. War das nicht die Gelegenheit, von der er jahrelang drüben in Fort Worth geträumt hatte? Bot sich ihm da nicht vielleicht die einmalige Chance, mit dem verhaßten Mann abzurechnen, der ihn gestellt hatte?
Langsam ging der Mörder Hardac auf den Rancherssohn Phin Clanton zu, der im Grunde auch nichts weiter war als ein Desperado, ein Bandit, der drüben in Mexiko Rinder stahl und der zusammen mit der Crew seines Bruders das ganze County unsicher machte.
»Mein Name ist Gilbert, Mr. Clanton. Es freut mich, Sie kennenzulernen.« Er streckte Phin die Hand entgegen, die der jedoch übersah.
»Was wollen Sie?«
»Ich glaube, Mister, daß wir ein paar gemeinsame Freunde haben.«
»Kann ich mir nicht vorstellen«, entgegnete Phin lauernd.
»Sie werden gleich anderer Ansicht sein«, schnarrte Hardac, während er sich eine Zigarette drehte.
»Und?« fragte Phin schließlich, der seine Neugierde nur schwer zurückhalten konnte.
Hardac lächelte melancholisch.
»Einer meiner Freunde ist Virgil Earp«, begann Hardac vorsichtig. Als er es in Phins Gesicht aufblitzen sah, fuhr er rasch fort: »Die beiden wichtigsten aber sind Wyatt Earp und Doc Holliday.«
Hardac spürte genau, daß er richtig getroffen hatte.
Phin wischte sich über den Mund und musterte den Fremden forschend.
»Yeah«, krächzte er schließlich, »wir scheinen tatsächlich ein paar gemeinsame Freunde zu haben, Gilbert.«
Dann streckte Phin die Hand nach Hardacs Tabakzeug aus.
Der reichte es dem neuen Kumpan bereitwillig.
Billy lehnte vorn am Eingang.
»Ich will Ihnen keine Ratschläge geben, Mr. Gilbert, aber wenn Sie klug sind, nehmen Sie Ihren Gaul und reiten Sie weiter.«
Der Verbrecher wandte sich nach dem Burschen um.
»Diesen Satz habe ich heute schon einmal gehört«, sagte er böse. »Es war Virgil Earp, der mir diesen Rat glaubte geben zu müssen.«
»Ein guter Rat«, knurrte der Bursche, »so leid es mir tut.«
Phin stieß einen Fluch aus.
»Ich habe dir schon öfter gesagt, daß du dein dummes Maul halten sollst, Billy«, schnauzte er den Bruder an.
»Ja, ja«, murmelte der Junge, »ich weiß, ich bin ein Idiot. Ein wahres Glück für Ike, daß er noch einen so klugen Bruder hat wie dich.«
Während Phin sich die reichlich krumme Zigarette zwischen seine Zähne steckte, antwortete er ohne Ernst:
»Ich sollte dir das Maul stopfen.« Dann wandte er sich an Hardac. »Sie hatten einen Gang mit Virgil?«
»Yeah, mit ihm und mit dem Spieler. Holliday pöbelte mich drüben im Crystal Palace an, und dann kam noch sein Freund mit dem Stern dazu.«
Der Verbrecher hütete sich, die wahren Gegebenheiten dem anderen auf die Nase zu binden. Und der gerissene Phin hatte bereits eine Idee, wie er den Zorn des Fremden auf die Earps ausnutzen konnte.
»Drüben im Spanischen Haus ist gleich eine Verhandlung gegen Eddie Claiborne. Sie kennen Ed doch sicher. Ist ein netter Kerl, aber Virgil Earp paßt er nicht in den Kram, und deshalb versucht er, ihm einen Strick zu drehen. Er behauptet, daß Ed an dem Überfall auf die Wells Fargo-Kasse vor einer Woche beteiligt gewesen sein soll…« Ein lauernder Blick traf Hardac. »Ich müßte mich gewaltig täuschen, Mister, wenn Sie nicht vor einer Woche oben in Prescott gewesen wären und bezeugen könnten, daß Ed sich da aufgehalten hat.«
Hardac verstand sofort. »Sie täuschen sich nicht, Phin, ich war zufällig genau vor einer Woche oben und habe Ed in Prescott gesehen.«
Phin Clanton warf seinem Bruder einen triumphierenden Blick zu.
Der im Grunde seines Wesens mit guten Anlagen ausgestattete Billy Clanton schüttelte den Kopf und verließ den Corral.
Hardac begleitete Phin zum Spanischen Haus.
Seine Freiheit dauerte jetzt noch genau zehn Minuten.
Als er die Vorbautreppe hinaufstieg, sah er ein lackglänzendes Stiefelettenpaar vor sich. Er hob den Blick und sah in die kühlen Augen Doc Hollidays.
In diesem Moment hätte Hardac sein Geschick noch zu wenden vermocht.
Er war stehengeblieben.
Aber Phin, der hinter ihm auf der Treppe war, stieß ihn an.
»Vorwärts!«
Hardac ging weiter.
Und Doc Holliday wich keinen Zoll.
Hardac blieb einen Yard vor ihm erneut stehen. Er spürte den Stoß seines neuen Verbündeten im Kreuz, rührte sich aber nicht von der Stelle.
Der Spieler zündete sich eine Zigarette an.
Hardac blickte nach rechts – und sah in das Gesicht Virgil Earps.
Da wandte er sich nach links.
Er blieb neben dem Eingang des Spanischen Hauses stehen.
Phin raunte ihm zu: »Ich dachte schon, Sie hätten sich die Story ausgedacht. Wär Ihnen übrigens nicht gut bekommen. – Well, jetzt weiß ich, daß die Schufte tatsächlich scharf auf Sie sind. – Aber weshalb sind Sie dem Georgier ausgewichen? So etwas können wir uns hier nicht erlauben.«
Der Vorwurf trieb Hardac die Zornesröte in die Stirn. Er warf den Kopf herum und schoß dem neuen Genossen einen wütenden Blick zu.
»Was hätten Sie denn an meiner Stelle getan, Phin, he?«
»Er wäre zurückgegangen!« Klirrend kamen die Worte von der Stelle her, an der der Spieler stand.
Die beiden fuhren zusammen.
Phin ballte die Hände, schwieg aber.
Und Hardac war immerhin frech genug, herausfordernd über das Vorbaugeländer auf die Straße zu spucken.
Phin kochte vor Wut. Als er drüben aus dem Oriental Palace den bulligen Curly Bill im schreiendroten, vorn über der haarigen Brust offenstehenden Hemd kommen sah, schob er sich neben Hardac ans Geländer und brüllte:
»Komm herauf, Bill. Hier gibt’s Leute, die offensichtlich der Hafer sticht.«
Aber Phin Clanton hätte wissen müssen, daß es keinen kälteren Mann gab als Doc Holliday.
Der Spieler trat vor die Treppe und blickte auf Curly Bill Brocius hinunter, der sich eben der Treppe zugewandt hatte.
»Yeah, kommen Sie herauf, Brocius. Sie haben hier in der Sammlung noch gefehlt!«
Curly Bill war stehengeblieben. Er hatte den Georgier erst jetzt entdeckt. Und noch brannte die Wunde in seinem Arm, die ihm die Kugel des Spielers bei der Schießerei vor zwei Monaten gerissen hatte.
Er blieb unten.
Deprimiert starrte Phin auf ihn herab.
»Feigling!« knurrte er tonlos.
Aber gleich darauf sollte der zweite Clanton Brother Gelegenheit haben, einen Jubelschrei auszustoßen.
Zwei Reiter ritten von Westen her in die Allenstreet. Große, kräftige Gestalten mit schwarzem Haar und dunklen verwegenen Gesichtern. Der ältere von ihnen trug einen Knebelbart.
Ihre Namen waren kaum weniger berüchtigt und gefürchtet als der von Ike Clanton.
Es waren die beiden McLowerys.
Tom, der jüngere, rutschte sofort vom Pferd, nahm den Zügel, den sein Bruder Frank ihm zuwarf, und führte die beiden Gäule an die Halfterstange.
Wie ein Großrancher schritt der Desperado Frank McLowery auf die Vorbautreppe des Spanish House zu.
Doc Holliday stand immer noch oben vor der letzten Stufe.
Frank starrte auf seine Stiefel und hielt plötzlich inne. Dann sah er sich nach seinem Bruder um.
»Wir werden uns erst drüben im Oriental Saloon mit einem Schluck stärken, Tom«, sagte er so laut, daß es jeder auf dem Vorbau und der Straße hören konnte. »Es war verdammt heißt unterwegs!«
Hardacs Blick flog zu Doc Holliday hinüber. Er gewahrte das winzige spöttische Lächeln, das sich um den Mund des Spielers gegraben hatte.
Da flammte eine rasende Wut auf diesen Mann, dessen Gefährlichkeit er noch keineswegs voll erfaßt hatte, in ihm hoch, und er brüllte:
»Sie kehren wieder um, weil der geschniegelte Holliday hier oben steht. Was findet ihr nur an diesem elenden Halun…«
Er kam nicht weiter.
Mit gläsernem Blick stierte er auf den Reiter, der plötzlich drüben in der Mündung der zweiten Straße hielt.
Es war ein sehr großer, breitschultriger Mann mit wetterbraunem Gesicht und leuchtenden blauen Augen. Ein tiefer Ernst lag auf diesem edelgeschnittenen markanten Männergesicht. Unter der Krempe des flachkronigen schwarzen Hutes blickte dunk-les Haar hervor. Seine Hose war schwarz und sauber, trotz des pulverfeinen gelben Sandstaubes, der hier alles mit einer ständigen Puderschicht bedeckte.
Das Hemd des Reiters war weiß und wurde oben am Hals unter dem sauberen Kragen von einer schwarzen Samtschleife zusammengehalten.
Links auf der kurzen schwarzen Weste war deutlich ein dunkler Fleck zu sehen, über dem mit Gewißheit lange Zeit ein metallener Stern gesteckt hatte. Unter seinem Gürtel saß ein breiter büffellederner Waffengurt, der mit Patronen gespickt war und an beiden Seiten je einen großen Revolver hielt. Die Waffe an der linken Seite mußte, wie die Halfterlänge verriet, einen überlangen Lauf haben.
Der Reiter saß auf einem Schwarzfalben, einem herrlichen kurzrumpfigen, hochbeinigen Tier, dessen ganzer Körperbau nicht nur die edle Rasse, sondern auch, was für dieses Land wichtiger war, den ausdauernden, sehr schnellen Läufer verriet.
Nicht nur Hardacs Blick haftete auf der Gestalt des Reiters. Auch die Augen der anderen Männer, die sich in diesem Augenblick in dem Brennpunkt der Stadt befanden.
Die Gespräche der Männer auf den Vorbauten und unten auf der Straße waren für einen Augenblick fast völlig verstummt. Dann tuschelten sie weiter. Und es gab in diesem Moment nur ein Thema: das Auftauchen dieses Mannes da drüben.
Sein Anblick faszinierte sie alle.
Aber einem raubte er fast den Atem: Jack Hardac.
Tonlos formten seine trockenen Lippen einen Namen:
»Wyatt Earp!«
Und dann rissen dem ausgebrochenen Mörder die Nerven. Er warf sich zur Seite, zerrte seinen Colt aus dem Halfter und…
… Doc Hollidays Stiefelspitze hieb ihm die Waffe kurz vor dem Auslösen des Schusses aus der Hand.
Wyatt war aus dem Sattel gerutscht, warf die Zügelleinen drüben über einen Querholm und kam mit harten sporenklirrenden Schritten auf den Vorbau zu.
Jack Hardac hatte die schmerzende Rechte an seine Brust gepreßt und starrte dem Marshal mit flimmernden Augen entgegen. Nur ein Gedanke beherrschte jetzt noch sein Hirn: Vielleicht erkennt er mich gar nicht! Er darf mich nicht erkennen!
Aber die Zeit des entsprungenen Lebenslänglichen aus Fort Worth war abgelaufen. Sein Mummenschanz bestand nicht vor den eiskalt forschenden Augen des Missouriers.
»Komm runter, Hardac!« drang es metallen an sein Ohr.
Für drei Sekunden war der Verbrecher wie gelähmt, mehr vom Klang dieser Stimme als von der Bedeutung dieser Worte.
Dann raffte sich der Bandit zu einer Verzweiflungstat auf, warf sich zurück, riß Phin Clantons Revolver aus dem Halfter – und stierte mit blöden Augen in die Revolvermündung des Georgiers.
Noch hatte er den Revolver Phins in seiner Hand!
»Zwing mich nicht zu schießen!« mahnte ihn der Spieler.
»Nein, Doc – ich soll dich nicht zwingen. Und zu was zwingst du mich jetzt? Der Marshal? He? Er zwingt mich zurück ins Lager – und da zwingen sie mich an den Galgen! Ist das vielleicht besser? He? Schießt du mich da nicht lieber über den Haufen, Doc…«
Blitzschnell jumpte der Marshal übers Vorbaugeländer und hieb dem unseligen Menschen die Waffe aus der Hand.
Zwei Revolver lagen am Boden.
Und Jack Hardac, der Mörder aus Oregon, war erledigt.
Wyatt packte ihn am Arm und führte ihn auf die Straße.
Da brüllte Frank McLowery, der dem Vorgang die ganze Zeit über scharf gefolgt war:
»Er hat schon wieder einen armen Teufel geschnappt, der große Earp! Bravo!«
Wyatt ging weiter.
Und Tom, der jüngere McLowery, schrie. »Was hat der Mann denn getan, he? Vielleicht erklären Sie uns das mal, Wyatt! Sie können doch nicht einfach hier unsere Freunde…«
Der Missourier war stehengeblieben.
Aus kalten Augen maß er den jüngeren McLowery.
»Freunde? Ist dieser Mann Ihr Freund, Tom McLowery?« fragte er klirrend.
Der Desperado biß die Lippen zusammen. Er atmete auf, als er drüben aus Harry Kuhns Spielsaloon einen Mann kommen sah, den die ganzen Earp-Gegner jetzt geradezu herbeigesehnt hatten.
Es war der unversöhnlichste und auch gefährlichste Feind, den der Missourier und seine Helfer je gehabt hatten.
Ein großer schwerer Mensch, der dennoch einen elastischen, kraftvollen Schritt hatte. Sein Gesicht war nicht häßlich: kantig, olivfarben und dunkeläugig. Er trug sich wie ein Vormann, hatte eine stolze Haltung und war sich seiner Bedeutung in dieser Stadt offensichtlich bewußt.
Ike Clanton!
Langsam kam er auf die Straße und stellte sich Wyatt und dem Fort Worth-Sträfling in den Weg.
Wyatt ging unbeirrbar weiter.
Da warf der Boß der Clanton-Gang den Kopf ins Genick und wandte sich mit der Gebärde eines raffinierten Schauspielers an die Männer auf den Vorbauten.
»Was denkt ihr, Leute? Sollte uns der Marshal nicht wenigstens verraten, welchen armen Teufel er da wieder am Kragen hat?«
Wyatt blieb mit einem Ruck stehen.
»Armen Teufel? Dieser Mann ist ein mehrfacher Mörder und vor fast einem Monat aus Fort Worth entsprungen, wo er im Camp der Lebenslänglichen saß!«
Phin Clanton beugte sich weit über den Vorbau.
»Das ist eine dreiste Lüge! Der Mann ist mein Freund und heißt Jeff Gilbert!«
Eine helle spöttische Jungenlache kam von einer gegenüberliegenden Vorbautreppe. Da saß der kleine Billy und stützte den Kopf in die Hände.
Ike schoß dem Burschen einen bösen Blick zu und winkte seinem etwas einfältigen Bruder Phin herrisch zu, zu verschwinden.
»All right, Marshal!« sagte er ironisch, »dann führen Sie den Mann ab! Und – meinen Glückwunsch zu der Prämie!«
Da stampfte Virgil vom Vorbau hinunter.
»Niemand hat eine Prämie auf den Kopf dieses Verbrechers gesetzt, Mr. Clanton! Nur damit Sie Bescheid wissen! Aber vielleicht nehmen Sie meinem Bruder mal die Arbeit ab und schaffen dieses Scheusal hinüber nach Texas!«
Das saß. Ike wandte sich ab und ging in den Spiel-Saloon zurück.
Der Missourier brachte den Gefangenen ins Jail des Marshals Office.
Virgil kam mit.
Doc Holliday blieb als einziger Verbündeter der Earp-Seite am Spanish House zurück und wohnte auch der Verhandlung bei.
Ed Claiborne wurde übrigens der Tat überführt. Wyatt Earp, der eine Viertelstunde später kam, hatte ihn am fraglichen Tag am Südrand Tombstones getroffen. Und plötzlich gab es auch andere Leute, die den Banditen bei der Stadt gesehen hatten.
*
Am Abend saßen die Earps im Office.
Doc Holliday saß im Crystal Palace und spielte.
Alles war wie immer.
Virgil blickte den Bruder an.
»Ihr wollt also morgen wieder weg?«
»Wer?«
»Du – und Holliday.«
»Wie kommst du darauf?«
»Der Doc sagte, daß er wegwolle. Und da er ja wohl kaum allein zurück nach Dodge reitet…«
»Weshalb nicht? Das hat er schon öfter getan.«
Virgil stand auf und ging zum Fenster.
»Hier braut sich was zusammen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich fühle es.«
Wyatt erhob sich ebenfalls und zündete sich eine seiner schwarzen Zigaretten an.
»Ich reite nicht nach Dodge. Ich werde erst Hardac nach Worth zurückbringen.«
Virgil wandte den Kopf zur Seite und sah den Bruder an.
»Weshalb? Sie sollen einen Sheriff schicken oder zwei Leute vom Wachpersonal, die ihn holen kommen. Solange sitzt er bei mir fest.«
Der Marshal schüttelte den Kopf.
»Nein. Ich werde ihn zurückbringen. Der Mann ist ein Teufel und kann gar nicht schnell genug wieder hinter Schloß und Riegel sitzen.«
Virgil, der den Bruder gern noch in Tombstone gewußt hätte, fragte:
»Und von Worth aus reitest du nach Dodge City?«
»Ich muß. Schließlich habe ich da einen Job.«
Virgil nickte langsam und atmete schwer. Er wußte ja, daß der Bruder oben in Kansas den Stern trug und ganz sicher nicht weniger Arbeit und Sorgen am Hals hatte als er selbst.
Aber es war etwas hier in dieser verteufelten Stadt, das auf ihn zukam, etwas Bedrohliches, das greifbar in der Luft zu liegen schien und doch nicht zu packen war. Es würgte ihm zuweilen in der Kehle, wenn es ihn anfiel.
War es die Vorahnung dessen, was in den späten Oktobertagen die Stadt aufwühlen würde? Jene Ereignisse, die einen schwarzen Schatten über die Stadt breiten würden, der nie mehr von ihr weichen würde…?
*
In der Frühe des nächsten Tages machte sich Wyatt auf den Weg nach Osten.
Neben ihm ritt der an den Händen gefesselte entsprungene Sträfling Jack Hardac.
Bereits zwei Stunden waren die beiden so verschiedenen Männer schweigend nebeneinander hergeritten, als Hardac plötzlich knurrte:
»Weshalb haben Sie den Doc gehindert, mich niederzuschießen?«
»Er hätte Sie nicht niedergeschossen. Außerdem hätte ich so etwas auf jeden Fall verhindert.«
»Weil Sie mich um jeden Preis hängen sehen wollen?« keuchte der Mörder.
Der Marshal schüttelte den Kopf.
»Irrtum, Hardac. Weil das Gesetz es so befiehlt!«
»Phih! Sie sind ein sturer Kerl! Aber was wollen Sie: In Worth werden Sie mich sofort hängen.«
»Das weiß ich nicht.«
»Aber ich.«
»Und weshalb wollen Sie sich der Strapaze unterziehen, mich mehrere hundert Meilen durch den glühenden Sand nach Texas hinüber zu schleifen, nur um mich den Henkersknechten auszuliefern, die mich aufknüpfen werden.«
»Ich sagte Ihnen schon, daß es meine Pflicht ist.«
Der Oregon Man schüttelte den Kopf.
»Nein, das ist nicht mehr Ihre Pflicht, Marshal. Well, Sie haben mich gestellt. Alles andere ist nicht mehr Ihre Aufgabe. Sie könnten veranlassen, daß mich ein Staatenreiter zurück ins Straflager bringt oder daß zwei oder drei Posten geschickt werden.«
»Yeah, das könnte ich, aber dann würde ich die Gefahr mit in Kauf nehmen müssen, daß Sie wieder entkommen und neues Unheil anrichten.«
Wyatt schwieg nun auf jede weitere Frage des Verbrechers. Er war ein stiller Mann, der es nicht liebte, sich unterwegs zu unterhalten. Schon gar nicht mit einem Menschen wie diesem Jack Hardac!
*
Dreiundzwanzig Meilen östlich von Tombstone geschah es.
Mitten in einer Felsenge stand plötzlich ein Reiter auf dem Weg.
Frank McLowery!
Der knebelbärtige Desperado hatte sich aufs Sattelhorn gestützt und blickte dem Marshal feixend entgegen.
Wyatt hielt augenblicklich, packte plötzlich die Zügel von Hardacs Pferd, gab seinem Falben die Sporen und wich in eine kluftartige Gesteinsnische aus.
»Gib dir keine Mühe, Earp!« brüllte Frank McLowery. »Du bist umzingelt!«
Wyatt stieß den Gefangenen dicht an die Felswand, nahm seinen Revolver aus dem Halfter und lauschte.
Es blieb eine Weile still.
Da dröhnte die Stimme Franks durch die Felsenge:
»Gib den Gefangenen raus, Earp! Dann kannst du weiterreiten.«
Wyatts Gesicht blieb ruhig. Er antwortete nicht.
Dafür aber antwortete Jack Hardac.
Er stieß einen Jubelschrei aus und seine Augen leuchteten.
»Haut mich raus, Leute. Ihr sollt es nicht umsonst getan haben! Vorwärts, keine Scheu! Drescht den verdammten Sternträger nieder!«
Wyatt riß ihn mit der Rechten aus dem Sattel und stieß ihn zu Boden.
»Ein Wort noch, Hardac, dann brauchst du weder diese Banditen noch einen Strick!«
Bebend vor Angst und Zorn stierte der Desperado den Gesetzesmann an.
»Das werden Sie zu bereuen haben!«
»Sei still!«
»Gib den Gefangenen raus, Earp!« forderte McLowery den Missourier erneut auf.
Dann blieb es still.
Auch Hardac wagte nicht mehr, einen Laut von sich zu geben.
Zehn Minuten mochten verronnen sein, als das scharfe Ohr des Marshals ein winziges scharrendes Geräusch vernahm.
Wyatt wußte sofort, daß es oben von dem Felsvorsprung über ihm herkam.
Er preßte sich dicht an die Wand und lauschte weiter.
Hardacs Atem ging keuchend. Er hatte das Geräusch zwar noch nicht vernommen, erwartete aber jede Sekunde einen Angriff der McLowerys.
Jetzt hatte auch der Verbrecher das Geräusch gehört. Er sah sich nach dem Missourier um.
Da er jedoch in dessen Gesicht nichts von einer derartigen Entdeckung lesen konnte, feixte er höhnisch vor sich hin.
Da, das Geräusch war jetzt ganz nahe.
Und plötzlich federte der Marshal nach vorn, warf sich in einer halben Pirouette hoch, und sein schwerer sechskantiger Revolver, den er in der linken Faust hatte, blitzte zweimal auf.
Zwei Gestalten rutschten wie leblose Puppen von dem Felsvorsprung und blieben reglos auf dem kleinen Plateau vor der Nische liegen.
»Earp!« schrie Frank McLowery nach diesem mißlungenen Angriff. »Du hast trotzdem keine Chance. Wir sind sechs Leute! Rück den Gefangenen raus, dann kannst du machen, daß du wegkommst!«
Aber der Marshal schwieg.
Und diesmal dauerte es fast eine Viertelstunde, bis wieder ein winziges Geräusch an das Ohr des Missouriers drang.
Jetzt kam es von links, daher, wo Frank McLowery vorhin mit dem Pferd gehalten hatte.
Wyatt wartete in gelöster Ruhe, ohne jede Verkrampfung.
Und dann geschah es urplötzlich.
Ein blondhaariger Bursche sprang plötzlich mit zwei federenden Riesensätzen vor die Nische und riß eine Schrotbüchse hoch.
Aber die Kugel des Missouriers traf ihn wie ein Keulenschlag und schleuderte ihn zurück.
»Du hast den Platz schlecht gewählt, Frank!« rief Wyatt.
»Nein! Du sitzt in der Falle!« brüllte Frank. »Ich werde dich jetzt nämlich ausräuchern!«
Und schon flog von rechts ein rauchender pulvertrockener Mesquitestrauch vor die enge Nische.
Der Qualm zog in dicken Schwaden genau auf die Felsnische zu, in der die beiden Männer steckten.
Ätzend drang ihnen der Rauch in die Lungen.
Hardac wurde bald von einem scheußlichen Hustenanfall geschüttelt.
»Verdammt noch mal, wollen Sie mich etwa hier verrecken lassen, Earp?« keuchte der Bandit.
Wyatt beugte sich über ihn und schloß eine kurze Fußfessel um seine Beine. »Hier unten tief am Boden macht Ihnen der Rauch nicht viel aus.«
Dann richtete er sich auf und zwängte sich dicht an der Felswand entlang vorwärts auf die Passage zu.
»Frank, ich komme!«
»All right, Wyatt, es wird Zeit!«
Frank McLowery stand mit dem Gewehr oben über der Passage und wartete auf seinen Gegner, den er kaltblütig abschießen wollte wie einen Puma.
Wyatt hatte den Buntline Revolver in der Linken, bückte sich jetzt, packte einen Stein und schleuderte ihn in die Passage.
Sofort bellten vorn Gewehrschüsse auf.
Frank McLowery hatte sein Spiel noch nicht gewonnen; der Puma, den er in der Falle wähnte, war zu allem entschlossen.
Frank winkte seinem Bruder, der zwanzig Yards weiter westlich in den Steinen kniete, zu, tiefer herunterzuklettern, damit er die Felsnase, hinter der er den Marshal vermutete, ins Schußfeld bekäme.
Tom folgte dem Wink des älteren Bruders augenblicklich.
Aber er hatte nicht die Umsicht Franks, rutschte zu tief und landete geräuschvoll unter prallenden Stein-splittern unten in der Enge.
Wyatt federte sofort nach vorn, duckte sich und vermied so die beiden Kugeln, die Tom McLowery auf ihn abgab.
Dafür riß die Kugel aus dem Buntline den Outlaw sofort nieder.
Frank, der das genau hatte beobachten müssen, stieß einen wilden Schrei aus.
»Trotzdem bist du geliefert, Earp! Du kommst nicht aus der Passage heraus. Und wenn ich Tag und Nacht wachen müßte!«
»Was du nicht sagst!« ertönte es da messerscharf hinter ihm.
Der Bandit war wie zu Eis erstarrt. Erst nach drei Sekunden wandte er sich um.
Nur wenige Yards hinter ihm auf dem Gestein stand ein Mann, den er hier am allerwenigsten erwartet hätte:
Doc Holliday.
Der Spieler hatte in jeder Faust einen seiner gefürchteten Frontier-Revolver.
»Gib es auf, Frank. Es wäre schade, wenn Tom dich morgen schon im Graveyard einkarren müßte. – Du mußt nämlich wissen, daß dein lieber Bruder keineswegs schon in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Der Marshal ist eben zu menschlich!« Und in völlig verändertem Ton fuhr er fort: »Laß den Schießprügel fallen, Junge!«
Die Winchester glitt aus den rotbraunen Händen des Desperados.
Holliday trieb ihn hinunter in die Passage.
Wyatt, der jedes Wort dieser seltsamen Unterhaltung vernommen hatte und bereits zu einem tödlichen Kampf entschlossen gewesen war, warf dem Georgier einen kurzen Blick des Dankes zu und sah auf Tom McLowery nieder.
Die Kugel hatte den Desperado tatsächlich nur an der linken Schläfe gestreift.
Auch die anderen waren nicht tot. Aber ihre Verletzungen waren doch teilweise so schwer, daß sie sofort behandelt werden mußten.
Wyatt Earp sammelte zunächst alle Waffen ein, wickelte sie in eine Satteldecke und schnallte sie auf eines der Banditenpferde.
Dann zog er sich, nachdem er Hardac aufs Pferd gebracht hatte, in den Sattel.
»Über diese nette Überraschung unterhalten wir uns später, Frank!«
Damit nahm er die Zügel auf und ritt davon.
Doc Holliday stand noch vor den beiden McLowerys, hob den Blick von dem verletzten Tom und blickte in die Augen des älteren Banditen.
»Wenn ich der Marshal wäre, Brother, hätte ich dich jetzt an deinem verfilzten Knebelbart aufgehängt!«
Damit zog auch er sich in den Sattel und ritt, ohne die Tramps auch nur noch eines einzigen Blickes zu würdigen, hinter dem Marshal und dem Mörder Hardac her.
*
Abe Carruther lehnte über dem obersten Corralgatterbalken und blickte auf die beiden Braunen hinüber, die müde in der Morgensonne dösten.
Neun Jahre saß der einstige Overlanddriver schon auf dieser Station, hatte dafür zu sorgen, daß die Wechselpferde stets bereit waren, vor die von Osten oder auch von Westen kommende Kutsche gespannt zu werden.
Es war ein einsames Leben, das der fast siebzigjährige einstige Farmer aus Kentucky hier führen mußte. Aber er hatte keinen anderen Job finden können. Einen so alten Mann wollte niemand mehr aufnehmen. Und da er mehr als ein Vierteljahrhundert die Diligence durch dieses rauhe Land kutschiert hatte, war man bei der Wells Fargo einsichtig genug gewesen, ihm wenigstens diesen Posten hier zu geben, als seine Zeit gekommen war, den Kutschbock zu räumen.
Das Leben in der Einöde des südlichen New Mexico hatte den Mann, der an die wilden Fahrten jahraus – jahrein auf der Overland gewöhnt war, schneller alt werden lassen, als ihm lieb war.
Er haßte die Stille dieser endlosen Ebene. Er haßte die Lautlosigkeit, die einen zu erdrücken schien. Er haßte die Weite, die durch keinen Hügel, nicht einmal durch eine Baumgruppe unterbrochen wurde.
Nur ein paar Kakteen fristeten oben im Norden ihr kümmerliches Dasein. Aber ihr Anblick war nicht dazu angetan, das Blickfeld des alten Pferdewechselstation-Halters zu verschönern.
Und die Kutsche kam nur einmal innerhalb von acht Tagen auf dieser Route vorbei.
Acht Tage! Für den Mann, der es gewohnt war, jeden Tag mehrere Städte zu passieren, im wirbelnden Staub auf dem Kutschbock zu sitzen, der das Bild tanzender schweißglänzender Pferderücken gewohnt war, der heute noch die schweren Zügelleinen in seiner Rechten spürte, die Winchester in seiner Linken, der hinter jeder Wegbiegung mit einem Überfall gerechnet hatte – er zerbrach hier lautlos in der Einsamkeit dieses öden Landes.
Der alte Carruther hatte seine zwei Söhne in dem unseligen Krieg zwischen Süd und Nord verloren. Seine Frau war schon damals, kurz nach der Geburt ihres zweiten Jungen, bei einem Indianerüberfall in Fort Wilkins unten am Brazos ums Leben gekommen.
Dennoch hatte der alte Carruther die Rothäute nicht gehaßt. Er wußte ja, daß sie einen furchtbaren Verzweiflungskampf um ihre Existenz, um ihr Land und um ihr Leben ausfochten. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn dieses Land mehr Leute wie den alten Overlanddriver Abe Carruther gehabt hätte.
Der Alte hatte die beiden Braunen so gestriegelt, als ob die Overland jeden Augenblick drüben am Horizont in der üblichen Staubwolke auftauchen würde.
Aber sie war ja erst vor drei Tagen da und würde fünf weitere Tage auf sich warten lassen.
Damned, wie er dieses sinnlose Warten haßte. Sie hätten ihn auf dem Kutschbock lassen sollen. Aber Mr. Bancroft oben in Santa Fé hatte entschieden, daß kein Chief Driver mehr älter als sechsundsechzig sein sollte.
Dagegen war man eben machtlos.
Dabei war der alte Carruther fest davon überzeugt, daß er seinen Job noch so gut und sicher wie eh und je, zumindest noch für ein halbes Jahrzehnt, ausüben könnte.
Wenn sie ihn wenigstens noch in einer Stadt in eine Posthalterei gesteckt hätten.
Aber dazu war ihnen der einstige Driver wohl nicht fein genug. Das mußten ja jetzt schon alle junge Burschen sein, die gut schreiben, lesen, rechnen und obendrein noch Telegraphen bedienen konnten.
Plötzlich zog der Alte die silbergrauen Brauen zusammen.
Eines der beiden Pferde hatte die Ohren hochgestellt.
Jetzt auch das andere.
Abe Carruther wandte sich um.
Es war weit und breit nichts zu sehen.
Er schüttelte den Kopf und murmelte: »He, ihr müßt euch etwas anderes überlegen, ihr beiden Halunken, wenn ihr mich unterhalten wollt. Diese Kiste ist schon alt.«
Aber die beiden Tiere ließen die Ohren steil nach oben stehen, und die Stute neben dem Wallach schnaubte jetzt sogar leise.
Da ging der Alte auf das Haus zu, um zu sehen, ob vielleicht ausgerechnet in dem kleinen Winkel, der außerhalb seines Blickfeldes lag, irgend etwas auf die Station zukam.
Er hatte kaum die äußere Hauskante erreicht, als er auch schon stehenblieb.
Drei Reiter preschten in rasendem Galopp von hinten auf die Station zu.
Carruther war steif vor Verwunderung und Schreck.
Banditen! hämmerte es in seinem Schädel, das mußten Banditen sein!
Er lief, so schnell ihn seine gichtigen alten Beine noch tragen konnten ins Haus und holte seine alte Kentucky Rifle aus dem Ständer, lud sie durch und blieb hinter der kleinen schießschartenähnlichen Fensterluke stehen.
Das Hufgetrappel war bald zu hören.
Und dann schossen zwei Reiter um das Haus in den Hof.
Zwei!
Ein Glück, dachte der Alte, daß ich die Halunken noch frühzeitig genug gesehen habe. Er verließ seinen Posten und trat an ein offenstehen-
des Fenster auf der Rückseite das Station.
Direkt neben dem Fensterladen stand einer der Männer, mit dem Colt in der Hand.
Der alte Driver handelte schnell, riß den Gewehrlauf hoch und zog ihn dem Mann über den Schädel.
Dann trat er wieder vorn an die Luke.
Draußen konnte er jetzt nur einen der beiden anderen entdecken.
Aha, der zweite mußte also schon irgendwo am Hauseingang sein.
Carruther, erfahren im Umgang mit Tramps, wartete.
Da öffnete sich neben ihm die Tür – und gleich darauf sackte auch der zweite Tramp, von dem schweren Gewehrlauf getroffen, in sich zusammen.
Jetzt trat der Alte an die Tür. Das Gewehr im Anschlag.
»Hallo, Mister – was gibt’s denn Gutes?«
Der Mann wandte sich um. Er ahnte noch nicht, daß seine beiden Kumpane bereits einen Klaps mitbekommen hatten und augenblicklich aktionsunfähig waren.
Carruther spannte den Hahn.
»Hände hoch!«
Der Tramp nahm langsam die Hände in Schulterhöhe.
Carruther ging auf ihn zu, um ihm den Revolver aus dem Halfter zu nehmen.
Da, als der Alte bis auf anderthalb Yards heran war, riß der Bandit den Fuß hoch.
Der Tritt traf den Alten empfindlich und ließ ihn zu Boden gehen.
Noch im Fall feuerte er los.
Der Bandit bekam den Schuß in die Hüfte und torkelte gegen den Corral. Ehe er den Colt hochhatte, feuerte Carruther wieder.
Keuchend richtete sich der Alte auf und schwankte zum Haus.
Da lag der zweite Bandit noch. Carruther schlang ihm rasch mit geübten Griffen eine Handfessel und eine Fußfessel um und rollte ihn in eine düstere Ecke.
Dann sah er hinten zum Fenster hinaus. Damned – der Bandit, den er zuerst niedergeschlagen hatte, war verschwunden.
Carruther hatte jetzt den Revolver, den er dem Mann im Haus abgenommen hatte, schußbereit in der Rechten.
Die Schuhe hatte er abgestreift. Beinahe lautlos schlich er durch das Haus.
Da huschte vorn ein Schatten an einem der Küchenfenster vorbei.
Ah – jetzt war der Mann also im Bild. Er mußte seinen angeschossenen Kameraden am Corral entdeckt haben.
Carruther blieb lauschend neben der Tür zur Schlafstube stehen.
Die Minuten rannen dahin.
Draußen stieg die Sonne langsam dem Zenit entgegen und schleuderte eine wahre Höllenglut auf das Land.
Durch die Gardine konnte der alte Driver den Mann am Corral hocken sehen. Schweratmend hing er da, mit glasigen Augen.
Den anderen, den er in die Ecke gepackt hatte, konnte er ebenfalls von seinem Platz aus sehen.
Wo war der dritte Mann?
Wie nun, wenn sich der Bandit in den Corral stahl, den Carruther keineswegs ganz überblicken konnte, die beiden Braunen mitgehen ließ und drüben an der anderen Hausseite entlang verschwand?
Kaum hatte der Alte diese Gedanken zu Ende gedacht, als er auch schon die Stute ängstlich aufwiehern hörte.
Er rannte zum Fenster und sah, wie der Mann, gedeckt durch die beiden Tierleiber, zur Rückseite des Hauses eilte.
Carruther schob einen der Fensterläden halb auf.
Da klatschten in wildem Stakkato drei Kugeln auf das Holz und rissen fingerdicke Stücke aus der Faserung.
Gleich darauf donnerten fünf Pferde in westlicher Richtung davon.
Der Pferdedieb lag so tief auf dem Rücken des vordersten Tieres, daß er unmöglich zu treffen war.
Und einfach auf die Tiere feuern – nein, das hätte der alte Driver, dessen beste Freunde zeitlebens nur die Pferde gewesen waren, nicht über sich gebracht.
Was jetzt?
Die Station war ohne Pferde.
Und zwei Banditen befanden sich hier. In seiner Gewalt! Ganz sicher nur für ein paar Stunden, für einen halben Tag. Denn bei Einbruch der Dunkelheit würde der andere kommen, um sie abzuholen.
Das war so sicher wie die Tatsache, daß die Nacht kam.
*
Sie kam, die Nacht.
Carruther hatte den Verletzten ebenfalls ins Haus gebracht, ihn gefesselt und hatte sich dann daran gemacht, seine Wunden zu verbinden.
Der Mann war nicht lebensgefährlich verletzt worden, aber immerhin doch so sehr, daß er von starken Schmerzen geplagt war.
Sie lagen jetzt beide vorn bei der Hoftür, mit Schmiedeketten je an einen Dachpfeiler gefesselt. Der Alte hatte sie so gebunden, daß sie weder sich selbst noch einander befreien konnten.
Gegen zehn Uhr, als es stockdunkel geworden war, schlich Abe Carruther aus dem Haus zum Corral hinüber, hatte dann den Einfall, sich noch weiter zu entfernen, und blieb schließlich in der Mulde liegen, die fast achtzig Yards vom Haus entfernt war und von deren Rand aus er alles überblicken konnte. Er hatte das Gewehr vor sich im Sand liegen, und die beiden Revolver steckten im Hosenbund.
Der alte erfahrene Driver brauchte nicht lange zu warten. Es war kaum eine halbe Stunde vergangen, als er den Hufschlag mehrerer Pferde leise über den Sand klingen hörte.
Sie kamen also zu mehreren zurück!
Das war schlecht – sehr schlecht. Carruther preßte die Kiefer hart aufeinander und schnaufte. Well, er würde sein altes Leben so teuer wie möglich verkaufen.
Die Reiter kamen von Westen her bis auf dreißig Yards an das Haus heran und bildeten dann einen Ring, den sie blitzschnell schlossen und wie eine Lassoschlinge um das Haus zuzogen.
Der Alte feixte bitter vor sich hin.
Well, er war dieser Schlinge zwar entgangen, aber er hatte kein Pferd und war hier nicht weit genug, um eine echte Chance zu haben, unentdeckt zu bleiben.
Drüben vor dem Haus war noch alles still. Nur die Pferde, die die Banditen in etwa dreißig Yards Entfernung von der Mulde abgestellt hatten, scharrten leise mit den Hufen.
Da hatte der alte Overland River die Idee seines Lebens. Er nahm das Gewehr, erhob sich in geduckter Stellung und huschte langsam auf die Pferde zu.
Damned, was hatte er schließlich schon zu verlieren? Da drüben in der Mulde würden sie ihn über kurz oder lang gefunden haben.
Die Pferde! Sie waren seine einzige Chance.
Carruther war bis auf fünfzehn Yards an die Tiere herangekommen, als plötzlich eines von ihnen zu wiehern begann.
Da rannte der Alte los. Er erreichte das erste Tier und war fast schon im Sattel, als der Mann auf ihn zukam.
Carruther sah, daß der andere zum Revolver griff.
Krachend sauste der Gewehrkolben auf den Pferdewächter nieder.
Der Overland Man zog sich in den Sattel, beugte sich zum Zügel des nächsten Pferdes nieder, packte ihn, hieb seinem eigenen Gaul die Hacken in die Weichen und stieß den heiseren Schrei der alten Western-Kutscher aus.
»Heio – He!«
Wild stiegen die Tiere hoch und preschten davon.
Die Banditen sahen einander verdutzt an und stießen ein wahres Wutgeheul aus.
Ganz sicher wäre dem alten Driver Abraham Carruther dieser Handstreich gelungen, wenn der Gaul, der ihn trug, nicht unseligerweise mit dem linken Vorderlauf in den Bau eines Präriehasen geraten wäre.
Das Tier überschlug sich, und der Reiter wurde im hohen Bogen in den Sand geschleudert.
Reglos lag der alte Mann da. Die Tiere standen herum. Mehr als dreihundertfünfzig Yards hatte Carruther bereits zurückgelegt. Genau diese Distanz hatten die Banditen noch zu überwinden.
Mit wütendem Gebrüll jagten sie auf ihre Pferde zu, die sie in der Ferne deutlich auf dem gelben Sand stehen sahen.
Als sie schon bis auf dreißig Yards heran waren, kam Carruther zu sich. Er blickte auf und hörte die wilden Wutschreie der durch den Sand stampfenden Desperados.
Mit der Kraft der Verzweiflung stand der Alte auf und taumelte auf eines der Pferde zu.
Das Tier wich zurück und stieg auf die Hinterhand auf.
Der Driver wandte sich einem anderen zu, warf sich nach vorn, bekam den Sattelknauf zu fassen und zog sich hoch.
Die Kugel traf ihn rechts hinten an der Schläfe.
Wie ein Deckenbündel fiel er vom Pferd und schlug hart auf den Sand auf, wo er reglos liebenblieb.
*
Als der Overland Man die Augen wieder aufschlug, lehnte er in seiner eigenen Küche in der Herdecke, war an Händen und Füßen gebunden und mit einem seiner eigenen Lederriemen am Ofenbein angebunden worden. In seiner Schläfe hämmerte ein rasender Schmerz. Seine Kehle war wie ausgetrocknet. Dünn wie ein Stück Pergament klebte ihm die Zunge am brennenden reibeisenrauhen Schlund.
Der Durst brachte ihn fast um.
Drüben, am anderen Ende des rohbehauenen Tisches saßen drei Männer.
Der mittelste von ihnen hatte ein braun-grünes Gesicht, dunkle Augen und einen Mund, dessen Winkel hart nach unten wiesen. Das vorspringende Kinn war von einem spitzen Knebelbart besetzt.
Dieser Mann war der Tombstoner Desperado Frank McLowery.
Links neben ihm saß, mit einer gewaltigen ölgefetteten Haartolle, sein jüngerer Bruder Tom.
Der dritte Mann am Tisch war der Rustler Phin Clanton.
Die anderen, die an der Tür und am Fensterrahmen herumlungerten, gehörten alle zur Ike Clanton Crew. Früher einmal, vor Jahren, als der alte Clanton noch allein auf der Ranch das Regiment führte, waren sie alle Cowboys gewesen. Jedenfalls die meisten von ihnen. Unter Ike war das dann anders geworden. Es ging den Boys zwar auch nicht besser, aber ihr Boß hatte es verstanden, ihnen das einzureden.
Billy Clanton war übrigens nicht dabei.
Frank McLowery lehnte sich weit über den Tisch und blickte den greisen Overland Man, der eben aus schwerer Betäubung erwacht war, finster an.
»Vorwärts, mach das Maul auf, Alter.«
Carruther schluckte.
»Frank McLowery«, kam es heiser über seine Lippen.
»Du kennst mich also?« fragte der einfältige Bandit nicht ohne Stolz.
»Yeah«, knurrte der alte Driver. »Wer kennt dein Galgenvogelgesicht nicht. Ich habe es jahrelang in zahllosen Städten an den Vorbaubalken der Sheriffs Bureaus hängen sehen, damals, als du noch wegen der Sache mit Mice Donaldson gesucht wurdest, aber das ist ja wohl verjährt.«
Ohne seinen Bruder anzusehen und die Zähne voneinanderzunehmen sagte Frank:
»Bestrafe ihn, Tom. Er hat nicht so über mich zu sprechen.«
Tom, dessen Verstand sich nicht weit vom Schwachsinn bewegte, machte sich sofort daran, der Aufforderung seines Bruders nachzukommen. Er drosch so rücksichtslos auf den wehrlosen Greis ein, daß der wieder die Besinnung verlor.
Frank zupfte an seinem Bart und knurrte dann ärgerlich:
»Du bist ein Idiot, Tom. Ich habe dir nicht gesagt, daß du ihn halbtot schlagen sollst, denn schließlich habe ich mit ihm zu reden.«
Phin lehnte sich an die Stuhllehne zurück und streckte seine langen Beine von sich. Gähnend meinte er:
»Was willst du von ihm erfahren, Frank? Die beiden Braunen waren zwar gestriegelt, machten aber noch keinen frischen Eindruck. Da die Overland hier nur in der Woche einmal kommt, steht also fest, daß sie erst vorgestern, vielleicht sogar erst gestern morgen, hier war. Wir haben also wenigstens fünf Tage Zeit.«
Frank McLowery schob sich eine Virginia zwischen seine gelben Zähne.
»Fünf Tage«, stieß er in die blaue Tabakwolke hinein. »Ich brauche keine fünf Tage. Ich brauche nur einen Tag. Wenn Wyatt Earp überhaupt hier vorbeikommt, dann morgen früh. Und wenn die Overland diese Nacht nicht mehr zu erwarten ist, schwimmt der Stecken, wie er schwimmen soll.«
Der selbstherrliche Bandit erhob sich und trat ans Fenster. Sinnend blickte er zum Corral hinüber, um sich dann mit einem Ruck umzudrehen. Er nahm die Zigarre aus den Zähnen und stieß sie in Richtung auf einen seiner Leute, einen krummbeinigen Burschen mit schielendem Blick und viel zu weiten Hosen zu.
»Garry, du bleibst am Corral bei den Pferden!«
Die Zigarre zuckte auf einen anderen der Banditen zu, der eine gewaltige Stirnbeule hatte.
»Du, Charlie, bleibst ebenfalls am Corral, und wenn dir noch einmal so eine Pleite passiert wie vorhin, weißt du, was dir blüht. Wie kann sich bloß ein vierzigjähriger Bursche von einem so uralten Kerl überrumpeln und niederschlagen lassen. Ihr Halunken seid aber auch keinen Schuß Pulver wert.«
Die beiden ›Corralwächter‹ trotteten hinaus auf ihren Posten.
»Cass! Du bleibst hier hinterm Haus!« gebot McLowery einem Mann mit rotunterlaufenen Augen. »Der Alte hat auch dich hier am Haus niedergeschlagen. Sieh zu, daß du die Scharte wieder auswetzen kannst.«
Der großspurige Desperado Frank McLowery verteilt die Posten wie ein Offizier. Seit langem schon drängte der Bandit, den Ike Clanton nur widerwillig in seine Crew aufgenommen hatte, vorwärts. Er träumte davon, daß er eines Tages der Anführer der Crew sein würde. Mehr als einmal hatte er einen Coup auf eigene Faust unternommen, und wenn der Boß hinterher davon erfahren hatte, war es zu ernsten Differenzen zwischen den beiden gekommen.
Auch von diesem Ritt wußte Ike Clanton nichts. Es war dem raffinierten knebelbärtigen Desperado gelungen, Ikes Bruder Phin zu dem Ritt zu überreden, womit er für sich eine gewisse Sicherheit einhandelte, keinen erneuten Streit mit Ike zu bekommen.
Schließlich standen die drei Banditen noch allein in der Küche. Tom blickte auf den in sich zusammengesunkenen Alten.
»Was wird mit ihm?« fragte, er wobei sich seine Nasenflügel blähten.
Phin Clanton zog die Schulter hoch.
Frank hatte die Frage überhaupt nicht gehört. Er stand am Fenster und sah mit düsteren Blicken in den Hof.
Da trat Tom an ihn heran und stieß ihn an.
Frank fuhr herum und zischte: »Was willst du?«
Schon von frühester Jugend an hatte er den Bruder mit seinem herrischen, unberechenbaren jähzornigen Wesen geknechtet.
Aber Tom war schon so sehr daran gewöhnt, daß er es gar nicht mehr merkte.
»Was wird mit dem Alten?« krächzte er.
»Mir einerlei«, versetzte Frank.
»All right«, nickte Tom. »Wir werden ihn aufknüpfen.«
Der gefühlrohe Bursche löste die Fesseln des Greises, riß ihn hoch, forderte Phin auf, mit anzupacken, und schleppte den Alten in den Hof.
Frank McLowery stand allein in dem kleinen Küchenraum, verließ ihn und ging hinüber in die Schlafstube des Mannes.
Der Desperado starrte in die Nacht hinaus, blickte über den Sand, der in der Dunkelheit seltsam fahl wirkte, lauschte dem sanften Südwind nach, der den Flugsand der Savanne zum Klingen bringen konnte, und dachte daran, daß er diesmal dem verhaßten Dodger Marshal eine Falle gestellt hatte, aus der es kein Entrinnen gab.
*
Wyatt Earp und Doc Holliday hatten tatsächlich die Route der South Mexico Overland Line eingeschlagen.
Der Marshal kannte den Weg; er war schon einmal vor zwei Jahren, allerdings in umgekehrter Richtung, von Texas herübergekommen.
Der Georgier, der den Schluß des kleinen Trupps bildete, vor allem, weil dann dem Gefangenen ein jeglicher Ausbruchsversuch unmöglich gemacht war, wunderte sich schon seit einer Weile, daß der Marshal von dem in der Nacht allerdings sehr schlecht sichtbaren Weg der Overland abgewichen war.
Wyatt Earp hatte einen leichten Halbkreis nach Süden eingeschlagen.
Es war gegen halb zehn Uhr dunkel geworden.
Kurz vor zehn stieg der Missourier plötzlich aus dem Sattel und untersuchte den Boden.
Der Gefangene stieß eine hämische Lache aus.
»Aha, jetzt wird sich uns der große Wyatt Earp als Fährtenleser produzieren. Geben Sie nur acht, Doc, der rote Cochise ist ein Stümper gegen ihn.«
Der Gambler würdigte ihn keiner Antwort.
Hardac war seit seiner Ergreifung ziemlich wechselvollen Stimmungen unterworfen. Anfangs war er sehr niedergeschlagen und stumm gewesen, dann war seine alte Frechheit wiedergekehrt, die schließlich zu einem ständigen Spott auf den Marshal ausgeartet war. Die beiden eisenharten Männer reagierten aber nicht im mindesten darauf. Die Reden des entsprungenen Sträflings waren für sie das Gekläff eines streunenden Hundes. Dies hatte in dem Banditen eine rasende Wut auf seine beiden Begleiter aufkommen lassen. Vor allem aber konzentrierte sich sein Zorn auf den Marshal, der mit unbeweglichem Gesicht nun schon seit Tagen vor ihm herritt.
Wyatt Earp und Doc Holliday! Wie oft hatte er früher schon von den beiden Männern gehört, von ihren weiten Ritten und von ihren Erlebnissen. Oben in Oregon, wo er als Keeper in einem Saloon gearbeitet hatte, war der Name Wyatt Earp vor nun fast schon einem Jahrzehnt zum erstenmal an sein Ohr gedrungen. Damals hatte der junge Keeper Jack Hardac davon geträumt, vielleicht auch einmal ein Gesetzesmann wie der große Wyatt Earp zu werden. Das war jedoch schon ziemlich lange her.
Dabei war es nur eine ganz kleine Sache gewesen, die sein Leben von Grund auf geändert hatte. Ein kanadischer Pelztierjäger hatte seine Geldtasche auf der Theke liegengelassen, dem Keeper den Rücken zugekehrt und sich mit zwei anderen Gästen unterhalten.
Der schlechtbezahlte Jack Hardac hatte gemeint, daß er diese ›Chance‹ nutzen müßte, daß es direkt seine Pflicht war, diesen ›Weg des Schicksals‹ zu nutzen.
Ehe er sich recht versah, hatte die harte Faust des Pelztierjägers bereits in seinem Gesicht gesessen. Dann war der Sheriff gekommen, und man hatte ihn ins Jail gesperrt. Daheim in Dark Blend, wo er geboren worden war und wo ihn jeder kannte. Seine Schwester Sylvia verlor den Bräutigam, der nicht mit der Schwester eines ›Verbrechers‹ verwandt sein wollte, und sein alter Vater, ein ehrbarer Schreiner, hatte Selbstmord begangen.
Es war eine Reihe verschiedener Dinge gewesen, eine unselige Verkettung mehrerer Umstände, die den weiteren Lebensweg Jack Hardacs bestimmt hatten.
Aber wer wollte dem Bräutigam seiner Schwester einen Vorwurf machen, daß er lieber ein Mädchen aus ›anständiger‹ Familie nehmen wollte? Wer hätte mit seinem Vater rechten mögen, weil er die ›Schande‹, die ihm der ungeratene Sohn zugefügt hatte, nicht zu ertragen vermocht hatte?
Was ihm jedoch vielleicht den letzten Stoß versetzte, war die Tatsache, daß seine Mutter ihm die Tür wies, als er nach fünf Monaten aus dem Jail entlassen worden war. Damals hatte sich die Seele des ohnehin haltlosen jungen Menschen verhärtet; damals erst war er ein Verbrecher geworden.
Und dennoch, wer hätte sagen wollen, daß ihn andere auf den Grauen Trail getrieben hätten? Hatte er doch wie jeder andere Mensch sein eigenes Geschick in der Hand. Aber der Oregon Man Jack Hardac hatte nicht die Kraft aufgebracht, zu einem guten, ehrbaren Leben zurückzufinden. Im Gegenteil: er hatte sich treiben lassen und war einer der übelsten Verbrecher geworden, der je über die grauen verwachsenen Pfade des alten Westens geritten war.
*
Die drei Pferde standen völlig still. Wyatt Earp richtete sich vom Boden auf und blickte nach Nordosten.
Er hatte eine Fährte entdeckt, die in schnurgerade Richtung auf die ihm bekannte einsamgelegene Pferdewechselstation zuführte.
Der Missourier wußte in diesem Augenblick keineswegs, daß er hier vor der Spur seines haßerfüllten Gegners Frank McLowery stand. Aber irgend etwas war in ihm, das ihn warnte. Er hatte das Gefühl schon gehabt, als er noch bei Tageslicht die Zwillingsspur der Overland verließ.
Doc Holliday, der bis jetzt im Sattel seines Schecken geblieben war, stieg ab und nahm eine seiner langen Zigaretten aus der Tasche, er schob sie sich zwischen die Lippen, ohne sie jedoch anzuzünden.
Der Marshal sah ihn an und nickte.
Da riß der Spieler ein Zündholz am linken Daumennagel an.
Die beiden schweigsamen Männer, die nun schon seit sieben Jahren häufig miteinander ritten, verstanden einander auch ohne Worte. Holliday hatte jetzt gefragt, ob er rauchen könne oder ob Wyatt der Ansicht sei, daß irgendeine Gefahr in der näheren Umgebung lauere.
Nein, so nahe war die Gefahr nicht, die der Missourier mit einem sechsten Sinn zu spüren glaubte, als daß der winzige Glutpunkt einer Zigarette hätte anlocken können.
Der Marshal blickte immer noch über den dunklen Streifen, der sich schnurgerade durch den Sand nach Nordosten zog und im Dunkel der Nacht irgendwo am Horizont verschwamm.
Der Georgier hatte die Spur auch gesehen. Sein Blick streifte fragend das scharfe Profil des Marshals.
Wyatt überlegte noch einen Augenblick, dann zog er sich in den Sattel.
Holliday ließ die nur halbgerauchte Zigarette fallen und schob mit der linken Schuhspitze den Sand über die Glut. Dann stieg auch er auf.
Jack Hardac hatte nichts entdeckt. Der Verbrecher war einfach blind für die Dinge in der Savanne. Mit schweißnassem Körper hing er im Sattel und schaukelte auf torkelndem Gaul neben dem Mann her, der ihn ein zweites Mal eingefangen hatte.
*
Als Wyatt in der Ferne die Pferdewechselstation wie einen grauen Schatten über dem fahlgelben Sand auftauchen sah, hielt er an, rutschte aus dem Sattel und zog auch Hardac vom Pferd.
Der Verbrecher wurde geknebelt und so gefesselt, daß er sich unmöglich aus eigener Kraft von der Stelle entfernen konnte. Auch Holliday war abgestiegen. Er nahm die drei Pferde beim Zügel und folgte dem voranschreitenden Missourier.
Nur etwa hundert Schritte entfernte sich Wyatt von der Stelle, an der sie Hardac zurückgelassen hatten.
»Da drüben ist eine Pferdewechselstation.«
Holliday nickte. »Ich dachte mir so etwas.«
Wyatt senkte den Kopf und blickte auf die Spur.
»Es sind mindestens acht Reiter.«
»Zwei mehr als in der Felsenge hinter Tombstone.«
Der Missourier wandte den Kopf zur Seite und durchforschte das in der Dunkelheit seltsam maskenhafte Gesicht des Spielers. Er hatte also seine Gedanken erraten, der Mann aus Georgia.
Wyatt bückte sich und hobbelte die beiden Vorderbeine seines Pferdes zusammen. Holliday tat sofort das gleiche.
Langsam gingen die beiden Männer nebeneinander her.
Der Marshal blieb noch eine Weile auf der Spur und entfernte sich dann in östlicher Richtung von ihr.
Als sie die Konturen der Pferdewechselstation schon deutlich gegen den Nachthimmel erkennen konnten, kauerte sich der Missourier an den Boden nieder.
Der Gambler ließ sich neben ihm nieder. Wyatt spähte zur Station hinüber.
»Wahrscheinlich ist es Unsinn«, sagte er dann. »Was sollten die Clantons hier?«
»Frank McLowery, dieser gallige Halunke, führte den Trupp neulich an. Dem Kerl ist alles zuzutrauen.«
»Aber wie soll er hierhergekommen sein? Er müßte eine unwahrscheinliche Eile vorgelegt haben.«
Holliday nickte. »Und außerdem sind es acht Pferde…«
*
Auf der kleinen Pferdewechselstation herrschte in diesem Augenblick eine beklemmende Stille.
Tom McLowery und Phin Clanton hatten gerade den alten Carruther auf den Hof geschleppt und vorm Corralgatter niedergelassen.
Tom sah sich um.
»Da drüben kann er auspusten.«
Der gewissenlose Bandit wies auf einen Balken, der über den Dachrand des Hauses ragte.
Phin nickte. »Komm, pack an.«
Sie schleppten den Alten vorwärts.
Und noch ehe sie das Haus erreichten, kam Abe Carruther zu sich. Instinktiv spürte er trotz seiner Benommenheit, daß eine Gefahr auf ihn zukam, die von den beiden Männern ausging.
Unwillkürlich stieß er einen heiseren Hilfeschrei aus.
Tom versetzte ihm einen derben Fußtritt.
Und Phin preßte ihm erschrocken die Hand auf den Mund.
»Wirst du wohl schweigen, alter Halunke!«
Während Phin den Overland Driver bewachte, rannte Tom los, um das Lasso von seinem Sattel zu holen.
Plötzlich zuckte Phin zusammen.
Irgend jemand hatte ihm auf die Schulter getippt.
Er wandte sich rasch um – und erkannte trotz der Dunkelheit die Konturen eines Mannes, dessen Anblick und Gegenwart ihm das Blut in den Adern erstarren ließ.
Aber ehe er dazu kam, auch nur den geringsten Laut auszustoßen, fällte ihn die Faust des Dodger Marshals.
Wyatt bückte sich, packte ihn und schleifte ihn hinter die Hausecke, wo der Gambler den Besinnungslosen in Empfang nahm und rasch zu einem handlichen Paket verschnürte.
Carruther sah an dem großen Mann hinauf, der jetzt neben ihm kniete.
»He«, keuchte er, »was war das denn?«
»Kleiner Spaß unter Freunden, Mister. Schließlich müssen wir uns ja auch unterhalten in dieser langweiligen Gegend.«
Carruther seufzte schwer.
Da nahten sich vom Corral her Schritte.
Tom McLowery kam zurück.
Wyatt kniete neben dem Alten nieder, da er befürchten mußte, daß der Bandit sofort merken würde, daß hier ein größerer Mann stand als Phin Clanton einer war.
Tom kam heran. Er hatte das Lasso unterwegs schon zu einer Schlinge geworfen.
»He, was krauchst du da unten herum, Phin? Es geht los.«
Wyatt federte hoch.
»Yeah, Tom, es geht los!«
Das Reaktionsvermögen des Desperados war erheblich größer als das seines Komplicen. Er fuhr zurück und stieß die Hand zum Colt.
Aber der gedankenschnelle und punktgenau hochgerissene Uppercut des Missouriers riß ihn von den Beinen, ehe er auch nur zu der geringsten Abswehrreaktion gekommen war.
Holliday holte ihn sich gleich ab und band ihn ebenfalls.
Die beiden reglosen Verbrecher bekamen Knebel zwischen die Zähne geschoben.
Holliday erhob sich und meinte:
»Sie müssen die Anlieferung von schlafenden Banditen stoppen, Marshal – die Riemen sind alle.«
Wyatt wies auf das Lasso.
»Zerschneiden Sie ihn, der Stationshalter kann Ihnen helfen.«
Der Georgier beugte sich über den Alten.
»He, der Mann ist verletzt!«
Der Alte keuchte: »Nicht so schlimm. Aber was war das? Ist er ein Marshal?«
»Yeah«, versetzte Holliday, »und wenn es mit Ihrer Verletzung nicht so schlimm ist, dann können Sie mir ja helfen, das Lasso zu zerschneiden.«
Der Alte rieb sich das Kinn.
»He – das ist ein Ding! Er ist ein Marshal, und Sie sind ein Deputy! Zwei Staatenreiter! Heiliger Himmel! Wer hat Sie ausgerechnet in dieser höllischen Stunde hergeschickt?«
»Psst!« mahnte der Marshal. »Es ist nicht notwendig, daß uns die anderen hören.«
Holliday stieß die Luft leise durch die Nase aus.
»Es sind gute alte Bekannte, Wyatt. Der erste ist Phin und der zweite Tom. Ich wette, daß der liebe Frank auch in der Nähe ist.«
Wyatt fing zunächst die beiden Posten ab, die am Corral Wache hielten, dann schnappte er sich die beiden Banditen, die das Gebäude bewachen sollten.
Doc Holliday und Abe Carruther hatten alle Hände voll zu tun.
Wyatt schleppte die leblosen Gestalten zu den beiden hin.
Dann ging er auf die Haustür zu.
Heavens, da oben stand ein Mann mit einem Gewehr in der Hand.
Es war ausgeschlossen, unbemerkt an ihn heranzukommen.
Da ging der nervenlose Mann aus Missouri aufrechten Schrittes auf den Desperado zu.
Erst kurz vor der Treppe stutzte der Bandit.
»He, Nic, wie siehst…« Er stockte.
Da sprang ihn der Marshal an und riß ihn nieder. Ein heiserer Laut entrang sich der Kehle des Verbrechers, ehe ihn die Besinnung verließ.
Doc Holliday stand unterm Fenster.
Er deutete in den Küchenraum und machte das unverkennbare Zeichen eines Spitzbartes.
Frank McLowery war also noch drinnen.
Der letzte Mann.
Wyatt ging ins Haus und öffnete die Küchentür.
Der Bandit kehrte ihm den Rücken zu und kaute auf seiner Virginia.
»Irgendwas Neues?« schnarrte er.
»Eigentlich nicht«, entgegnete Wyatt.
Mit stocksteifem Rücken stand der Verbrecher da und lauschte dem Klang dieser Worte nach.
Und dann flog er herum.
Aber gleichzeitig zersprang hinter ihm die Fensterscheibe, und Hollidays schneidende Stimme drang an sein Ohr:
»Laß den Revolver stecken, Frank. Ich weiß nicht, was dein Bruder Thomas von einem Grab hier in der Savanne hält.«
Der Tramp stand wie angenagelt da.
Wyatt ging auf ihn zu und nahm ihm die Waffen weg.
McLowery lauschte nach draußen.
Aber der Gambler lehnte sich in das jetzt hochgeschobene Fenster und meinte:
»Ich hoffe, du wartest nicht auf die anderen. Die liegen versandfertig hinter der Südseite des Hauses. Ike wird eine Menge Postgeld zahlen müssen.«
Die Erwähnung des Bandenchefs ließ Frank fast unmerklich zusammenzucken.
Hell und devils! Wie war das nur möglich gewesen. Wyatt Earp und Doc Holliday hatten ihn regelrecht überrumpelt. Wie war es ihnen nur gelungen, einen seiner Leute nach dem anderen zu überwältigen? Und dann noch mit einer so unheimlichen Lautlosigkeit!
Der Verbrecher starrte den Marshal aus engen Augen an.
»Und…?« fauchte er. »Weshalb schießen Sie mich nicht nieder?«
Wyatt gab ihm keine Antwort.
*
Eine halbe Stunde später verließen er und Holliday die Station. Zwischen ihnen ritt der an Händen und Füßen gefesselte Desperado Frank McLowery.
Hinter ihnen folgte der alte Carruther mit seinen beiden Gäulen.
Und dann folgten die Pferde der Banditen, deren Leithengst Carruther an der Leine führte.
Auf der Station waren sieben gefesselte waffenlose Banditen zurückgeblieben.
Mit flackernden Augen hatten sie zusehen müssen, wie ihr Anführer aufs Pferd gebunden worden war und mit den beiden verhaßten Männern reiten mußte.
Wyatt schlug, als er Hardac wieder im Trupp hatte, einen scharf nordöstlichen Kurs ein.
Im leichten Trab ging es über die nächtliche Savanne.
Fast siebenundvierzig Meilen hatte der Trupp zurückgelegt, und es war längst heller Vormittag, als Wyatt anhalten ließ. Er löste dem Tombstoner Banditen die Fesseln und sah ihn aus ernsten Augen an.
»Hören Sie genau zu, Frank. Ich bin ein ziemlich geduldiger Bursche, aber wenn mir die Galle überläuft, dann schlage ich unbarmherzig zu. Es wäre gut, wenn Sie sich das merken würden. Da, nehmen Sie Ihre Gäule und verschwinden Sie.«
McLowery sah ihn aus böse flackernden Augen an. Während er sich die Hände rieb, fragte er heiser:
»Wo sind unsere Waffen?«
»Reiten Sie den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ich habe sie in eine Decke gewickelt und unterm Sand verscharrt. Sie sind nicht allzu schwer zu finden.«
Der Rustler stieß hart mit dem Fuß auf.
»Bin ich ein Indianer? Wie soll ich die vergrabenen Waffen finden können?«
»Vergraben«, spöttelte Holliday. »Mensch, bilden Sie sich tatsächlich ein, daß der Marshal sich die Mühe macht, eure rostigen Kanonen einzubuddeln? Vorwärts, kriechen Sie auf Ihren Gaul und dampfen Sie dann ab. Wenn Sie mir auf diesem Ritt noch einmal in die Quere kommen, dann werden Ihre Freunde allerdings etwas zu buddeln haben: nämlich ein Grab für Sie!«
McLowery fletschte die Zähne.
»Für diese Worte werden Sie mir noch…« Er brach ab.
In der Hand des Georgiers blinkte ein Revolver.
Frank stampfte mit gesenktem Blick zu seinem Pferd, nahm die Leine des Leithengstes an sich, der Phin Clanton gehörte, und preschte mit den Banditenpferden im scharfen Galopp nach Südwesten.
*
Sie waren der Overland bis zur nächsten Station entgegengeritten. Da war der alte Carruther geblieben.
»Thanks, Marshal«, verabschiedete er sich von dem Missourier. »Ohne Sie hinge der alte Abraham Carruther jetzt am Dachbalken seiner eigenen Station. – Tanks auch, Doc, für den prächtigen Verband. Die Wunde schmerzt überhaupt nicht mehr. Übrigens habe ich von Ihnen etwas gelernt: Ich wußte gar nicht, daß man einen Banditen so rasch und unwiderstehlich verschnüren kann…«
Wyatt hatte den Alten bewußt von der einsamen Station weggeholt. Er wußte, daß die Bande ihren Zorn sonst ganz sicher an ihm ausgelassen hätte, wenn er selbst und Doc Holliday fort waren.
Nach kurzem Abschied ritten die beiden Männer mit dem Gefangenen weiter durch die endlos scheinende gelbe Sandwüste New Mexicos nach Osten, dem fernen Straflager Fort Worth drüben in Texas entgegen.
*
Die fünf Männer, die oben in der Nische des roten Sandsteinturmes lagen, dösten in der Sonne vor sich hin. Es waren zerlumpte bärtige Gestalten mit verwegenen tiefdunklen Gesichtern.
Poul Riva lag etwas abseits von ihnen. Er hatte eine bronzefarbene Haut und dunkle Augen, die unter den nach den Außenwinkeln hin hängenden Lidern einen verschlagenen, ja, gefährlichen Eindruck machten. Sein Haar war kurz und kraus, schwarz und stark mit grau gemischt; es wirkte wie Matratzenwolle.
Riva war vor vierzig Jahren als Sohn italienischer Emigranten nach Boston gekommen und hatte sich bald in den Westen geschlagen. Hier war das Land, das er suchte – und das Leben, das er bevorzugte.
Er war ein Bandit. Früher einmal hatte er unten in Florida in einer alten Hütte gelebt, sich auf Kosten eines italienischen Ehepaares ernährt, an einem nie fertigwerdenden Boot gebaut, mit dem er als ›freier Mann‹ die sieben Weltmeere durchkreuzen wollte. Aber das hatte eines Tages ein Ende gehabt, als er aus der Hütte mußte, weil eine Ölgesellschaft den Grund und Boden gekauft hatte. Da war der Italo-Amerikaner nach Westen gezogen.
Hinunter nach Texas, an die einsame Grenze New Mexicos.
Und hier trieb er sich nun schon einige Jahre vagabundierend umher. Eine Zeitlang war er unten auf der Corbintora Ranch gewesen, die einem Spanier gehörte, hatte als Peon gearbeitet, war aber dann bald weiter westlich gezogen und eines Tages auf Eddie Norton gestoßen.
Norton war ein Satteltramp – ein Bandit.
Die beiden überfielen einsame Reiter in der Gegend von Al Punato, beschossen einmal, allerdings aus sicherer Entfernung, von einer Sandsteinpyramide aus sogar die Overland, hatten aber damit keinen Erfolg und warben in El Rabada noch zwei weitere Tramps an, die mit ihnen zogen, Jimmy Deeger und Ric Oakland.
Poul Riva hatte eine Bande.
Bei dem ersten Feuergefecht in der kleinen Stadt Gingers am Croce River, schlug sich der Revolvermann Hearst auf Rivas Seite.
Seitdem zählte die Crew fünf Männer.
Was die nun seit drei Monaten bestehende Bande bisher erbeutet hatte, war mehr als wenig. Deshalb drängten die Männer ihren Anführer, etwas ›zu unternehmen‹.
Riva hatte sich in seiner neuen Rolle als Bandenboß bisher wohl gefühlt. Aber was da auf ihn zukam, mißfiel ihm sehr. Er konnte nicht verstehen, daß die anderen so wenig genügsam waren, immer wieder im Sattel sitzen mußten, um irgendeiner Beute nachzujagen. Aber er dachte auch nicht daran, seinen ›Posten‹ als ›Boß‹ abzugeben. Deshalb sann er nach.
Das, was Paoletto Riva ersann, war ebenso verwegen wie verlockend: Er hatte nicht mehr und nicht weniger vor, als die große Wells Fargo Station Santa Margerita zu überfallen.
Sie alle kannten die Station. Sie lag mitten in der Sandwüste, nach allen Himmelsrichtungen hin über sechzig Meilen von jeder Stadt entfernt. Eine Versorungsstation dreier sich hier kreuzender Overland-Postlinien und zweier großer Trailwege. Drei große Häuser, Ställe, Scheunen, Baracken und Schuppen.
Riva selbst hatte ausbaldowert, daß nur elf Menschen auf der Station waren – elf Männer.
Frauen gab es nicht in Santa Margerita.
Eine ganze Woche arbeitete Riva an dem Plan. Dann trug er ihn seinen Leuten vor.
Alle waren von dem Gedanken ebenso erschrocken wie begeistert. Nur der Revolvermann Joseph Hearst schwieg.
Riva hatte ihn nur angesehen.
»Du bist dagegen, Joe?«
»Yeah, weil es Wahnsinn ist. Nicht wegen der elf Männer, sondern wegen der Tatsache, daß die Station ganz sicher auf Überfälle vorbereitet ist. Wenn wir dreißig oder vierzig Leute wären, wenn wir eine Bande wären wie die Kellys oder die Belwoods, wenn wir einen Tornado über der Station loslassen könnten, yeah, dann wäre ich dabei. Aber wir sind fünf Figuren. Ich wette, daß wir nicht zwei Leute heil am anderen Ende der Station herausbringen werden.«
Nach diesem Gespräch war es lange still zwischen den Tramps gewesen. Einige der Männer glaubten Hearst – aber im Grunde standen sie hinter Riva und träumten von der großen Beute, die er ihnen versprochen hat-te.
Es gab in jenen wilden Jahren zahllose Banden in diesem Land. Fast täglich bildeten sich irgendwo neue. Glücklicherweise gingen die meisten von ihnen schnell wieder ein. Aber immer blieb irgendwo eine Banditen-Crew hängen, der einmal ein größerer Coup gelungen war, und terrorisierte die Umgegend.
Die Riva-Bande war bis zu jenem Zeitpunkt, da unsere Geschichte spielt, noch ziemlich bedeutungslos. Und vielleicht wäre sie es auch geblieben und sogar auseinandergefallen, wenn der Italo-Amerikaner Riva nicht den absurden Gedanken mit dem Überfall auf die Wells Fargo Station Santa Margerita gehabt hätte.
Riva blinzelte über das Land, das unter einer wabernden Glutschicht zu liegen schien.
Nur wenige Meilen nördlich von hier lag die Station.
Es war alles vorbereitet für den Überfall.
Aber wenn Hearst nicht mitmachte, war alles sinnlos. Sie brauchten ihn – ihn vor allem. Er war der beste Schütze der Bande, der reaktionsschnellste Mann, ein umsichtiger Kämpfer und vor allem ein kaltherziger Bursche, der seinesgleichen suchte. Diese Qualitäten hatte Riva schon gleich in der ersten Stunde unten in Gingers am Croce River bei dem Coltman entdeckt. Riva kaute an einem Daumennagel herum und beobachtete das weite Land, das zu Füßen der vom Flugsand während einiger Jahrtausende säulenartig verschliffenen Burg aus rotem Arizonastein lag.
Dies hier waren die letzten himmelragenden Gesteinstürme, die sich aus Arizona bis hier herauf ins südliche Texas hineinzogen, hier allerdings nicht mehr die gigantischen Ausmaße und nur noch wenig von der Großartigkeit hatten, die die skurrilen himmelragenden Gesteinsbastionen Arizonas aufzuweisen hatten.
Plötzlich richtete sich Joe Hearst auf. Er war ein schlanker Mensch mit magerem Gesicht, langem Kinn, herabgezogenen Mundwinkeln, kleiner hochstehender Nase und kalten Augen.
»All right, Riva! Ich reite mit!« brachte er dumpf über die Lippen.
Auch die anderen erhoben sich.
Dann stiegen sie hinunter zu den Pferden, die sie in einer Felsspalte abgestellt hatten. Im Sturmritt preschte die Bande nordwärts, der Station Santa Margerita entgegen.
Und dann geschah an jenem Freitagmittag zwischen zwölf Uhr und zwölf Uhr dreiundzwanzig das, was später niemand mehr für möglich halten wollte:
Poul Riva und seine vier Banditen überfielen die Station – und fanden keinen Widerstand.
*
Sie waren im leichten Trab in die Straße geritten, die von den Häusern, Scheunen, Schuppen und Baracken gebildet wurde.
Vorm Office stiegen sie von den Pferden.
Riva selbst betrat das Bureau.
Er sah sich drei Männern gegenüber, die mit hochgekrempelten Ärmeln an einem Tisch standen und arbeiteten.
Der Bandit zog seinen Revolver.
»Hands up!«
Er hatte es nicht einmal laut oder sehr drohend gesagt – und wunderte sich doch selbst, wie wortlos die Leute reagierten. Sie hoben ihre Hände in Schulterhöhe und starrten ihn verdutzt an.
Hearst stürmte in die Tür. Blitzschnell nahm er den dreien die Revolver aus den Waffengurten, dann winkte er sie heran und stieß einen nach dem anderen in einen Verschlag, den er verriegelte.
»Wenn ich einen Laut höre, Boys, fliegt ihr mit der Sprengstoffladung, die ich hier hinlege, in die Luft!«
Er warf einen Feldsteinsplitter vor die Tür.
Ebenso, wie Riva das Office genommen hatte, nahm er auch die beiden Lagerhäuser und den Rest der Station.
Dreiundzwanzig Minuten dauerte der Spuk. Dann hatten die Tramps alles Mitnehmenswerte an sich genommen und stiegen auf die Pferde.
Riva, der die Kasse geplündert hatte, feuerte vor Übermut einen Schuß auf die große Uhr ab.
Genau um zwölf Uhr dreiundzwanzig blieb das Uhrwerk stehen.
Die Wells Fargo Leute waren auf die Straße getrieben worden.
Da trat der kleine kahlhäuptige Chief der Station einen Schritt vor und blickte Riva, der noch oben auf dem Vorbau des Bureaus stand, bittend an.
»Mister, Sie haben alles, was Sie hier holen konnten. Bitte, verschonen Sie die jungen Burschen hier. Mich können Sie meinethalben auslöschen. Aber wenn es geht, nicht eben hier, wo ich so lange Jahre gelebt und gearbeitet habe.«
Riva kam die Treppe herunter.
Er fühlte sich wie ein König. Fast leise versetzte er:
»Hier stirbt niemand. Wir nehmen euch mit und lassen euch in den Türmen zurück.«
Der Stations Chief preßte die Lippen zusammen. Dann stieß er heiser hervor:
»Bitte, Mister, lassen Sie die Boys doch laufen. Es sind alles noch junge Kerle, die noch kaum ins Leben hineingerochen haben. Weshalb wollen Sie sie umbringen. Es reicht doch, wenn Sie mich mitnehmen.«
»Schluß jetzt!« Riva machte eine herrische Geste mit der Rechten, warf die zusammengebundenen Geldsäk-ke, die er im Office erbeutet hatte, über seinen Sattel und stieg auf. »Vorwärts, Leute, bringt sie auf die Gäule, und dann weg hier!«
Der Troß stob Minuten später aus der nun völlig verlassenen Station nach Süden davon.
*
Eine knappe Dreiviertelstunde später näherten sich von Westen her drei Reiter.
Wyatt Earp, Doc Holliday und der Sträfling Jack Hardac.
Als sie auf eine halbe Meile an die Station herangekommen waren, hielt der Missourier sein Pferd an. Mit zusammengezogenen Brauen und schmalen Augen musterte er die Station.
Die absolute Stille da vorn mißfiel dem Marshal. Well, es war Mittag, und da ruhte in diesen heißen Landstrichen die Arbeit. Dennoch – irgendein Lebenszeichen hatte es gerade hier auf der betriebsamen Station immer gegeben. Auch mittags.
Der Kreuzpunkt der drei Postkutschen-Linien hatte immer Arbeit. Kisten wurden hin und her geschleppt, Postsäcke und Pakete. Wasserfässer wurden gefüllt, und vorn in der Schmiede war immer ein Hämmern gewesen, da es ständig neue Hufe herzustellen galt. Mit dieser Arbeit hatten sich auf der Station immer vier Leute abgelöst.
Das wußte Wyatt Earp genau.
»Warten Sie, ich werde mir das mal ansehen«, rief er Holliday zu, nahm die Zügel auf – und schon schnellte der Falbe vorwärts.
Der Geogier beobachtete den Marshal, sah, wie er einen leichten Bogen ritt und von Nordwesten her auf die Scheunen zuritt.
Hardac stieß den Kopf vor und röhrte:
»Ich wünschte, da steckte eine Horde von Comanchen und drehte ihm die Gurgel ab.«
Holliday nahm blitzschnell seinen Hut ab und schlug ihn dem Verbrecher ins Gesicht.
»Halt deinen Rand, Bandit.«
Er lauschte zur Station hinüber.
Dann erspähte er den Marshal plötzlich. Der kam aus einem der Häuser heraus, warf sich auf den Falben und kam dem Georgier, der die beiden Pferde sofort in Bewegung gesetzt hatte, entgegen.
»Leer.«
Der Spieler zog die Brauen zusammen.
»Wo sind die Leute?«
»Offenbar hat hier ein Überfall stattgefunden. Es kann noch nicht lange her sein. Die Uhr ist kurz vor halb eins stehengeblieben. Eine Kugel hat das Werk zerstört.«
Wyatt Earp fand schnell die Spur, die der Pferdetroß mit Rivas Leuten und den Gefangenen hinterlassen hatte.
Holliday hatte sich eine Zigarette angezündet, während der Marshal einen Schluck aus der Campflasche nahm.
Auch Hardac trank; in gewaltigen Schlucken leerte er das brakige Wasser aus seiner Flasche.
Wyatt mahnte ihn: »Trinken Sie langsamer und weniger. Hier können wir die Flaschen noch einmal füllen. Aber dann wird’s anders…«
Der Marshal überlegte, weshalb die Bande die gesamte Besatzung der Station mitgenommen haben mochte.
Auch Holliday hing diesem Gedanken nach.
»Jedenfalls ist es kein gutes Zeichen«, meinte der Spieler.
»Ganz sicher nicht. Im Gegenteil.«
»Folgen wir ihnen?«
Wyatt nickte.
Da zertrat der Gambler seine Zigarette und zog sich wieder in den Sattel.
Hardac saß noch auf der Vorbautreppe im Schatten. Nur die Hände waren noch mit einer Kette beschwert. Wyatt hatte ihm seit drei Tagen die Fußfesseln abgenommen.
»Was denn?« knurrte der Verbrecher gallig. »Geht’s etwa schon weiter? No, Boys, das mache ich nicht mit. Ich bin nicht aus Eisen. Ich brauche eine Rast hier. Verdammt noch mal, ihr beiden Höllenhunde kennt ja wohl keine Müdigkeit und keine Erschöpfung! Aber von mir könnt ihr das nicht erwarten. Ich bin ein Mensch…«
»So?« unterbrach ihn der Spieler und sah ihn aus kühlen Augen an. »Das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen.«
Hardac fuhr hoch.
»Sie können sich Ihren Spott sparen, Sie elender Zahnklempner! Ich habe es nicht nötig, mich von einem so…«
Holliday hatte den Hut wieder in der Hand. Und der Verbrecher verstummte.
»Aufsteigen!« befahl Wyatt.
Hardac zerquetschte einen Fluch zwischen den Zähnen und zog sich dann ächzend in den Sattel.
In scharfem Ritt ging es auf der Spur, die Riva hinterlassen hatte, südwärts.
Nach anderthalb Meilen tauchte eine kleine Felsenburg auf.
Wyatt umritt sie zuächst allein und winkte Holliday dann, daß er mit dem Gefangenen nachfolgen sollte.
Als der Georgier die Steinpyramide erreicht hatte, deutete der Marshal nach Süden.
»Sehen Sie da hinten den Fels-turm?«
Holliday nickte.
»Die Fährte führte genau darauf zu. Ich kenne diesen Turm. Vor zwei Jahren habe ich dort einmal übernachtet. Ich könnte mir denken, daß dieses Gesteinsnest da einen ausgezeichneten Schlupfwinkel für eine Verbrecherbande abgibt.«
»Well, und wenn wir uns jetzt auf den Weg dahin machen, sehen sie uns schon nach ein paar hundert Yards kommen.«
»Eben«, antwortete Wyatt. »Aber irgend etwas müssen wir unternehmen, denn ich werde den Gedanken nicht los, daß die Banditen die Wells Fargo Leute nicht aus Spaß mitgenommen haben.«
Doc Holliday warf dem Marshal die Zügelleine Hardacs zu.
»Ich werde hinreiten.«
»Und…?«
»Vielleicht gelingt es mir, den Halunken ein Märchen aufzubinden.«
Der Missourier hatte ein kleines Lachen in den Augenwinkeln.
»Well, Doc, und ich kenne dieses Märchen auch schon. Erzählen Sie den Halunken, daß hier ein paar Comanchen damit beschäftigt wären, irgend etwas einzubuddeln. Sie können ja durchblicken lassen…«
»… daß es sich um Nuggets handelt«, unterbrach ihn Holliday.
Der Marshal nahm eine Satteldecke herunter.
»Ich werde Rauchzeichen geben…«
Der Spieler ritt los.
Es war ein höllisches Unternehmen, auf das er da zusteuerte.
Wyatt Earp wußte es genau. Aber er wußte auch, daß er den Spieler nicht hätte zurückhalten können. Doc Holliday hatte eine fatale Art an sich, den tödlichen Kampf, vielleicht gar den Tod selbst, überall zu suchen.
*
Poul Riva stand breitbeinig auf dem steinernen Podest und blickte auf die Gefangenen hinunter, als ihm der Coltman Joe Hearst ein Zeichen gab.
Riva ging zu ihm hinüber.
Hearst kniete auf einem Felsvorsprung, von dem aus der ewig mißtrauische Mann die ganze Ebene überblicken konnte.
»Ein einzelner Reiter«, sagte er nur.
Riva nahm das Fernrohr heraus, das er in der Station erbeutet hatte, und beobachtete den Fremden, der da im Trab herankam.
»He, wie sieht der denn aus!«
Auch Hearst blickte durch das Glas. Er schüttelte den Kopf. »Komische Type!«
Riva kratzte sich hinterm Ohr. Er hatte ein Auge für Leute, die Geld hatten. Und dieser Mann, der da kam, sah nach Geld aus. Und Geld könne man nie genug haben. Well, die Beute aus der Station war beträchtlich gewesen, wenn auch, wie sich nach dem Zählen ergeben hatte, nicht so groß, wie der Bandenführer erhofft hatte.
»Den Kerl will ich hierher haben!« befahl er.
Hearst knurrte. »Willst du nicht erst die andere Sache erledigen?«
»Anschließend, es wird ein Abwaschen!«
Sie brauchten den Fremden gar nicht erst einzufangen, er hielt geradewegs auf die Gesteinspyramide zu.
Riva ließ ihn von Oakland und Deeger holen.
Doc Holliday hatte das einfältigste Gesicht der Welt aufgesetzt, als die beiden Tramps ihn zwischen sich nahmen und zu ihrem Anführer brachten.
Mike Everett, der kahlhäuptige, knorrige Stations-Boß, hatte mit einem winzigen Hoffnungsschimmer in der Brust aufgeblickt, als die Bewegung in die Bande kam und endlich der Fremde auftauchte. Als er aber einen Blick auf ihn geworfen hatte, senkte er mit einem tiefen Seufzer entmutigt den Kopf.
Dieser Mann würde sich selbst nicht retten können, geschweige denn, ihnen Rettung bringen.
Holliday ließ sich bis vor Riva führen und stieg dann so umständlich aus dem Sattel, daß die Tramps ein hämisches Grinsen nicht verbeißen konnten.
»Mister!« begann Holliday, wobei er sich sofort instinktiv richtig an den Anführer der Bande wandte, »da drüben, schnell – Sie müssen rasch handeln, sonst ist es zu spät!« Aufgeregt hatte er die Worte hervorgestoßen.
Riva ließ eine unangezündete Zigarette von einem Mundwinkel in den anderen wandern.
»Ach, und was tut sich da, he?« fragte er gedehnt und mit unverkennbarem Spott.
»Ich bin seit heute früh dort, weil ich nach der seltenen Andacorra medracilea suche…«
»Nach wem?«
»Nach – ach, Sie verstehen das Wort nicht, yeah, es ist eine seltene Eidechsenart. Ich bin Forscher, müssen Sie wissen, und…«
Rivas Gesicht wurde augenblicklich hart.
»Und diese Anda – Anda – dieses Viech ist also jetzt wohl da drüben irgendwo aufgetaucht, he?« knurrte er, wobei sich seine Rechte schon dem Revolverkolben näherte.
Holliday war diese Bewegung keineswegs entgangen. Der Bandenführer hätte genau um den Bruchteil einer Sekunde früher das tödliche Blei aus einem der elfenbeinbeschlagenen Frontierrevolver in der Brust gehabt, wenn er den Colt zum Schuß hochgenommen hätte.
»Keineswegs, Mister, die Andacorra medracilea ließ sich keineswegs blicken. Dafür kamen die Rothäute mit dem Gold.«
Die vier letzten Worte ließen die Tramps hochfahren und aufhorchen.
»Was…?« zischte Riva.
»Yeah, sie kamen und bemerkten mich glücklicherweise nicht. Wahrscheinlich deshalb nicht, weil sie ziemlich schwer an etwas zu schleppen hatten. Ich glaubte erst, es wäre eine Leiche. Vielleicht die Leiche eines Häuptlings, den sie da beisetzen wollten. Aber so schwer trägt man nicht an einer Leiche, außerdem gibt ein Toter kaum metallische Geräusche von sich.«
Riva schluckte.
Dann kam die Frage, mit der Holliday gerechnet hatte.
»Von wo kamen die Indianer?«
Da die Tramps selbst den Felsen drüben an der östlichen Seite passiert hatten, mußten die Indsmen schon von der anderen Seite gekommen sein, sonst wäre ihnen die Fährte der Rothäute unweigerlich aufgefallen.
»Sie kamen irgendwo aus dem Westen herüber«, entgegnete der Gamb-ler mit einfältigem Gesicht. »Schade, daß sie soviel Gold in eine Felsspalte senken wollen. Das findet man ja, selbst wenn man den Platz kennt, nicht mehr wieder.«
Da trat der ewig mißtrauische Hearst an den Spieler heran und riß an dessen Revers.
Das hatte noch kein Mensch ungestraft tun dürfen; aber der Gambler mußte es in dieser Situation hinnehmen.
Hearst fauchte: »Du gefällst mir nicht, Junge. Und was du da von den Rothäuten faselst, gefällt mir auch nicht, davon ist nämlich nicht ein Wort wahr!«
In diesem Augenblick stieß Riva einen Ruf der Verwunderung aus.
Drüben aus der Steinoase stieg eine fadendünne Rauchsäule in den azurblauen Himmel.
Wyatt Earps Stichwort war auf die Sekunde genau gekommen.
»Da!« brüllte auch Oakland, »Rauchzeichen!«
Die Rauchsäule wurde immer wieder unterbrochen.
Der Marshal hatte den Sträfling zu dieser Arbeit mit herangezogen. Genau nach Art der Indianer gaben sie aufsteigenden Rauch mit einer an den vier Enden gehaltenen Decke frei und erstickten ihn wieder.
Der Missourier kannte die Rauchzeichen der Comanchen gut genug, um sie nachahmen zu können.
Riva war wie elektrisiert. Er spie die immer noch nicht angezündete Zigarette aus und rannte zu seinem Pferd.
»Vorwärts, Männer!«
Die drei anderen kletterten ebenfalls auf die Gäule.
Nur Hearst blieb noch stehen.
»Was wird mit den Wells Fargo-Strolchen?«
»Die bleiben hier, die kannst du bewachen!«
Und schon stoben die Banditen davon.
Hearst sah ihnen wütend nach. Und schon machte er den ersten Fehler. Er stieß Holliday an.
»Du hast auch einen Waffengurt umhängen, Amigo. Schätze, so was braucht keiner, der hinter Eidechsen herkriecht. Komm, Junge, gib mir den Revolver. Ich habe mehr Verwendung dafür.«
Träge und niedergeschlagen blinzelten die Wells Fargo-Männer zu den beiden hinüber.
Hearst hatte seinen Revolver die ganze Zeit über in der Hand gehabt.
Und plötzlich hatte auch der Fremde einen Colt in der Hand. Allerdings mit dem Kolben nach vorn.
Als Hearst danach greifen wollte, wirbelte der vernickelte Revolver herum und lag schußbereit in der Rechten des Georgiers.
Hearst schluckte und wich einen Schritt zurück.
Aber schon prallte die Stiefelspitze des Gamblers unter seine rechte Hand; der Navycolt des Banditen flog im hohen Bogen zur Seite.
Hearst starrte den Spieler an.
»He – was – war denn das?«
»Ein kleiner Spaß. Wir Eidechsenfreunde haben das manchmal so an uns.«
Und in völlig verändertem Ton fuhr der Georgier fort, während er sich an Mike Everett wandte:
»Nehmen Sie seinen Colt auf, Mister. Schätze, daß Sie und Ihre Leute einige Worte mit dem Gentleman zu wechseln haben.«
Mit einem heiseren Schrei stürzte sich der Wells Fargo Chief auf die Waffe.
Und nur eine knappe Minute später hatten seine Männer den Revolverschwinger Hearst derart zusammengeprügelt, daß er nicht mehr auf den Beinen stehen konnte.
Doc Holliday saß längst im Sattel und ritt hinter Riva und den anderen her.
In wilder Hast sprengten die Tramps auf die vermeintliche Schatzstelle der Comanchen zu.
Immer noch, wenn auch schwächer werdend, stiegen von dort die indianischen Rauchzeichen gerade in den Himmel.
Unten vorm Felsen angekommen, warfen sich die Outlaws von den Gäulen und suchten den von dieser Seite ziemlich steilen Fels zu erklimmen.
Riva kam als erster auf die vordere Terrasse.
Oakland und Deeger folgten ihm.
Vorsichtig schlichen die Verbrecher auf eine etwas vorspringende, vom Flugsand rundverschlissene Gesteinsnase zu, als statt des erwarteten Indianers plötzlich ein hochgewachsener weißer Mann vor ihnen stand.
Riva blieb wie angewachsen stehen.
»Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Earp.«
»Earp…?«
»Yeah, Wyatt Earp.«
Riva wich einen Schritt zurück und tastete nach seinem Revolver.
Wyatt Earp! Damned! Was hatte das zu bedeuten?
Oakland schob sich hinter Deeger und packte plötzlich seinen Colt.
Da flog der große sechskantige Revolver in die linke Faust des Marshals.
»Nicht doch, Mister, das bringt Unglück!«
Riva keuchte: »Was wollen Sie von uns?«
»Hat Ihnen Doc Holliday das nicht ausgerichtet? Tut mir leid. Er ist sonst aufmerksamer.«
»Doc Holliday?« kam es kreischend aus drei heiseren Kehlen.
»Yeah!« tönte es da hinter ihnen.
Der Georgier lehnte vorn auf der Terrasse. Auch er hatte seinen Revolver in der Hand.
Riva warf den Kopf zur Seite und starrte zu der großen Gesteinspyramide hinüber, wo er seinen Kumpan Hearst wußte.
Holliday der die Gedanken des Banditen erraten hatte, schüttelte den Kopf.
»Nein, Ihr Freund ist verhindert, Mister. Leider. Die Wells Fargo Boys haben ihn arg strapaziert. Schätze, daß es Ihnen in einer Viertelstunde nicht sehr viel besser gehen wird…«
*
Nach diesem Aufenthalt ritten Wyatt Earp und Doc Holliday weiter nach Westen.
Hardac, der unentwegt auf eine Fluchtgelegenheit gelauert hatte, hielt sich mit gesenktem Kopf zwischen ihnen. Die Umsicht, mit der der Marshal vorging, hatte ihm auch die letzten Hoffnungen geraubt. Immer, wenn Fremde in die Nähe kamen, die ihm vielleicht hätten beistehen können, brachte der Marshal ihn auf Nummer Sicher, fesselte und knebelte ihn derart, daß er eben nur noch Luft holen konnte.
Der Haß des Verbrechers auf den Gesetzesmann Earp wuchs ins Unendliche.
Und der gnadenlose Ritt durch den großen Sand ging weiter.
Am darauffolgenden Abend erreichten sie Redwater, eine kleine texanische Stadt, die vor Jahren durch den Schießer Hal Flanagan im ganzen Westen bekannt geworden war.
Wyatt wartete die Dunkelheit ab und ritt dann erst in die Stadt ein. Es war nicht unbedingt notwendig, daß der Gefangene gesehen wurde.
Vorm Sheriffs Office rutscht der Marshal aus dem Sattel.
Jerry Owen war ein grauhaariger Bursche in den Fünfzigern, seine Figur war im letzten Jahrzehnt vom Bier und auch vom Essen ziemlich aus dem Leim gegangen.
Er hatte sich gerade der notwendigen Beschäftigung des Fußnägelschneiders hingegeben, als der Missourier eintrat.
Wyatt nannte seinen Namen.
Der grauhaarige Sheriff sprang auf.
»Wyatt Earp? Teufel noch, das ist doch nicht wahr!« brüllte er im tiefsten Baß.
Wyatt machte ihm klar, daß er für die Nacht einen Gefangenen im Jail unterbringen möchte.
Owen nickte. »Selbstverständlich. Sie können eine ganze Bande bei mir unterbringen, Marshal. Das Jail ist stabil, und die beiden Zellen sind bullensicher.«
Wyatt bedankte sich und ging hinaus.
Rasch schlüpfte der Sheriff in seine Stiefel, riß die Kerosinlampe vom Tisch und kam auf den Vorbau.
Als Wyatt den Sträfling vom Pferd nahm, fiel ein heller gelblicher Lichtschein auf dessen Gesicht.
Ein untersetzter magerer Mann mit schrägstehenden Augen und tief in die Stirn wachsendem Haar hatte das Gesicht Jack Hardacs gesehen, zuckte zusammen und schob sich in eine Türnische, wo er den Transport des Banditen hinauf ins Jail beobachtete.
Langsam ging er vorwärts und blieb dann neben der offenen Officetür stehen.
Plötzlich zuckte ein Schwefelholz vor seinem Gesicht auf.
»Hallo, Mister, alter Freund von Ihnen, der den Sheriff da für eine Nacht zu Besuch hat, he?«
Doc Holliday hatte den Mann bemerkt und war ihm auf leisen Sohlen gefolgt.
In den Augen des anderen glimmte es grünlich auf.
»Freund? No, Mister. Wie kommen Sie darauf. Man ist eben neugierig in so einer kleinen Stadt. Schließlich wird nicht alle Tage ein Bandit hier ins Jail gebracht.«
»Genug Strolche gäb’s schon hier«, entgegnete der Gambler kühl, während er das Zündholz an die Zigarette brachte.
Der andere nickte und entgegnete mit krächzender Stimme:
»Yeah, da können Sie recht haben.«
Holliday lehnte sich gegen die Wand.
»Der da ist nur ein kleiner Fisch. Ein Rinderdieb. Ich weiß aber genau, daß es hier ganz andere Halunken gibt…«
Der Mann sah ihn plinkernd an.
»Yeah«, meinte der Georgier, »Hardac ist ein harmloser Bursche.« Und plötzlich wandte er dem anderen das Gesicht zu. »Sie kennen ihn doch…?«
»Hardac…? Nein, ich…«
»Thanks, Mister. Sie kennen ihn also. Ich hatte seinen Namen nämlich absichtlich falsch ausgesprochen. Sie aber haben ihn eben richtig genannt…«
Da federte der Mann zurück und warf sich in das Dunkel, das zwischen dem Sheriffs Office und dem nächsten Haus herrschte.
*
Jack Hardac saß im Jail. Immer noch trennten ihn über zweihundet Meilen vom Straflager. Zweihundert Meilen – und auf jedem Yard würde er weiterhin auf Flucht sinnen.
Wyatt Earp und Doc Holliday hatten gegenüber im Grand-Hotel Quartier genommen.
Jerry Owen war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Der Missourier hatte ein Gefühl dafür. Dieser grauhaarige Sheriff würde den Gefangenen bewachen, als ob er allein für ihn verantwortlich wäre.
Es war gegen ein Uhr in der Nacht. Der Sheriff hockte an seinem Schreibtisch und blickte auf seine rissigen, mit braunen Flecken besäten Hände. Vor ihm lag ein aufgeschlagenes Buch. Er hatte hin und wieder darin gelesen. Aber das Lesen beim zuckenden Licht der Kerosinlampe schmerzte seine Augen.
Hinzu kam, daß er das Buch schon dreimal gelesen hatte. Es war der Bericht von der Erstürmung des Fort Orea von Frank Hellmers.
Jerry Owen selbst hatte den Kampf auf Seiten der Südarmee erlebt.
Es war jener Tag gewesen, an dem eine dicht hinter ihm krepierende Granate sein rechtes Trommelfell zerrissen hatte. Es war der düsterste Tag im Leben des Texaners Jeremias Owen gewesen. Seit jenem Tag war sein Hörvermögen um mehr als die Hälfte zusammengeschrumpft, denn das linke, von nun an stark überanstrengte Ohr hatte plötzlich aus irgendwelchen Gründen auch einen Teil seiner Hörkraft verloren.
Diesem Umstand war es zuzuschreiben, daß der Sheriff die Angewohnheit hatte, oft mitten in der Bewegung innezuhalten, um zu lauschen.
Auch jetzt richtete er sich steil auf und lauschte mit angehaltenem Atem in die Stille des Raumes.
Es rührte sich nichts.
Owens verkrampftes Gesicht entspannte sich, um aber augenblicklich wieder einen lauschenden Ausdruck anzunehmen.
Ein winziges Geräusch war an sein Ohr gedrungen.
Der Sheriff erhob sich, nahm seinen Revolver aus dem Halfter und ließ die Trommel leise rotieren.
Das Magazin war gefüllt.
Fast lautlos näherte sich Owen der Tür, um sie plötzlich mit einem Ruck aufzureißen.
Er sah den Hieb kaum noch, der krachend auf seinen Schädel nieder-sauste.
Mit einem ächzenden Röcheln brach der schwere Mann in sich zusammen.
Wie ein Schatten huschte der andere, der ihn niedergeschlagen hatte, in den Raum und zerrte den betäubten Sheriff von der Tür.
Jack Hardac war bei dem dumpfen Aufprall von seiner Pritsche hochgefahen und starrte entgeistert zur Tür hinüber. Völlig verdutzt blickte er auf den ohnmächtigen Sheriff und dann auf den Mann, der ihn niedergeschlagen hatte.
Der kam ganz langsam auf die Zellentür zu. Ein schwarzes Tuch verdeckte die ganze untere Hälfte seines Gesichtes.
Hardac suchte die Augen des anderen zu durchforschen. Ein würgendes Gefühl saß plötzlich wie ein Kloß in seiner Kehle. Da öffnete der andere die Lippen.
»Freut mich, dich wiederzusehen, Jack.« Beim Klang dieser Stimme flog der Kopf des Sträflings hoch.
»Griffith! Fred Griffith!« brach es heiser aus der Kehle des Mörders.
Der Eindringling nahm mit einer raschen Bewegung die Maske vom Gesicht. Es war der Mann, der vorhin neben Doc Holliday in der Office-Tür angesprochen worden war.
Hardac schluckte.
Das ist sie, die Chance! Die große Chance, auf die er so lange gewartet hatte.
War sie es wirklich? Brachte ihm der einstige Genosse, mit dem er oben in Utah monatelang zusammen geritten war, die Freiheit?
Hardac erinnerte sich noch sehr genau an diesen Fred Griffith. Es war ein verschlagener untersetzter Bursche, der nie viel mehr als sein eigenes Wohl im Auge gehabt hatte.
Und wie war das damals am Indian Creek gewesen? War es nicht gerade dieser Frederic Griffith gewesen, der mit der kleinen Beute, die sie zu viert auf einer Ranch gemacht hatten, geflüchtet war?
Doch! Hardac würde es bis zu seiner letzten Stunde nicht vergessen, was er sich damals geschworen hatte: Wenn ich diesen Fred Griffith noch einmal irgendwo wiedersehe, werde ich ihn ohne Anruf niederschießen!
Und in seinem Haß auf seine einstigen Kameraden war Hardac hingegangen und hatte nachts Zettel an die Türen der Sheriffs Bureaus geheftet, auf die er den Namen des Banditen Griffith und die von ihm verübten Verbrechen niedergeschrieben hatte. Und ausgerechnet dieser Frederic Griffith tauchte jetzt, vielleicht in allerletzter Minute, hier vor seiner Zellentür auf.
Hardacs Unterkiefer bebte. Er senkte den Kopf ein wenig und bohrte den Blick in die Augen des anderen.
»Laß mich raus, Fred.«
Griffith nickte. »Sicher, aber vorher hätte ich noch ganz gern was gewußt.«
»Laß mich raus. Wir können draußen alles besprechen.«
Griffith schüttelte den Kopf.
»Nein, Brother. Die Frage wirst du mir noch hier beantworten, schließlich kenne ich dich.«
Hardac war schweißnaß. Das Hemd klebte ihm am Körper.
»Mach die Zelle auf«, keuchte er. »Du weißt nicht, wer mich hergebracht hat.«
»Das interessiert mich auch nicht«, entgegnete der andere. »Mich interessiert etwas ganz anderes. Der Bankraub vor drei Jahren in Santa Fé, Hardac, der roch verdammt nach deiner Arbeit. Sheriff Brock kam zwar für die Sache nach Fort Worth, aber ich fresse meinen alten Hut, wenn er das Gold auf die Seite gebracht hat.«
»Das weiß ich nicht«, entgegnete Hardac. »Ich habe versucht, ihn danach zu fragen. Im vergangenen Monat, als ich zusammen mit ihm aus dem Fort ausbrach.«
»Ich habe davon gehört«, meinte Griffith lauernd. »Brock ist ja zurückgekehrt. Und ich fresse zu meinem Hut meine alten Stiefel, wenn er nicht nur deshalb weggewollt hatte, um einen Weg zu suchen, seine Unschuld zu beweisen.«
»Kann sein«, erwiderte Hardac ungeduldig. »Riegle endlich das Schloß auf. Wir können uns draußen bedeutend besser unterhalten.«
»Davon bin ich nicht überzeugt«, antwortete Griffith.
»Was willst du also?« fauchte Hardac.
»Wo hast du das Gold gelassen, als Brock hinter dir her war?«
»Eine seiner Kugeln hat den Riemen zerschnitten, der die beiden schweren Taschen hielt. Erst rutschte mir die eine, dann die andere vom Sattel. Der Sheriff war so nah, daß ich keine Chance mehr hatte, abzusteigen, und einen Revolverkampf mit ihm konnte ich auch nicht riskieren, schließlich wußte ich ja, wer da hinter mir her war, und wäre ein Narr gewesen, wenn ich mich ausgerechnet mit Sheriff Brock auf einen Revolverkampf eingelassen hätte.«
»Und? Wo ist das Gold?«
»Er muß es haben!«
»Wußte er, als er mit dir aus dem Fort fliehen wollte, daß du der Bursche warst, den er damals jagte?«
»Nein, ganz sicher nicht. Andernfalls hätte er mich kaum davonkommen lassen.«
Griffith feixte böse. »Well, Hardac, dann hat er auch nicht das Gold.«
Der Oregon Man zitterte am ganzen Leib vor Erregung.
»Laß mich doch endlich raus! Ich werde dir draußen alles sagen.«
»Nein, du sollst es mir hier sagen, und zwar jetzt.«
In Grifiths rechter Faust blinkte ein Messer.
Hardac wich vom Gitter zurück.
»Was soll das? Willst du mich erstechen? Well, vielleicht wäre das das beste, dann könnte niemand mehr erfahren, daß du vor vier Jahren drüben bei Syracuse den kleinen Deputy Jonny Miller umgebracht hast. Mit dem Messer…«
Griffith hatte die Linke um einen der Eisenstäbe geklammert und hielt das Messer wurfbereit in der Rechten.
»Wo ist das Gold? Sheriff Brock hat es nicht. Wir wissen beide, daß er es nicht hat.«
Da kam dem Mörder Hardac ein Gedanke, von dem er sich die Rettung versprach.
»All right, Fred.« Er kam wieder an das Gitter heran und krächzte: »Ich habe Brock beobachtet, wie er die Lederbeutel versteckte, und als er dann weg war, bin ich zurückgekommen, und habe sie geholt.«
Griffith atmete schwer. »Wo ist das Gold?«
Jack Hardac hatte Mühe, seine Stimme zu einem ruhige Ton zu zwingen.
»Ich werde dich hinführen. Und dann werden wir teilen.«
Die Gier nach dem Gold riß den Verbrecher Frederic Griffith in die Falle. Er war dem gerissenen Jack Hardac nicht gewachsen. Als die Gittertür aufsprang, riß Hardac dem einstigen Kumpanen das Messer aus der Hand, nahm auch den Colt blitzschnell an sich und schleuderte den Überrumpelten in die Zelle.
»So, Junge, und jetzt werde ich dir beweisen, daß Jack Hardac nicht nur mit dem Colt, sondern auch mit dem Messer umgehen kann.«
Als er die Klinge hochreißen wollte, flog die Tür auf, die die ganze Zeit über einen Spalt weit offengestanden hatte.
Wyatt Earp stand da. Er hatte den Revolver in der Hand. Ruhig fragte er:
»War eine ganz hübsche Geschichte, Hardac, die ihr beide mir da erzählt habt.«
Steif vor Schreck stand der Oregan Man da.
Da warf sich Griffith drinnen gegen die Gittertür.
»Schieß doch, du Idiot!«
Aber Jack Hardac schoß nicht. Die Hand, die den Revolver hielt, öffnete sich. Polternd fiel die Waffe zu Boden. Auch das Messer entglitt dem Sträfling.
»Du verdammter Idiot!« schrie Griffith mit sich überschlagender Stimme.
Mit gesenktem Kopf murmelte der Sträfling:
»Der Idiot bist du. Er ist Wyatt Earp.«
Doc Holliday kam herein und beugte sich über den Sheriff.
»He, Mr. Owen. Machen Sie die Augen auf. Der kleine Tanz ist vorbei. Statt eines Gefangenen haben Sie jetzt zwei zu bewachen.«
Wyatt schob Hardac in die Nebenzelle.
Der Georgier zog seine Uhr und warf einen prüfenden Blick darauf.
»Vielleicht sollten wir besser hierbleiben. Schließlich ist es nicht ausgeschlossen, daß unser Schützling hier noch weitere Freunde hat. Scheint mir, daß wir wieder einmal die richtige Stadt erwischt haben.«
*
Genau einundvierzig Tage nach seiner Flucht wurde der Mörder Jack Hardac wieder in Fort Worth eingeliefert.
Der Kommandant bedankte sich bei Wyatt Earp, reichte auch dem Georgier die Hand und schickte dann einen kleinen ausgemergelten Burschen nach dem Neger Samuel Mitchell.
Als der hünenhafte Schwarze hereinkam, zuckte Hardac zusammen.
Der riesige Wächter hatte die furchtbaren Hiebe, die der Sträfling ihm versetzt hatte, überwunden und verrichtete bereits wieder seinen Dienst im Lager.
Der Captain befahl im schroffen Ton:
»Mitchell, Sie werden von nun an ständig einen entsicherten Revolver in der Hand tragen und den Sträfling Nummer siebenundsiebzig bewachen bis zur Verhandlung und dann bis zu dem Augenblick, da er gehängt wird.«
Der Schwarze nickte stumm. Er zog seinen alten Armee-Revolver und nahm den Hahn mit dem Daumen knackend zurück.
Jack Hardac war völlig in sich zusammengesunken. Plötzlich war er wieder der schwer magenkranke Mann, der er vor seiner Flucht gewesen war. Es war ganz offensichtlich, daß ihn nur die Flucht und die Freiheit aufgerichtet hatte.
Mit gesenktem Kopf schritt der todgeweihte Sträfling vor seinem Bewacher her.
Der Lagerkommandeur nickte zufrieden.
»Es gibt sicher keinen besseren Bewacher für ihn«, meinte er zu Wyatt Earp, »als den Schwarzen. Hardac hatte ihm damals bei seiner Flucht fast die Schädeldecke zertrümmert.«
Der Dodger Marshal verließ mit seinem Begleiter das Fort und ritt nach Norden davon.
*
Der schwarze Sam Mitchell führte Hardac in den breiten Barackenhof zum steinernen Südcamp hinüber.
Im großen Korridor des Lagers der Lebenslänglichen wurde gerade ein anderer Gefangener vorübergeführt: James Brock, der einstige Sheriff von Santa Fé.
Als Brock Hardac erkannte, blieb er stehen.
Hardac war ebenfalls stehengeblieben. Obgleich er den Schwarzen mit der entsicherten Waffe hinter sich wußte, sagte er mit gepreßter Stim-me:
»Sie haben mir damals die beiden Ledersäcke vom Pferd geschossen, Brock, und ich wüßte nur noch gern, ehe ich sterben muß, wer das Gold an sich genommen hat.«
Das Gesicht des einstigen Gesetzesmannes hatte sich versteinert. Mit einem Ruck wandte er sich ab und ging weiter.
Hardac wurde in seine Zelle geführt. Mit taumelnden Schritten ging er auf die harte Pritsche zu.
Plötzlich wallten Nebel vor seinen Augen. Er griff nach dem Pfosten der Pritsche, bekam ihn jedoch nicht zu fassen und sackte wie leblos in sich zusammen.
Die Rückführung in sein Elendsquartier hatte den Verbrecher völlig niedergeschmettert. Sein kaum verheiltes schweres Magengeschwür brach wieder aus, und in den folgenden Tagen schleppte sich der Sträfling Nummer 77, von dem jeder wußte, daß er in Kürze gehängt werden würde, wie ein Skelett durch die Korridore, wenn er zu seinem viertelstündigen Rundgang geführt wurde.
Wie ein Schatten folgte ihm ständig in drei Yards Abstand der schwarze Wächter.
Fünf Tage war Hardac wieder in der Anstalt, als er morgens erfuhr, daß Richter Jeffries gekommen sei und am frühen Nachmittag die Verhandlung, deren Urteil ja bereits feststand, gegen ihn führen würde.
Hardac hörte die Worte des neuen weißen Chief Sergeanten wie aus weiter Ferne.
Als er wieder auf seiner Pritsche kauerte, brach ihm plötzlich der Schweiß aus allen Poren.
»Er verurteilt mich zum Tode. Und dann werden Sie mich hinten auf dem Hof hängen…«
Plötzlich sprang er auf und rannte wie ein wildes Tier auf und ab.
Den Napf mit dem Essen rührte er nicht an.
Um zehn nach zwölf holte Mitchell ihn zum Rundgang ab.
Was hätte der todgeweihte Sträfling 77 wohl geantwortet, wenn ihm jetzt, in diesen hoffnungslosen Minuten, jemand gesagt hätte, daß er in genau zwölf Minuten das Rad seines Geschickes noch einmal herumwerfen könnte und würde? Daß er all dies, was er vor sechsundvierzig Tagen schon einmal getan hatte, noch einmal tun würde…
Sam Mitchell war nicht der Mann, der den vom Kommandanten vermuteten tödlichen Haß auf den Sträfling Nummer 77 hatte.
Das Herz des schwarzen Mannes war nach wie vor voll von Mitleid mit dem unseligen weißen Mann.
Er führte ihn durch den Hof, blieb hinter ihm, und als sie beim dritten Rundgang die hintere Hofecke erreichten, die von keinem Fenster eingesehen werden konnte, glaubte der Gefangene plötzlich nicht recht zu hören.
»Geh langsam. Da links neben dem grauen Stein liegt ein Stück Brot!« raunte es hinter ihm.
Hardac hielt auf den Stein zu, bückte sich und nahm das Brot an sich.
Damned, er hatte gar keinen Hunger!
Als er sich umwandte, sah er in das breite grinsende Gesicht des Negers.
Blitzartig zuckte ein höllischer Gedanke durch den Schädel des Verbrechers.
Und schon setzte er ihn in die Tat um.
Er riß den Fuß hoch – und der große Armee-Revolver flog dem Wächter aus der Hand.
Hardac warf sich auf die Waffe, fuhr zur Seite – und hätte die Eile gar nicht nötig gehabt, denn der langsam denkende schwarze Mann stand ganz steif da und starrte ihn nur aus großen, nicht begreifenden Augen an.
Hardac stieß den Colt vor.
»Vorwärts, Nigger, jetzt wirst du hinter mir her gehen. Und zwar genau drei Yards, wie immer. Du wirst die rechte Hand etwas nach vorn halten, daß es aussieht, als ob du den Colt bereithieltest. Du führst mich zum Außenhof! Und hör genau zu, Wollschädel. Ich halte den Revolver hier links unter meiner Jacke auf dich gerichtet. Bei der geringsten verdächtigen Geste jage ich dir sechs glühende Bleistücke in den Bauch! Hast du begriffen?«
Mitchell schluckte. Er hatte begriffen, yeah, das hatte er begriffen.
Hardac ging vorwärts. Mit leicht gesenktem Kopf wie immer.
Und der Schwarze folgte ihm.
Das erste Tor zum Steinbau wurde von Mitchell geöffnet.
Hardac hatte sich etwas zur Seite gestellt. Dann ging er voran. Immer so, daß er die Hand mit dem Revolver auf den Neger gerichtet hielt.
So kamen sie durch zwei Korridore bis zum Tor des weiten Außenhofes.
»Vorwärts!« knurrte Hardac. »Schließ auf!«
Der Schwarze stammelte: »Ich kann nicht. Kommandant mich bestrafen werden. Einsperren, erschießen…«
»Erschossen wirst du von mir, Blackboy, und zwar sofort, wenn du nicht gleich aufschließt!«
Mitchell gehorchte und öffnete das Tor mit zitternden Händen.
Er war zu sehr von seiner Lage beeindruckt, als daß ihm irgendein rettender Gedanke hätte kommen können.
Sie überquerten den breiten Sandplatz.
Hardac zischte: »Du sagst dem Kerl vorn am Haupttor, daß ich Zimmermann wäre und vorn am Corral zu arbeiten hätte. Laß dir ein Gewehr geben. Wenn du es jedoch durchlädst, schieße ich sofort!«
Das Unfaßliche geschah:
Der Posten nahm ein Gewehr aus dem Waffenständer und reichte es dem Neger. Dann öffnete er schweigend das Tor.
Der gebeugte Sträfling Nummer 77 war doch nur ein Häufchen Unglück in seinen Augen. Ein Verlorener, ein toter Mann.
Hardac sog die Luft vorm Tor ein.
»Vorwärts, zum Corral hinüber!« zischte er dem Schwarzen zu.
Der Neger folgte ihm.
Hardac ging so, daß er das Gewehr beobachten konnte. Seine Beine zitterten, schweißnaß klebte ihm das graue Hemd und auch die Drillichjacke am Leib.
Dann waren sie am Corral.
Hardac schob sich zur Seite, und als sie die ersten Pferde erreicht hatten, nahm er den Revolver nach vorn.
»Das Gewehr!« befahl er.
Mitchell reichte ihm die Winchester.
»Und jetzt ziehst du deine Jacke aus!«
Der Schwarze gehorchte.
Hardac klemmte die Jacke unter den linken Arm, dann suchte er mit eiskaltem Nerv zwei gute Pferde aus, schwang sich auf den Rücken des einen und wandte sich dann um.
Der Schwarze sah ihn aus weiten Augen an.
»Mister…«
Aber schon brüllte der große Revolver auf.
Der Neger wankte zurück und sackte dann zwischen den Pferden nieder.
Hardac stieß einen heiseren Schrei aus und trieb die beiden Pferde aus dem Corral.
In mörderischem Galopp sprengte er nach Norden davon.
Der Trupp des Wachpersonals, der ihm zehn Minuten später folgte, ritt der Hölle entgegen.
Jack Hardac schoß zwei der fünf Reiter aus dem Hinterhalt von den Gäulen.
Die anderen drehten zunächst ab, griffen dann den Flüchtling in einer Talsenke wieder an und büßten einen weiteren Mann ein, der ebenfalls schwer verletzt aus dem Sattel rutschte.
Jack Hardac kämpfte um sein Leben, das nie verwirkter war als noch vor einer Stunde. Er kämpfte wie der Teufel…
… und entkam ein zweitesmal.
Nie wieder sollte es einem Menschen gelingen, derart mühelos aus dem Straflager Worth zu entkommen. Von dieser Stunde an wurden die Wachen verdoppelt, die Richtlinien verschärft, nach denen sich Gefangene, auch in Begleitung eines Wächters, im Camp oder gar zum Haupttor hinaus bewegen durften.
Aber der Mörder Jack Hardac war ein zweitesmal durch die Sperrgürtel des Forts entkommen. Auf zwei schnellfüßigen Pferden preschte der Desperado nach Norden. Jede Stunde wechselte er das Pferd und war so selbst den drei besten Reitern des Straflagers überlegen, vermochte den Abstand zu ihnen ständig zu vergrößern und hatte am Morgen so viel Land zwischen sich und seine Verfolger gebracht, daß er sich eine Rast gönnen konnte.
Und wieder hatte der Verbrecher einen Toten auf seiner Fährte zurückgelassen: Der gutmütige aber etwas geistesschwache Negerwärter Samuel Mitchell hatte seine Weichherzigkeit diesmal mit dem Leben bezahlen müssen.
*
Wyatt Earp war nicht hinauf nach Kansas geritten. Er hatte sich oben auf der breiten Overland-Linie nach Westen gewandt.
Sein Ziel war Santa Fé.
Wortlos war Doc Holliday neben ihm geblieben. Als er erfuhr, wohin der Missourier reiten wollte, hatte er sich den Hut aus der Stirn geschoben und genickt.
»Well, ist ja auch eine schöne Stadt. Vielleicht haben wir ja da endlich mal keinen Ärger. Ich wollte schon lange mal im Golden Gate Saloon ein Spielchen machen…«
Er saß im Golden Gate Saloon am grünbezogenen Tisch und spielte mit dem jungen Banker Hampton. Gegen neun Uhr war der Tisch der beiden von Neugierigen nur so umstanden. Der junge Hampton war ein blendender Spieler, aber nach anfänglichen Gewinnen mußte er doch gegen den großen Gambler die Segel streichen.
Doc Holliday gewann in dieser ersten Nacht in Santa Fé ein Vermögen…
Währenddessen hatte der Missourier das große Sheriffs Office in der Mainstreet aufgesucht.
Vier Deputies schwirrten da herum und hantierten geschäftig mit Schriftstücken, mit abgelieferten Fundsachen und beschlagnahmten Waffen herum.
Wyatt erkundigte sich nach dem Sheriff.
Einer der Deputies, ein kleiner blonder Bursche, meinte:
»Kommen Sie später wieder, Mr. Bradley ist noch unterwegs.«
Wyatt hatte sich schon abgewandt.
Bradley?
Er blieb stehen. Heavens, sollte etwa…? Aber das konnte doch nicht möglich sein! Dan Bradley war doch kaum fünfundzwanzig Jahre alt, sollte der etwa hier Sheriff geworden sein?
Wyatt konnte sich zufällig an Bradley erinnern, weil der einmal vor Jahren zusammen mit seinem damaligen Boß, Sheriff Brock, oben in Dodge gewesen war, wo die beiden einen Viehdieb abholen mußten, den Wyatt eingefangen hatte.
Bradley, der kleine hartgesichtige Daniel Bradley! Kaum vorstellbar. Vor allem, da die Deputies hier teilweise älter und ganz sicher auch erfahrener waren als gerade er.
Wyatt stand noch auf dem Fleck und sann nach.
Da stieß ihn ein vierschrötiger Hilfssheriff an.
»Vorwärts, Cowboy, sieh zu, daß du rauskommst. Wir haben hier Arbeit! Außerdem stinkst du nach Kuh!«
Wyatt wandte sich um und sah dem Mann in die Augen.
»Ich würde mich ein wenig vorsichtiger ausdrücken, Kleiner«, versetzte er und wollte zur Tür.
Da riß der Deputy ihn herum und schnauzte ihn an.
»Hör zu, Kuhtreiber! Du befindest dich hier im Sheriffs Bureau von Santa Fé! Im Office von Mr. Bradley! Und nicht auf der Weide und auch nicht im Stall! Ist das klar? Und wenn es dir nicht klar sein sollte, werde ich es dir sofort klarmachen!«
Wyatt maß den etwa dreißigjährigen kräftigen Mann mit einem abweisenden Blick.
»Ich werde wiederkommen, wenn der Sheriff da ist«, sagte er halblaut und wandte sich um.
»Ted, bring dem Kuhtreiber Manieren bei«, rief da eine schrille Stimme von der Hintertür her.
Der vierschrötige Ted nickte und warf einen weit hergeholten Schwinger zum Kopf des Marshals.
Der Schlag ging fehl, dafür riß der linke Haken des Missouriers den Deputy von den Füßen.
Der dunkelhäutige Jimmy Gordon, der auch den Deputystern trug, warf sich dem Marshal in die Flanke und fiel unter einem knackenden Handkantenschlag wie ein Sack auf die blankgescheuerten Dielen.
»He, ihr lahmen Enten!« kam die schrille Stimme wieder von der Hoftür. »Was für einen Haufen von Hampelmännern habe ich mir denn da ange…«
Der Mann brach ab.
Wyatt hatte sich umgewandt und blickte in sein Gesicht.
Verwunderung auf beiden Seiten.
Dann brüllte der blonde hagere Mann in der Tür auf vor Lachen und schlug sich wieder und wieder aufs Knie. Mit einem Satz war er dann mitten im Office.
Links auf seiner Brust blinkte der große Sheriffstern.
»Wyatt Earp!« brüllte der Sheriff. »Ist denn das die Möglichkeit! Marshal Earp aus Dodge! Damned, Blick, Mertens, kommt her und drückt ihm die Hand. Es muß eine Ehre für euch sein, ein paar Ohrfeigen von dem Mann eingesteckt zu haben! Es ist Wyatt Earp!«
Die Burschen, denen es eine Ehre zu sein hatte, einen Knock-out aus den Fäusten des Dodger Marshals einzustecken, kamen geduckt heran.
Wyatt reichte ihnen die Hände, dann sah er wieder den Sheriff an.
»Dan Bradley – oder nicht?«
Der Sheriff nickte. »Freut mich, daß Sie sich meiner noch erinnern, Wyatt. Sehen Sie, damals war ich ein kleiner Wicht, und heute bin ich selbst Sheriff. Sheriff von Santa Fé! von der wichtigsten Stadt des Westens!«
Er sah sich im Kreis seiner Deputies um und fügte dann rasch, als er deren betretene Gesichter sah, hinzu:
»Well, ich bin natürlich noch kein so berühmter Mann wie sie, Marshal, aber das kann ja noch werden!«
Wieder schlug er seine dröhnende, nicht ganz echte Lache an und wandte sich dann der Tür zum Nebenraum zu.
»Kommen Sie, Wyatt. Hier gibt’s noch Nebenräume. Es ist noch so eng und primitiv hier wie oben bei Ihnen in Dodge! Früher bei Brock war das noch anders. Der legte auch keinen Wert auf Platz. Ich brauche Platz, verstehen Sie?«
Wyatt nickte, obgleich er absolut nicht verstand.
Bradley entkorkte eine Flasche, aber Wyatt lehnte den Drink ab.
Bradley steckte sich eine Zigarette an und lachte.
»Yeah, ich erinnere mich, Sie haben ja schon damals nicht getrunken. – Damned, Wyatt Earp in Santa Fé! Ich kann es kaum glauben! Was hat Sie hergeführt? Kann ich Ihnen helfen? Wie sieht’s in Dodge aus? Ist Bat Masterson noch bei Ihnen?«
»Yeah«, unterbrach ihn der Missourier etwas mißmutig.
Bradley lehnte sich mit einem Ruck über den Tisch.
»Und Doc Holliday – wie geht’s ihm?«
»Gut.«
»Ich habe damals den einen Abend dazu benutzt, ihm im Long Branch Saloon beim Pokern zuzusehen. Allmächtiger, war das ein Spieler! Er hatte die beiden Jenkins Brothers damals gegen sich. Die geriebensten Kartenhaie, die ich je gesehen habe. Sie waren vor vier Monaten auch in Santa Fé! Damned, hat Holliday sie abfahren lassen! Es war eine wahre Freude, dabei zuzusehen!«
Er redete viel und laut, der junge Sheriff. Offensichtlich machte es ihm Freude, sich selbst reden zu hören.
Und sehr schnell brachte er auch das Gespräch auf eine Person. Er sprach von seinen Erfolgen als Verbrecherjäger, von seinem Ansehen in der Stadt bei den Bürgern, von seinen Erfolgen bei den Frauen und von all den Dingen, die er neu eingeführt hatte.
»Sehen Sie, zum Beispiel hier das größere Office, das ist ein Fortschritt, Wyatt. Das müssen Sie zugeben. Der Sheriff von Santa Fé kann doch nicht in einer kleinen Holzbude sitzen…«
Zum erstenmal seit einer halben Stunde unterbrach ihn der Marshal.
»Ich weiß nicht, Bradley. Ich glaube, daß es gar nicht darauf ankommt, was für ein Büro ein Gesetzesmann hat. Viel wichtiger erscheint mir, was er leistet.«
Bradley fuhr hoch und blähte sich auf.
»He, wie meinen Sie das?« Dann lachte er wieder dröhnend los. »Es ist Ihr Glück, daß Sie Wyatt Earp sind! Ich reagiere blitzschnell! Well, ich weiß, daß Sie einer der schnellsten Männer im Westen sind – aber – nun ja, was heißt, was er leistet? Denken Sie etwa, ich leiste nichts? Dann sind Sie auf dem Holzweg. Nie zuvor hat ein Sheriff von Santa Fé soviel geleistet wie ich. Ich…«
»Wie war das mit Brock?« fragte Wyatt wie nebenbei.
Der Sturmlauf des jungen hartgesichtigen Gesetzeshüters war unterbrochen. Er setzte sich nieder und legte die merkwürdig unförmigen Hände mit den krallenartigen Fingern zusammen.
»Mit Brock? Wie soll es gewesen sein? Er – er war eben Sheriff hier…«
»Und ziemlich lange, nicht wahr?«
»Yeah.« Bradley zog die Schultern hoch. »Doch, ja, ein paar Jahre waren es schon.«
»Und jetzt?«
»Was jetzt? Wissen Sie vielleicht nicht, was passiert ist?«
Wyatt stellte sich unwissend.
»Was ist passiert?«
Bradleys Gesicht wurde plötzlich noch härter, fast schien es Wyatt so, daß es auch einen Schein dunkler wurde.
»Brock sitzt in Fort Worth.«
»Ah…?«
»Yeah. Er ist zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt worden.«
»Weswegen?«
»Wegen Raubes –?und Mordes.«
Wyatt nahm eine seiner großen schwarzen Zigarren aus der Tasche, biß die Spitze ab und riß ein Zündholz an. Dann lehnte er sich zurück.
Bradley stand auf und ging mit unruhigen, schlecht abgemessenen Schritten auf und ab. Während er sprach, begleitete er seine Worte unentwegt mit theatralischen Gesten.
»Well, ich sehe, daß Sie erstaunt sind. Wir waren es auch, das kann ich Ihnen schwören, Earp. Aber eines steht fest: Ich habe immer gewußt, daß er nicht in Ordnung war. Ich habe es gewußt und auch dem Mayor gesagt.«
»Ach…?« Wyatt zog die dunkel geschwungene Braue des linken Auges hoch in die Stirn. »Sie haben es dem Mayor gesagt?«
»Ja, damals schon, als sie ihn griffen…«
»Wer griff ihn?«
»Nun, eigentlich gestellt hat ihn niemand. Er kam ja selbst zurück, nachdem er das Gold weggeschafft hatte.«
»Aha.«
Bradley zog die farblosen Brauen hoch, die über der Nasenwurzel zusammengewachsen waren.
»Weshalb interessiert Sie der ganze alte Kram? Es ist vorbei. Brock hatte damals zwölf Jahre bekommen. Und als er vor einiger Zeit versuchte, aus dem Straflager auszubrechen, hat er einen Wächter ermordet. Jetzt hängt er fest – für immer.«
Wyatt lauschte dem Klang dieser letzten Worte nach. Fast schien es ihm, dem empfindsamen Mann so, als schwinge in ihnen ein winziger Ton von Zufriedenheit und sogar Freude mit.
War es nur die Freude darüber, daß der Mann, der hier in der Reihe der Sternträger wirklich einen großen Namen gehabt hatte, endgültig vernichtet war?
War es die Zufriedenheit über den eigenen Erfolg? Über den Aufstieg vom kleinen, letzten Deputy zum Sheriff von Santa Fé?
Wyatt sog bedächtig an seiner Zigarre und forschte durch den Tabakrauch in dem harten, schon von scharfen Falten gezeichneten Gesicht des jungen Sheriffs.
Zweifellos hatte dieser Mensch eine ganz beachtliche Energie, sonst hätte er es nie in seinen Jahren zu diesem Job bringen können.
Aber wie – wie war er Sheriff von Santa Fé geworden?
Der Missourier stellte diese Frage nicht.
Er erhob sich und meinte, daß er anderntags vielleicht noch einmal reinschauen wolle, ehe er die Stadt verlassen würde.
Bradley nickte und meinte wort-reich, es würde ihn sehr freuen.
Wyatt war schon an der Tür, als er diesen Worten nachhorchte.
Diesmal spürte er es ganz genau: sie waren nicht echt.
Im Gegenteil: Sheriff Bradley legte nicht den geringsten Wert darauf, ihn noch einmal hier in seinem Office zu sehen.
Weit nach Mitternacht erhob sich der Georgier vom Spieltisch.
Der Bankierssohn saß mit bleichem Gesicht da und starrte auf seine schlanken Hände, die leise zitternd auf dem grünen Filzbezug lagen. Dicke Schweißperlen saßen auf seiner Stirn.
Holliday hatte sich eine seiner langen russischen Zigaretten angezündet, nahm einen Schluck von seinem Brandy und meinte:
»Und jetzt – gibt’s Ärger mit dem Vater?«
Der junge Mann hob den Kopf. Ein müdes Lächeln lag um seinen vielleicht etwas zu weichen Mund.
»Ärger? Nein, es war mein Geld. Und ich wußte ja, gegen welchen Gegner ich spielte. Ich hatte keine Chance gegen Sie, Doc Holliday!«
Der Georgier, der genau wußte, weshalb Wytt Earp hierhergeritten war, ließ sich auf der Tischkante nieder und beugte sich zu dem jungen Bankier.
»Ich möchte mein Geld gern bei Ihnen anlegen, Mister. Ich hoffe, daß es da gut liegt.«
Der andere nickte.
»Yeah, da liegt es gut.«
»Sicher gibt es eine Menge Leute, die sich bei Ihnen derart gesichert haben.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, ich hoffe doch, daß nicht nur Ranchergeld, das doch immer wieder beim nächsten Herdenkauf abgeholt wird, neben meinen Dollars liegen wird.«
Der junge Bankier erwachte aus seiner Lethargie.
»Da können Sie ganz beruhigt sein, Doc, wir haben eine Menge wohlhabender Bürger in der Stadt.«
Holliday richtete sich wieder auf und sah zur Theke hinüber, wo er eben den Marshal entdeckte.
»So schlimm wird’s auch wieder nicht sein. Santa Fé ist natürlich schon eine größere Stadt, aber zu wirklichem Reichtum kommt hier so leicht ganz sicher auch niemand…«
Eine Viertelstunde später wußte der Gambler aus Dodge City jeden Namen der Leute, die mehr als fünfhunderttausend Dollar auf der Bank stehen hatten.
Holliday verabschiedete sich mit dem gelangweiltesten Gesicht der Welt und schob hinaus. An der nächsten Straßenecke holte der Marshal ihn ein.
»Was erfahren?«
»Nicht allzuviel«, entgegnete Holliday. Dann berichtete er, was er herausgebracht hatte.
Wyatt schrieb sich die Namen sofort auf, dann erzählte er von seinem Besuch im Sheriffs Office.
»Bradley?« kam es überrascht von den Lippen des Spielers. »Das ist doch nicht möglich. Der kleine blonde Bursche mit den hellen Augen, den Brock Babyface nannte?«
Richtig, jetzt erinnerte sich auch Wyatt daran, daß Sheriff Brock seinen jungen Begleiter damals Babyface genannt hatte.
Holliday schnippte seine Zigarette in hohem Bogen auf die Straße.
»Halten Sie es für möglich…?« Er sprach den Satz nicht zu Ende.
Der Marshal hatte die breiten Schultern bereits nach den ersten Worten seines Freundes hochgezogen.
»Wer kann das sagen. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, daß er sich ziemlich laut benahm. Natürlich kann ich mir das einbilden, aber irgend etwas scheint mir mit ihm nicht zu stimmen. Vielleicht ist es etwas ganz anderes. Vielleicht fühlt er sich nur unsicher…«
»Und vielleicht haben Sie ihn erst recht unsicher gemacht. Denn wer kann einem jungen ehrgeizigen Sheriff denn ungelegener kommen als ausgerechnet Wyatt Earp?«
»Ich habe eine ganze Menge Freunde unter den jungen Sheriffs.«
»Ich weiß, aber ein ehrgeiziger Bursche möchte selbst strahlen.«
Wyatt überlegte: Was war mit diesem Sheriff Bradley? Hatte er irgend etwas zu verbergen? Behandelte er jeden Menschen so, mit dem er zusammenkam? Oder war es sein wirkliches Wesen, seine Art, so aufzutreten? Vielleicht hatte ihn der Stern so aus dem Lot gebracht. Ausgeschlossen war das nicht. Schließlich war es ja auch kein geringer Job, Sheriff von Santa Fé zu sein.
Die beiden Männer gingen langsam über die Vorbauten weiter.
Plötzlich ergriff Wyatt den Georgier am Rockärmel.
Von der anderen Seite kam ein mittelgroßer Mann mit weitausholendem sporrenkirrendem Schritt auf die
diesseitigen Stepwalks zu. Links auf seiner Brust blinkte hell der Sheriffstern.
Holliday raunte dem Marshal zu:
»Lassen Sie mich einen Augenblick mit ihm sprechen. Vielleicht erkennt er mich nicht.«
Wyatt nahm die Schultern hoch.
»Geben Sie sich nur keinen falschen Hoffnungen hin, er hat mir vorhin noch von Ihnen erzählt.«
»Well, ich werde es trotzdem versuchen. Mich erkennen die Leute nicht so leicht wieder wie Sie.«
Wyatt verschwand in einer Seitengasse.
Holliday blieb im Dunkel der Vorbauten und wartete, bis Bradley auf seiner Höhe war.
»Evening, Sheriff«, sagte er halblaut.
Bradley blieb stehen und tippte an den Hutrand. Er sah im diffusen Licht, das aus einem Spielsalon kam, nur undeutlich die Gestalt des Georgiers –?und er erkannte ihn nicht.
»Fremd in der Stadt.«
»Yeah. Ich suche ein gutes Quartier.«
Bradley maß den Gambler prüfend. Hm, der Mann war gut gekleidet, man konnte ihm wohl unbedenklich das Astoria empfehlen.
Holliday bot ihm dafür eine Zigarette an.
Das war ziemlich riskant, da der Sheriff im Aufflackern des Streichholzes das Gesicht des anderen hätte sehen können.
Aber er erkannte ihn nicht.
Holliday stellte noch ein paar belanglose Fragen und tat dann plötzlich sehr erstaunt.
»He, sind Sie etwa der Sheriff selbst? Bradley?«
»Yeah…«
»Damned, das freut mich dann aber ganz besonders.« Holliday reichte ihm die Hand und drückte die kräftig. »Habe eine ganze Menge von Ihnen gehört, Mr. Bradley!«
Ein paar Minuten später hatte der Sheriff dem Georgier mehr erzählt, als er ihm erzählen durfte. Er war der überlegenen Intelligenz des Spielers nicht gewachsen und hatte sich tatsächlich aushorchen lassen.
Holliday verabschiedete sich, er hatte es ganz plötzlich ziemlich eilig und schlug dann absolut nicht die Richtung zu dem ihm empfohlenen Hotel ein.
Bradley blickte hinter ihm her. So, dachte er, dem habe ich jetzt Achtung vor mir eingeflößt, der verging ja fast vor Ehrfurcht und Respekt!
Der vor Ehrfurcht und Respekt fast vergangene Mann verschwand in der Seitengasse und sah bald die Gestalt des Missouriers vor sich.
Sie gingen nebeneinander weiter die Gasse hinunter.
»Er hat mich nicht erkannt.«
Wyatt schüttelte den Kopf. »Wie ist das möglich?«
»Das kann ich Ihnen sagen: Der aufgeblähte Pfau sieht nur noch sich selbst. Er hat mir seinen Kampf um den Stern geschildert. Und bei der Sache kam ziemlich häufig der Name Hampton vor.«
»Hampton? Hier gibt’s eine Hampton-Bank.«
»Eben, und der junge Hampton ist sein Freund…«
In dieser Minute ritt von Osten her ein Mann in die Stadt. Er sah elend und heruntergekommen aus. Das Tier, auf dem er saß, schleppte sich nur noch vorwärts. Auch der andere Gaul, den der Mann an der Führleine hielt, trottete nur noch müde vorwärts.
Jack Hardac hatte Santa Fé erreicht.
Und diesmal war er so entstellt, daß ihn nicht einmal seine eigene Mutter wiedererkannt hätte.
Sein Gesicht war eingefallen wie das eines Toten. Die Augen lagen tief in den Höhlen und die pergamentfarbene Haut spannte sich über die Knochen. Der entsprungene Sträfling war todkrank. Diesmal hatte ihm die Freiheit nicht die Gesundheit wiedergegeben.
Er brauchte zwar nicht zu befürchten, von irgendeinem Sheriff erkannt zu werden, aber in Anbetracht seiner elenden körperlichen Verfassung war ihm das fast schon einerlei.
Vielleicht wäre er längst auf dem weiten Ritt hierher aus dem Sattel gekippt, wenn ihn der Gedanke an das Gold nicht aufrechterhalten hätte.
Fred Griffith hatte recht gehabt: Sheriff Brock war nicht der Dieb! Also mußte es einen anderen Menschen geben, der die Beute an sich gebracht hatte.
Es hatte den Verbrecher hierhergetrieben, in die Stadt, aus der er damals mit dem Gold entkommen war. Magisch hatte ihn dieses Santa Fé wieder angezogen.
Vor Billy Londons Boardinghouse rutschte der Mörder vom Pferd. Er führte die beiden Gäule in den schmalen Hof und wies den alten Peon, der auf ihn zuhinkte, an, die Tiere zu versorgen. Dann schwankte er auf das Boardinghouse zu.
Oben in der Tür kam ihm eine junge Frau entgegen. Bestürzt beobachtete sie den Fremden. Sie hatte ihn erst für betrunken gehalten. Aber jetzt, als er dicht neben ihr gegen den Türrahmen stieß, wußte sie, daß der Mann ganz einfach zu Tode erschöpft war. Sie stützte ihn und führte ihn ins Haus.
Eine Viertelstunde später lag der entsprungene Mörder Jack Hardac in einer kleinen Kammer im Obergeschoß des Hauses auf einer Pritsche und starrte auf das mattschimmernde Fensterviereck, das vorn zur Straße hinführte.
Er hatte gegessen und getrunken und sogar den gröbsten Staub von sich waschen können; jetzt lag er hier verborgen in einer winzigen Kammer dieser großen Stadt, in der niemand ahnte, welch ein Raubtier in Menschengestalt sich da eingeschlichen hatte.
Das Fenster war einen Spaltbreit hochgeschoben, und von unten drangen die Geräusche der Straße schwach herauf. Eben jetzt war das helle Singen eines großen texanischen Sternsporenrades zu hören.
Der Mörder Hardac ahnte nicht, daß diese Sporen an den Stiefeln jenes Mannes saßen, den er am meisten auf dieser Welt haßte und fürchtete.
Wyatt Earp ging unten mit Doc Holliday vorbei, auf das große weiße Haus zu, in dessen Erdgeschoß Hamptons Bank untergebracht war.
»Es ist etwas spät für einen Besuch«, meinte der Marshal.
»Yeah«, versetzte Holliday. »Aber noch nicht zu spät.« Damit klopfte er an die große reichverzierte Tür, zu der mehrere Steinstufen und ein Messinggeländer hinaufführten.
Innen schwankte ein Lichtschimmer auf den Eingang zu. Dann wurde geöffnet. Ein weißhaariger Neger stand in der Tür und hob die Kerosinlampe, um die Draußenstehenden besser erkennen zu können.
Der Marshal fragte nach dem jungen Mr. Hampton.
»Er ist nicht da«, antwortete der Schwarze.
»Was gibt’s Tom?« kam da eine Stimme eines älteren Mannes durch den Flur.
Der Diener wandte sich um.
»Hier sind zwei Männer, Sir, die Ihren Sohn sprechen wollen.«
Der alte Hampton, ein kurzbeiniger bauchiger Mann, kam schweratmend an die Tür.
»Mein Sohn ist nicht da. Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«
Wyatt winkte ab. »No, thanks. Dann kommen wir morgen wieder, wenn Sie erlauben.« Die beiden zogen die Hüte und gingen.
Bis zur nächsten Ecke. Da blieb Wyatt stehen.
»Haben Sie etwas bemerkt?«
»Yeah, der Alte hat gelogen.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil schon der Schwarze log.«
»Eben…« Die beiden gingen in die Prallelstraße und konnten von dem Tor aus in den Hof der Hamptons sehen.
Holliday wies auf eines der erleuchteten Fenster. Obgleich es fast fünfzig Yards von dem Tor entfernt war, erklärte der Gambler:
»Das ist er.«
Wyatt lehnte sich gegen das Tor und tastete mit dem kleinen Finger seiner Rechten nachdenklich über die Unterlippe.
»Er hat sich verleugnen lassen.«
»Yeah«, gab Holliday dumpf zurück. »Und ich vermute sogar, daß er uns gesehen hat.«
»Er kennt mich doch nicht.«
»Wer weiß, jedenfalls kennt er mich.«
»Vielleicht befürchtete er, daß Sie noch wegen des Schuldscheines mit ihm sprechen wollten, den er Ihnen im Spielsalon geben mußte.«
»Das ist schon möglich«, versetzte Holliday.
Plötzlich verschwand Lyonel Hampton aus dem Blickfeld der beiden, und wenige Augenblicke später wurde die Hintertür des Hauses behutsam geöffnet.
»Er kommt«, raunte der Missourier seinem Begleiter zu und zog ihn rasch mit sich vom Hoftor fort. Die beiden zwängten sich in das Dunkel der nächsten Toreinfahrt, und gleich darauf hörten sie nahende Schritte.
Als der Mann an ihnen vorbeikam, blickte Wyatt den Georgier an.
Der nickte.
Lyonel Hampton ging mit großen hastigen Schritten die Straße hinunter. Als er die nächste Ecke erreicht hatte, lösten sich die beiden Schatten aus der Toreinfahrt und folgten ihm.
*
Der aus Fort Worth Entsprungene fand trotz seiner tödlichen Erschöpfung keinen Schlaf. Er starrte mit brennenden Augen auf das Fensterviereck, und immer wieder liefen seine Gedanken wie Quecksilberfäden die gleichen Bahnen. Bis sich einer dieser Fäden plötzlich in einer Sackgasse festlief…
Hardac hatte immer und immer wieder an jenen Tag gedacht, an dem er den großen Coup hier in Santa Fé gelandet hatte: es war die Nacht vom elften auf den zwölften April gewesen, als er durch ein Fenster in den Schalterraum der Beverly-Bank gedrungen war.
Er wußte, daß Brock ihm folgen würde, deshalb hatte er versucht, den Sheriff an einer raschen Verfolgung
zu hindern. Mit kaltem Nerv war er etwa eine halbe Stunde vorher im Hof des Sheriff Office gewesen und hatte die Gurte der beiden Sättel zerschnitten, die gleich neben der Stalltür lagen.
Daß er den engen Hof nicht gleich verlassen hatte, war dem lauten Gespräch eines Mannes zuzuschreiben, der neben dem aufgeschobenen Fenster des Bureaus saß und von dem Hardac nur die auf den Tisch gelegten Füße hatte sehen können.
Der Mann mußte noch sehr jung gewesen sein, und Hardac hätte ihn jederzeit an einer harten knarrenden Stimme wiedererkannt. Der Bursche hatte wohl etwas getrunken. Santa Fé feierte in jener Nacht das alte Navajo-Fest. Zahlreiche Händler waren in der Stadt, und in den Schenken ging es hoch her. Nicht zufällig hatte der Des-perado Jack Hardac diese Nacht gewählt.
Und als er jetzt hier in seiner Kammer lag und sich jene Nacht wieder zurück ins Gedächtnis rief, kehrten auf einmal seine Gedanken auch in den Hof des alten Sheriffs Office zurück, und er hörte den angetrunkenen Deputy mit der knarrenden Stimme reden.
Vielleicht waren es belanglose Worte, die der angetrunkene Bursche da gesprochen hatte, aber es zeigte sich, daß sie irgendwo in einer Gehirnwindung des Verbrechers Hardac hängengeblieben waren.
Der Bursche hatte über seinen Boß, den Sheriff, gesprochen. Vielleicht war er eifersüchtig auf seinen Boß gewesen. Jedenfalls hatte der andere, mit dem er sprach, schließlich gesagt: »Halt deinen Rand, Bradley, du hast zuviel getrunken…«
»Bradley!«
Der Entsprungene aus Fort Worth saß plötzlich aufrecht auf seinem Lager.
Hatte er den Namen etwa eben ausgesprochen?
Bradley!
Jack Hardac fühlte nicht, daß er schweißgebadet war. Er erhob sich, kleidete sich an, nahm den Revolver vom Nachtkasten, schob ihn in den Hosenbund und verließ seine Kammer.
Drei Minuten später stand er unten auf der Straße. Hier herrschte reger Betrieb. Santa Fé erwachte um diese Stunde erst richtig.
Wie im Traum ging der Verbrecher den Weg zum Sheriff Office. Er überquerte die Straße und verschwand in der schmalen Nebengasse.
Dann stand er stumm vor einer Häuserlücke und sah sich um. Der Platz, auf dem damals das Sheriffs Office gestanden hatte, war leer. Es war jetzt ein Hof, auf dem ein altes Wagenrad im weißen Sand lag.
Hardac stand zusammengekrümmt vom Magenschmerz da und stierte zu dem zerbrochenen Rad hinüber.
Plötzlich waren Schritte hinter ihm.
Ein Mann kam die Gasse hinunter. Es war der schlürfende träge Schritt eines alten Mannes.
Der Verbrecher wartete, bis der Mann herangekommen war, dann wandte er sich um und preßte, ohne zu grüßen, mit heiserer Stimme die Frage hervor:
»Wo ist Bradley?«
Der Alte hüstelte.
»Der Sheriff?« antwortete er mit quäkiger greiser Stimme. »Er wird zu Hause sein.«
»Wo wohnt er?« kam es fast pfeifend aus der Kehle des Verbrechers.
»Der Sheriff? Na, hören Sie, er wohnt im schönsten Haus der Stadt. Gehen Sie die Gasse hinunter und dann links auf den Garden Hill zu. Das große weiße Haus ist es; Sie können es gar nicht verfehlen…«
Hardac hörte nicht mehr, was der Alte noch sagte.
Er stolperte die Gasse hinunter, auf den Garden Hill zu.
*
Daniel Bradley stand unten in seiner Wohnstube, zündete sich eine Zigarette an und goß sich aus der geschliffenen Ohio-Flasche einen Schluck Whisky ein.
Dann ging er zu der kleinen Kommode hinüber und stellte zum siebten Mal an diesem Abend die Spielwalze an, die den Santa Fé Song herunterleierte.
Bradley war angetrunken. Der Zigarettenrauch stieg ihm in die Augen, und plinkernd starrte er auf die Spieldose.
Der junge Sheriff von Santa Fé hörte nicht, daß hinter ihm die Tür geöffnet wurde. Und plötzlich, als die hölzerne Spieldose ihren Song abgeschnarrt hatte, hörte Bradley hinter seinem Rücken ein Geräusch, das jeder Mann in diesem Land kannte: Ein Revolverhahn war gespannt worden.
Ganz langsam drehte Bradley sich um. Und beim Anblick des Mannes, der drüben in der Tür stand, verflog der Schrecken aus den Zügen des Sheriff und machte einem spöttischen Grinsen Platz.
He, was wollte denn diese Jammergestalt? Dieses knöcherne Gespenst von einem Menschen?
Bradley schob die Zigarette in den linken Mundwinkel, spannte die Rechte um die Whiksy-Flasche, die Linke um das Glas und sagte mit seiner knarrenden Stimme:
»He, wußte gar nicht, daß Vogelscheuchen laufen können!«
»Sie können sogar schießen«, gab Hardac humorlos zurück.
Bradley senkte den Kopf. In seinen Augen stand nun ein ganz böses Flimmern.
»Was wollen Sie?« zischte er.
Der Verbrecher fixierte ihn kalt.
»Das Gold!«
Bradleys Kopf flog hoch.
»Sind Sie verrückt?«
»Ich weiß nicht. Kann sein, aber das ändert nichts daran.«
»Woran?«
»Daß ich mein Gold will.«
Der Unterkiefer des Sheriffs fiel herunter. Stotternd stieß er hervor:
»Ihr Gold…?«
»Yeah«, fauchte der Verbrecher. »Mein Gold. Ich habe es drüben aus Beverlys Bank geholt. Ich war in eurem Hotel und habe euch die Sattelgurte durchgeschnitten. Zwei große Lederbeutel mit Gold habe ich erbeutet, Bradley. Es war der Coup meines Lebens!«
Der Sheriff nahm den Kopf auf die Seite und beobachtete den Fremden scharf. Verrückt? Nein, dieser Mann da war nicht verrückt. Ganz sicher nicht.
Hardacs Augen hatten einen starren Ausdruck angenommen.
»Wo ist mein Gold, Bradley?« keuchte er. »Ich will mein Gold haben. Ich habe es geholt, und Brock hat es mir abgejagt. Aber er hat es nicht mehr.«
Bradley machte einen Schritt nach vorn und schrie unbeherrscht:
»Er hat es!«
Hardac blieb neben der Tür stehen. Immer noch hielt er den Revolver in der vorgestreckten Hand.
»Er hat es nicht, Bradley.«
»Geh nach Fort Worth und frage ihn!« brüllte der Sheriff.
Über das maskenhafte Gesicht des Mörders kroch ein Lächeln, an dem die Augen nicht teilnahmen.
»Da komme ich her, Bradley!«
»Aus dem Straflager?«
»Yeah. Aus dem Straflager. Ich bin Jack Hardac. Du hast sicher von mir gehört.«
Bradleys Gesicht wurde aschgrau. Yeah, er hatte von dem Mörder Jack Hardac gehört. Genug, um zu wissen, daß mit diesem Mann nicht zu spaßen war.
Da vernahm der Verbrecher hinter sich ein Geräusch. Er wich zurück in den Türwinkel und zischte:
»Keinen Laut, Bradley. Ich schieße sofort.«
Der sonst so großmäulige Daniel Bradley war vor Angst wie gelähmt.
Hastige Schritte durchquerten den Korridor.
Dann wurde an die Stubentür geklopft.
Hardac schoß dem Sheriff einen auffordernden Blick zu.
Bradley schluckte; heiser krächzte er:
»Come in!«
Ein hochaufgeschossener junger Mensch stürmte ins Zimmer, warf die Tür hinter sich zu, machte noch zwei Schritte und blieb stehen.
Es war der junge Bankier Lyonel Hampton.
»Dan!« stieß er hervor. »Ich muß sofort mit dir sprechen. Doc Holliday ist in der Stadt!«
In Bradleys Schädel dröhnte es wie in einer Kesselschmiede.
Doc Holliday!
Der Kopf des Sheriff sank herab.
»Dan, was hast du?«
Ohne den Kopf zu heben, sagte der Sheriff mit dumpfer Stimme:
»Dreh dich um, Hampton.«
»Was…?«
»Los, geh rüber und stell dich neben ihn«, drang Hardacs Stimme an Hamptons Ohr.
Der junge Bankier wandte sich um und wich erschrocken zurück.
»Vorwärts, stell dich drüben neben ihn«, zischte der entsprungene Sträfling durch den linken Mundwinkel.
Hampton gehorchte.
Einen Augenblick war es still im Raum. Dann stieß der Verbrecher den Revolver wieder vor und keuchte:
»Höre genau zu, Bradley. Brock hat das Gold nicht. Du hast es!«
Bradleys Kopf fuhr hoch. Seine Augen waren unnatürlich geweitet.
»Wie kommst du darauf?« entfuhr es ihm.
»Du hast es!« schrie der Sträfling geifernd.
Hampton blickte entgeistert von einem zum anderen. Schließlich preßte er mit belegter Stimme hervor:
»Weshalb sagst du nichts, Dan?«
»Was soll ich sagen?« kam es leise von den Lippen des Sheriff.
Hampton schluckte. »Heißt das etwa…«
»Ja!« schrie Hardac. »Es heißt, daß ich recht habe. Er hat das Gold.«
Dann geschah es.
Der gerissene Daniel Bradley hatte mit der rechten Hand, in der er die Flasche hielt, eine Bewegung gemacht.
Hardacs Kopf flog herum. Und schon prallte das Whisky-Glas aus der Linken Bradleys in Hardacs Gesicht.
Und dann kam die Flasche.
Jack Hardac sank zusammen, ohne auch nur einen Schuß aus der Trommel gebracht zu haben.
Bradley sprang auf ihn zu und nahm ihm den Revolver weg.
Der Sträfling kniete am Boden. Links von seiner Stirn tropfte Blut.
»Steh auf«, gebot der Sheriff mit knarrender Stimme. »Steh auf, Hardac! Ich werde dich jetzt erschießen. Das Gesetz gibt mir das Recht, den entsprungenen Raubmörder Hardac unschädlich zu machen!«
Hampton sprang nach vorn und hängte sich dem Sheriff auf den Unterarm.
»Dan! Dan, das kannst du nicht tun! Ich ahnte, daß mit deinem Gold etwas nicht stimmte und daß Sheriff Brock schuldlos in Forth Worth sitzt. Aber das alles ist doch nichts gegen einen Mord!«
Bradley schleuderte den Bankier von sich und sah ihn aus kalten Augen an.
»Du weißt zuviel, Hampton.« Er richtete die Waffe auf den Mann, der ihn für seinen Freund gehalten hatte.
Da riß sich der Mann, der die Natur eines Höhlenbewohners zu besitzen schien, der zweimal aus Fort Worth entsprungen war, vom Boden hoch und stürzte sich auf Bradley.
Hardac hatte seinen Revolver zurückerobert.
Aber er hatte nicht mit der Treue des Lyonel Hampton zu Bradley gerechnet.
Hampton hatte plötzlich einen kleinen vierschüssigen Cloverleaf in der Hand.
Bradley lachte heiser auf.
»All right. Schieß, Hardac! Hamp wird dich trotzdem noch mitnehmen!«
Zwei bellende Revolverschüsse fauchten durch den Raum.
Hardac und Hampton starrten einander an.
Ihre Revolver lagen am Boden.
Drüben, vor dem offenen Fenster, stand Wyatt Earp.
»Eine freundliche Abendunterhaltung, schätze ich.«
Hardac und Bradley hatten plötzlich kalkige Gesichter.
»Wyatt Earp!« entfuhr es Bradley. Dann lachte er plötzlich dröhnend los. »Prächtig, Wyatt. Sie kommen im richtigen Augenblick. Hier können Sie gleich einen Banditen mitnehmen, wie selbst Sie noch keinen erlebt haben.«
»Ich werde zwei Banditen mitnehmen, Bradley«, kam es frostig von den Lippen des Missouriers.
Da warf sich Bradley nach vorn, um an Hardacs Revolver zu kommen, aber im gleichen Moment flog die Tür auf, und die Waffe erhielt einen Fußtritt, der sie weit unter die Kommode schleuderte.
Der Gambler stand in der offenen Tür.
»Hallo, Sheriff«, sagte er nun mit aufreizender Sanftheit. »Der Marshal hätte auch sehr gern die Story ge-
hört, die Sie mir vorhin erzählt haben.«
»Doc Holliday!« fauchte Bradley. »Gehen Sie zum Teufel!«
»Nicht doch, Bradley. Sie können doch nicht den Marshal vor den Kopf stoßen, indem Sie ihm vorenthalten, was Sie mir erzählt haben.«
»Was habe ich Ihnen denn erzählt?«
»Sie haben mir die Geschichte eines dreckigen kleinen Burschen erzählt, der einen anständigen Sheriff ins Straflager brachte und sich mit der Beute eines Bankräubers die Stimmen der Bevölkerung dieser schönen Stadt erkaufte.«
»Das sollte ich Ihnen erzählt haben?«
»Haben Sie nicht?« tat Holliday erstaunt. »Dann wird es Zeit, daß Sie es jetzt tun.«
Hardac hatte während dieses Gesprächs zusammengekrümmt dagestanden.
Urplötzlich warf er sich herum und wollte zur Tür.
In der rechten Faust des Spielers blinkte ein Revolver.
»Sie machen einem ziemlich viel Arbeit, Hardac. Ich könnte mir vorstellen, daß der Marshal wenig Lust verspürt, Sie noch einmal nach Fort Worth zu schleppen. Ich wüßte eine rasche Abkürzung für diesen Weg.«
Hardac wich zurück. Er hatte das Eis in den Augen des Gamblers gesehen und zitterte am ganzen Leib. Wie ein Wurm bebte er pötzlich um sein doch ohnehin verspieltes Leben.
»Marshal!« stieß er kreischend hervor. »Sie werden nicht dulden, daß er mich erschießt! Sie werden doch nicht zulassen, daß er mich niederknallt wie einen – wie einen…«
»Wie einen dreckigen Banditen. Wie einen Raubmörder!« kam es klirrend von Hollidays Lippen entgegen.
Der Marshal jumpte über das Fenstersims und stand breitbeinig im Raum.
»Hardac, kommen Sie her!«
Mit gesenktem Kopf trottete der Verbrecher auf den Gesetzesmann zu. Mit raschen Griffen fesselte Wyatt Earp ihm die Hände auf den Rücken. Dann schob er ihn zur Seite.
»Bradley, kommen Sie her!«
Der Sheriff von Santa Fé warf den Kopf hoch.
»Was wollen Sie, Earp? Sie haben kein Recht…«
Holliday unterbrach ihn, indem er ihn mit dem Revolverlauf anstieß.
»Komm, du Köter, und laß das Gekläff. In Fort Worth sitzt ein Mann, der auf Ablösung wartet!«