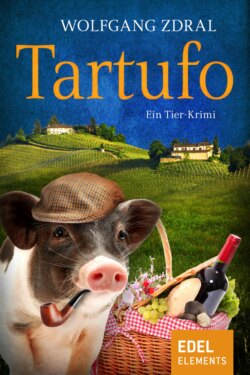Читать книгу Tartufo - Wolfgang Zdral - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеIch marschierte quer über die Felder nach Hause. Die Sonne wärmte meinen Rücken, vom Wind war kaum noch etwas zu spüren. Ein Bussard kreiste am Himmel, die Fliegen schwärmten aus, in der Ferne war das heisere Geschrei der Krähen zu hören. Von Cleopatra, Hannibal und Diogenes hatte ich mich verabschiedet. Ich wollte allein sein, beim Gehen die Beklemmung loswerden, die bleischwer auf mir lastete, sobald ich an Matteo dachte. Hatten meine Freunde recht? War er am Ende gar ermordet worden? Wer hätte meinen Partner umbringen sollen? Einen Grund konnte ich mir nicht vorstellen. Matteo war zu allen freundlich gewesen, hatte keine Feinde gehabt. Wertsachen trug er nie bei sich. Ich erinnerte mich auch sonst an nichts Kostbares in seinem Besitz. Keine goldene Uhr, keine Ringe mit seltenen Steinen. Keine größeren Mengen Bargeld. Zumindest habe ich nie etwas herumliegen sehen. Er schien sich aus den sprudelnden Einnahmen seines Trüffelverkaufs nicht viel zu machen. Das meiste gab er sofort wieder für Essen und Trinken aus.
Andererseits hatte die Polizei bei der Leiche fast keine persönlichen Gegenstände gefunden. Das war seltsam. Hatte er vergessen, Taschenlampe, Messer und Wanderstock mitzunehmen, als er von zu Hause aufgebrochen war? Matteo bewegte sich sehr sicher – selbst wenn er etwas getrunken hatte. Bei unseren Streifzügen durch die Wälder stapfte er durchs Unterholz, als wandelte er auf einer Teerstraße, ohne zu stolpern. Nie habe ich ihn hinfallen sehen. Und nun hatte er den feuchten Untergrund nicht bemerkt und war einfach wie auf einer Eisbahn ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt? Was machte er mitten in der Nacht dort? Offensichtlich hatte er jemanden getroffen. War es eine Verabredung gewesen – oder Zufall? Das alles kam mir seltsam vor.
Ich umrundete die eingezäunte Kleewiese, auf der Kühe weideten, und sah den Hof der Gobetti vor mir liegen. Meine Heimat. Die alte Maria fegte den Vorplatz. Wie immer war sie ganz in Schwarz gekleidet, mit einem knöchellangen Rock, einer Schürze, einer verwaschenen Bluse und einem Kopftuch, unter dem ein paar silberne Haarsträhnen hervorlugten. Sie ging ein wenig gebückt, als laste ihr Leben schwer auf ihr, den rechten Fuß zog sie beim Gehen leicht nach. Ihre von der Gicht gekrümmten Hände konnten den Besenstiel nur mit Mühe halten. Maria hatte schon immer als Haushaltshilfe bei den Gobetti gearbeitet, war Matteos Kindermädchen gewesen. Mittlerweile war sie vierundsiebzig Jahre alt. Als Matteo sie mit sechzig in den Ruhestand verabschieden wollte, hatte sie nur geantwortet: »Ich bin doch noch keine alte Frau. Mein Zuhause ist hier. Basta!« Damit war das Thema vorerst erledigt. Als Matteo ihr mit siebzig Jahren jede Arbeit verbot, war die einzige Antwort: »Willst du mich ins Grab bringen?« Dabei bekreuzigte sie sich und murmelte: »Ich weiß selbst, was mir guttut.«
Das Anwesen war in der Form eines dreitraktigen Bauernhauses gebaut, in der Mitte das Hauptgebäude, in dem Matteo und ich wohnten. Links schloss sich im rechten Winkel die Halle an. Sie diente als Garage und Lagerplatz, dort befand sich auch der Stall. Der Anbau rechts schmiegte sich ebenfalls im rechten Winkel ans Haupthaus. Dort hatte Matteos Sohn Paolo mit seiner Frau Eleonora sein Heim. Im Erdgeschoss war ein Zimmer für Maria reserviert. Die Fassaden leuchteten in der Farbe reifer Birnen, Efeu rankte an der Vorderseite bis ins Obergeschoss hinauf. Obwohl Matteo dem Haus regelmäßige Reparaturen hatte angedeihen lassen, Fenster und Dach erneuert worden waren, wirkte das Gut doch etwas vernachlässigt, jeder Stein zeigte die Patina des neunzehnten Jahrhunderts.
»Schwein, wage bloß nicht, über meinen frisch gekehrten Platz zu laufen.« Maria kam auf mich zu, den Besen wie einen Baseballschläger schwingend. Obwohl ich bezweifele, dass sie wusste, was Baseball ist. Denn sie interessierte sich eigentlich nur für die Kirchenblätter, die der Pfarrer ihr nach der Sonntagsmesse in die Hand drückte. Oder für Groschenromane, auf deren Titelblättern verwegen aussehende Männer eine Jungfrau in ihren muskulösen Armen hielten. Ich machte einen Bogen um Maria. Selbst auf die Entfernung drang ihr etwas strenger Geruch in meine Nase. Es war kein Schweiß, sie schwitzte nie bei der Arbeit, das Geheimnis verbarg sich vielmehr unter ihren Kleidern, wie meine Sensoren längst festgestellt hatten: Körperpuder. Talkum mit Rosmarin. Sicher gab es solchen Puder schon seit mindestens hundert Jahren.
Ich wählte den Eingang durch den Stall, um zu meinem Zimmer zu gelangen. Aus dem Stall führte ein zweiter Ausgang zur Hinterseite des Gebäudes. Den benutzte ich gern, um unbemerkt zu entschlüpfen. Am Übergang von der Halle zum Haupthaus hatte Matteo eine zweiteilige Tür angebracht. Der obere Teil konnte mit einem Haken geschlossen werden und hielt im Winter die Wärme im Haus. Der untere Flügel war einzig an zwei Scharnieren befestigt und schwang nach beiden Seiten auf. So brauchte ich die Tür nur kurz anzustoßen, um von drinnen nach draußen zu gelangen – oder umgekehrt.
Mein Reich war ein abgetrennter Raum, etwa sechs Meter lang und fünf Meter breit. Er grenzte direkt an die Wohnküche des Haupthauses, die ich durch eine Tür betreten konnte. Die Hölzer der Tür hatten sich verzogen, durch die Ritzen drang Licht. Das Schloss rastete nicht richtig ein. Schon vor Jahren war der Schlüssel verloren gegangen. Hinter der Wohnküche befand sich ein Flur mit einer Toilette, dahinter die Eingangstür. Vom Flur führte eine Eichentreppe in den Vorratskeller und in den ersten Stock. Dort hatte Matteo sein Schlafzimmer. In den anderen Räumen im Obergeschoss hatten einst die Kinder gewohnt, jetzt war alles vollgestopft mit ausrangierten Stühlen, Stehlampen, Truhen, abgewetzten Lederkoffern und Bilderrahmen ohne Glas.
Ein Rundblick in meinem Salon sagte mir, dass noch niemand an mein Essen gedacht hatte. Auf dem japanischen Bänkchen mit Kirschholz-Intarsien stand wie gewohnt mein Speisegedeck: drei Schüsseln aus alter Keramik, bemalt mit neckischen Weinranken. Aber leer. Kein Wasser oder Rotwein in der linken Schale, wie es mir Matteo immer angerichtet hatte. Kein Hauptgericht in der mittleren Schale. Auch das rechte Gefäß, sonst mit Süßem gefüllt – leer. Ich konnte nachempfinden, dass ein Todesfall die Menschen durcheinanderbrachte, aber musste ich deswegen gleich verhungern? Sollte ich mir etwa wie ein gewöhnliches Hausschwein Eicheln aus dem Wald holen? Aus dem Bach trinken wie ein Hund? Matteo wäre eine solche Nachlässigkeit nie passiert. Er dachte immer an mein Wohlergehen. Frustriert ließ ich mich auf mein Sofa fallen, legte den Kopf auf die Lehne, stieß einige Seufzer aus. Das Möbel mit dem grünen Samtbezug hatte mein Partner auf dem Flohmarkt gefunden. Er hatte die Holzfüße abgeschnitten, damit ich ohne Mühe zum Schlafen darauf Platz nehmen konnte. Durch das Fenster zeichneten die Sonnenstrahlen Muster auf den Perserteppich vor mir. Ich entdeckte einige Staubflocken im Gegenlicht. Machte hier denn niemand sauber? Wo blieb Maria? Ich erhob mich, scharrte den Staub mit meinen Hufen weg und trottete zum Holzregal an der Wand gegenüber.
Jetzt brauchte ich eine Stärkung, um Abstand zu den jüngsten Ereignissen zu bekommen. Vor mir lagerten in fünf Reihen, ordentlich in der Waagerechten ausgerichtet, meine privaten Weinvorräte. Hauptsächlich Barolo. Ein paar Flaschen Barbaresco aus Neire. Weißwein der Cortese-Traube aus Gavi. Normalerweise goss mir Matteo den Roten direkt in die Schüssel, wenn er das Menü zubereitet hatte und servierte. Es war immer dasselbe Ritual: Abends kochte er ein Essen, lud manchmal Paolo und Eleonora oder Maria dazu. Meistens jedoch blieb er allein mit mir. Er hatte sich das nach dem überraschenden Tod seiner Frau angewöhnt. Das tägliche Kochen und der Rotwein schienen ihm Trost zu spenden und die Erinnerungen wach zu halten. Die Wohnküche neben meinem Zimmer wurde sein eigentlicher Aufenthaltsraum, sein privates Fürstentum, in dem er allein bestimmte. Ohne das Gemeckere seines Sohnes. Zuerst deckte Matteo den langen Küchentisch aus Wurzelholz, holte Silberbesteck aus der Anrichte, dazu eine frische Serviette aus einer offenen Lackschatulle, die auf der Kommode stand. Maria schimpfte und bekreuzigte sich danach, wenn sie den Leinenstoff bügelte. Dabei murmelte sie etwas wie »unnötiger Luxus« und »ein Papiertaschentuch tut’s auch«. Eine Stunde oder länger verbrachte Matteo mit Wasser aufsetzen, Gemüse putzen, Zwiebeln schneiden und Kräuter zupfen. Die Portionen teilte er reichlich ein, er wusste, welche Mengen ich vertilgen konnte. Den Abend beschloss er mit Selbstgesprächen und Rätselaufgaben aus Zeitschriften. Oder er legte Schallplatten mit Verdi-Opern auf, von dem altertümlichen Plattenspieler wollte er sich nicht trennen, obwohl er zu Weihnachten ein modernes Gerät geschenkt bekommen hatte. Er hatte es an Paolo weitergegeben. Da er grundsätzlich die Verbindungstür zu meinem Raum offen ließ, genoss ich Verdi mit ihm zusammen. Obwohl mir lieber war, wenn Matteo den Fernseher einschaltete, da sah ich etwas von der Welt. Den Abend beendeten wir mit einem Grappa oder einem Glas Rotwein. Matteo kam dann zu mir, füllte meine Schüssel ein letztes Mal nach und hob sein Glas: »Salute, mein Freund.«
Irgendwann hatte er eingesehen, dass es meinen Bedürfnissen entgegenkam, wenn ich zusätzlich für den spontanen Durst eine Notration in Reichweite hatte. Die Flaschen trugen kein Etikett, mein Partner tauschte sie direkt bei den Weinbauern gleich nach der Abfüllung, bevor sie in den Handel gelangten. Nur Kreidekreuze kennzeichneten die Bouteillen. Ein Kreuz bedeutete Trinkwein für jeden Tag, ein leichter Barbaresco mit dem Aroma von Heidelbeeren und Zimt beispielsweise. Zwei Kreuze waren für bessere Tropfen reserviert. Die edlen Kreszenzen trugen drei Kreuze, etwa ein 89er Barolo, für mich einer der ausgewogensten Weine, besser noch als der 97er. Heute war ein Dreikreuzetag. Vorsichtig fasste ich die Flasche mit der Schnauze am Hals und stellte sie vor dem Sofa ab. Das Problem mit dem Korken hatte Matteo genial gelöst: Der Korken war nur halb hineingedreht, gerade fest genug, damit das kostbare Nass nicht auslaufen konnte. Ich hielt die Flasche zwischen meinen Hufen und zog den Korken mit den Zähnen heraus, ganz behutsam, als wollte ich ein rohes Ei transportieren. Jetzt den Hals mit den Lippen umfassen, die Flasche hochheben, den Kopf nach hinten legen – und fließen lassen. Ich lehnte mich genüsslich zurück. Der Barolo zauberte auf meinen Geschmacksnerven ein Duett von Kirsche und Pfirsich, darunter mischte sich die Würze des Eichenfasses, eine Spur von Zimt schob sich aberwitzig in den Vordergrund. So lange wie möglich zögerte ich den Höhepunkt, das Runterschlucken, hinaus, blieb danach einige Sekunden völlig regungslos, um den Nachhall der Aromen in meinem Mund wie ein fernes Echo nachklingen zu lassen. War das Amore? Musste man sich so das Himmelreich vorstellen? Esus, der Heilige Schweinevater, der unsichtbar über uns wachte, hatte die Weinrebe sicher auf die Erde gebracht, um uns Schweine glücklich zu machen. Ein großzügiges Geschenk. Verehrt seist du, Esus! Mein Hirn fühlte sich himmlisch träge an. Danke. Der Wein, der gute. Wein, ja Wein ...
Ein Geräusch weckte mich auf. In der Wohnküche unterhielt sich jemand.
»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass so was Schreckliches geschehen ist. Furchtbar. Einfach furchtbar.« Ein Schluchzen. »Matteo – gestern habe ich mich noch mit ihm über das Fenster neben unserem Eingang unterhalten, das gerichtet werden muss. Matteo war wie immer. Versprach, sich um die Sache zu kümmern.« Es war Eleonoras Stimme, erstickt von Tränen.
»Ich fühle mich genauso entsetzlich. Es ist unbegreiflich.« Das klang nach ihrem Ehemann Paolo. Die Worte flossen ruhig und gelassen aus seinem Mund. »Ein Schock.«
»Was sollen wir bloß machen?«
»Das Leben geht weiter.«
Stille. Das Klappern einer Tasse.
»Aber ohne Matteo können wir doch gar nicht ...« Ein Japsen in Eleonoras Stimme.
»Lass mich mal machen. Ich lege mir einen Plan zurecht.«
»Gibt’s was Neues von der Polizei?«
»Commissario Grifone hat angerufen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung hat noch nicht stattgefunden. Erst danach kann er Genaueres sagen. Der Leichnam wird wohl in zwei Tagen freigegeben.«
»Ich versteh nicht, dass sie ihn so lange dabehalten. Hat der Commissario über die Ergebnisse seiner Ermittlungen berichtet? Es war doch ein Unfall, oder?« Eleonoras Stimme hatte einen schrillen Unterton.
»Grifone konnte oder wollte am Telefon nichts sagen. Er hat versprochen, uns als Erste zu informieren.«
Langsam rutschte ich vom Sofa. Ich wollte genauer mitbekommen, was in der Küche gesprochen wurde. Zwei wackelige Schritte. Bloß keinen Lärm machen. Pause. Ein Schritt – ein Klirren unter mir schreckte mich auf. Ich war gegen eine Flasche gestoßen. Sie rollte zu den beiden anderen, die am Boden lagen. Wieder klirrte es. Ich hielt den Atem an, lauschte. Doch die beiden schienen nichts bemerkt zu haben.
»Es hilft nun alles nichts. Wir müssen uns genau überlegen, was wir als Nächstes tun«, sagte Paolo gerade.
»Paolo! Sei still! Wie kannst du in einer solchen Situation schon wieder so berechnend sein? Warte doch wenigstens ab ... .« Eleonora wirkte verloren, aber es klang auch Empörung aus ihrer Stimme. Wie ich gehört hatte, stammte sie aus Mailand, Tochter einer Kaufmannsfamilie. Die Eltern besuchten ihr einziges Kind nie, nachdem sie ihre Urlaubsbekanntschaft Paolo geheiratet hatte. Er war in den Augen der Eltern ein Nichtsnutz. Aber Eleonora hatte ihren eigenen Kopf.
»Warten – schön und gut. Aber wem soll das nützen? Matteo ist nun mal tot – daran können wir nichts ändern. Ob Unfall oder nicht, wir sind jetzt die Herren des Hauses und ...«
»Jetzt mach aber ’nen Punkt! Du solltest dich hören. Gleich denkst du ans Erben, ans Geld. Das spielt im Moment überhaupt keine Rolle. Außerdem: Du weißt nicht einmal, was du überhaupt bekommst. Oder hast du etwa schon ein Testament gesehen?«
»Nein, nein, aber das dürfte ...«
»So viel Respekt bist du deinem Vater schuldig, wenigstens die Beerdigung abzuwarten.« Die Tonlage Eleonoras wurde höher. »Ich bitte dich darum. Es ist nicht mehr lange hin.«
»Schuldig? Ihm Respekt schuldig? Hat mein alter Herr etwa meine Wünsche respektiert? Als ich ihn um Unterstützung bat für die Bar in Alba, da hat er nur gelacht und gesagt: Du solltest lieber lernen, was es heißt zu arbeiten.«
»Ich meine doch nur ...«
»Deine dauernde Nachgiebigkeit bringt uns nicht weiter.« Paolo schlug mit der Faust auf den Tisch. »All die Jahre haben wir immer wieder nachgegeben – jetzt ist Schluss!«
Vorsichtig schlich ich mich zur Tür. Durch einen Spalt hatte ich einen guten Blick in die Küche. Paolo und Eleonora saßen sich am Tisch gegenüber, vor sich eine Kaffeetasse. Eleonora schenkte sich aus der Kanne ein, tat Milch und zwei Löffel Zucker in ihre Tasse. Dabei hielt sie ihre unergründlichen Augen starr auf den Kaffee gesenkt. Ihr glattes schwarzes Haar fiel in langen Strähnen nach vorn. In Zeitlupe führten ihre Finger den Löffel. Ihr ganzes Wesen strahlte eine undefinierbare Sanftheit und Melancholie aus. Vielleicht lag es am Schimmern ihrer Haut, der verlegenen Geste, als sie ihre Haare zurückstrich, der schmalen Nase, die das Gesicht so hübsch betonte. Fast wie bei Cleopatra, la piu bella.
Nach menschlichen Maßstäben müsste man die Frau als schön bezeichnen, ein schlanker Körper, was Menschen nun mal schön finden. Auf mich wirkte sie eher knochig, schlecht genährt – zu wenig Fleisch um Hüften und Bauch, all das, was für mich an einem richtigen weiblichen Wesen dran sein muss. Oh Cleopatra! Und wo war der Schmuse-Rüssel, wo die wonnig-weichen Flanken? Esus sei Dank, dass ich mich nie in einen Menschen verlieben muss.
»Mir ist das Ganze irgendwie unheimlich.« Eleonora stellte ihre Tasse ab. »Matteos Tod kommt so plötzlich. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ohne ihn sein wird.«
»Stell dich nicht so an. Mit deinen Sorgen machst du ihn auch nicht wieder lebendig. Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Uns wird schon was einfallen. Schließlich sind wir erwachsene Menschen.« Paolos Gesicht zuckte, immer wieder fuhr er sich mit der Hand über sein Bürstenhaar oder zupfte an seinem Ohr. Er vermied es, seine Frau anzuschauen, ließ stattdessen den Blick über die Statue wandern, die an der Küchenwand neben der Pendeluhr hing. Sankt Laurentius, der Schutzheilige der Köche, der Weinberge und der Genießer. Die bemalte Holzfigur war ein Talisman für Matteo gewesen, er hatte sie mit einem Stoffumhang dekoriert, von Maria eigenhändig geschneidert und mit Blumen bestickt. In der Vase am Sockel der Skulptur steckte ein Trockenblumenstrauß. »Wir müssen einfach versuchen, so weiterzumachen wie bisher.«
Eleonora heftete den Blick auf ihn. »So weitermachen? Dein Vater ist tot und du willst einfach zur Tagesordnung übergehen.«
»Du hast gar keine Wahl.« Paolos Worte klangen wie ein Befehl. Seine vernarbten Hände umklammerten die Tasse, sodass die Adern auf seinem Handrücken zu sehen waren. »Ich werde meine Rolle als trauernder Sohn und Ehemann ausfüllen – ob es dir gefällt oder nicht. Zumindest die nächste Zeit.«
»Rede nicht weiter! Das deprimiert mich, Ich wünschte so sehr, wir hätten mit Matteo noch einmal reden können. Dann wäre mir wohler.«
Paolo stand auf. »Zu spät. Matteo ist nicht mehr. E basta!«