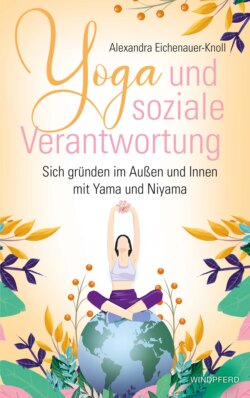Читать книгу Yoga und soziale Verantwortung - Alexandra Eichenauer-Knoll - Страница 6
Die Stärkung einer vertrauensvollen Basis
ОглавлениеWie kommt es, dass eine Yogalehrerin ein Buch über soziale Verantwortung schreiben möchte? Ich unterrichte Yoga seit dem Jahr 2004 und habe fast zeitgleich angefangen, mich auch im Berufsverband Yoga Austria – BYO zu engagieren. Ich startete mit der Verantwortung für eine Mitgliederinfobroschüre, dann entwickelten wir einen Newsletter. Es folgten acht Jahre im Vorstand des Verbandes und bis heute die Mitarbeit in weiteren kommunikativen Belangen. Derzeit bin ich auch wieder im Vorstand des Verbandes aktiv. Ich erlebte und erlebe diese Übernahme von berufspolitischer Verantwortung sehr teamorientiert und im gemeinsamen Bemühen, die Grenzen der anderen zu respektieren.
Ganz anders entwickelte sich mein Engagement in der Begleitung von geflüchteten Menschen. Ein erstes Kennenlernen erfolgte ab 2013 beim Abhalten von ehrenamtlichen Deutschkursen für Asylwerber:innen, die in einer kleinen Pension im Nachbarort untergebracht waren. Es waren intensive und oft auch sehr heitere Begegnungen. Sie halfen den Menschen, die Traurigkeit zumindest stundenweise durch fleißiges Tun beiseitezuschieben, und vor allem das Grübeln über die völlig ungewisse Zukunft.
Mein Lebensgefährte entwickelte später die Idee, ein Begegnungshaus für »Hiesige und Zuagroaste« in unserem Heimatort zu eröffnen. Während wir noch an den Plänen und Konzepten für interessierte Fördergeber:innen tüftelten, überschlugen sich 2015 die Ereignisse, als sich die Grenzen nach Ungarn für kurze Zeit öffneten und unzählige Menschen auf der Flucht durch Österreich kamen oder hier um Asyl ansuchten. Ich erlebte, dass es möglich ist, selbstorganisiert zu handeln und gleichzeitig im Kollektiv mit anderen engagierten Menschen ähnliche Probleme zu meistern. So wurde mir bewusst, dass eine starke Zivilgesellschaft als autonomes Kollektiv Verantwortung übernehmen kann, und zwar ohne politische Beschlüsse abzuwarten. Es waren für mich sehr prägende Erfahrungen von Mitmenschlichkeit, Solidarität und Tatkraft. Zufälligerweise schrieb ich im Sommer 2015 eine Masterarbeit für mein Studium »Spirituelle Begleitung in der globalisierten Gesellschaft« an der Donauuniversität Krems. Ich vergleiche darin Konzepte von Mahatma Gandhi und Ideen der Tiefenökologie. Es war, als würden diese auf einmal wie Samen aufgehen, als könnte es wahr werden: Viele Menschen engagieren sich unabhängig voneinander für das Gute und wachsen zu einer großen Bewegung zusammen.
Die vielen Helfer:innen wurden rasch sehr selbstbewusst, erfuhren Selbstwirksamkeit und waren bereit, dafür ein hohes Maß an sozialer Eigenverantwortung zu übernehmen. Wenig später wurde allerdings offensichtlich, dass gerade ihre Autonomie den politischen Parteien unbequem wurde. Sie waren zu sehr bei den geflüchteten Menschen, sie sahen die Tatsachen zu differenziert und hinterfragten gängige Klischees und politische Äußerungen, die sich zunehmend auch am Potenzial einer verängstigten und zuwanderungskritischen Wählerschaft orientierten. Das ist schade, denn dieses Kollektiv an interkultureller Integrationskompetenz halte ich für sehr gesellschaftsrelevant.
Wir hatten Glück und starteten 2016 mit unserem Begegnungshaus, dem »Comedor del Arte« in Hainfeld – mit Deutschkursen, Spielnachmittagen, Workshops, Integrationsfesten und vielen, vielen guten Begegnungen. Das Projekt existiert bis heute.
Die Corona-Pandemie hat uns inzwischen andere und neue kollektive Erfahrungen beschert. Durchaus auch verbindlich Schönes, aber leider auch schmerzlich Trennendes. Die Diskussionen über die Pandemie spalteten unsere Gesellschaft in einem Ausmaß, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Vor allem sind jetzt, im Gegensatz zu 2015, wirklich alle Bürger:innen in irgendeiner Form in die Maßnahmen und Diskussionen involviert – von meinem fünfjährigen Nachbarsjungen bis zu meiner dreiundachzigjährigen Tante. War es 2015 eine Zivilgesellschaft, die durch direkten, persönlichen menschlichen Kontakt und horizonterweiternde Erfahrungen erstarkte, so verstärken und verbreiten sich heute Meinungsblasen durch kollektives »Liken« und Weiterleiten von algorithmengesteuerten Informationen. Die neue Protestbewegung ist diffus zu verorten, geeint jedenfalls in ihrer kollektiven Skepsis gegenüber den Maßnahmen und Zahlenveröffentlichungen der »Herrschenden«. Der Vertrauensverlust in das Establishment ist so enorm, dass sogar pauschal Journalist:innen verunglimpft und attackiert werden. Die Tatsache, dass durch mehrere Lockdowns persönliche Kontakte untersagt wurden, fördert natürlich auch diese Tendenzen. Ich will hier die Social Media nicht schlechtreden und nehme auch kritische Stimmen ernst. Ich fordere nur zu eigenem Denken statt automatischem, unreflektiertem »Teilen« auf.
Was mir am meisten Sorgen bereitet, ist der spürbare Vertrauensverlust in die politischen Entscheidungsträger:innen. Sie tragen mit ihrem manchmal schwer verständlichen Pandemiemanagement und empörenden Korruptionsskandalen natürlich selbst maßgeblich zu diesen Tendenzen bei. So ärgerlich diese Geschehnisse sind, so klar ist für mich trotzdem, dass es nur einen guten Weg geben kann: Wir müssen unsere Demokratie stärken und uns mit unserem Engagement, unserem Denken und unserer Bereitschaft zur Eigenverantwortung einbringen. Wir dürfen unser Schicksal weder den Algorithmen der Social Media noch den Eigeninteressen von politischen Eliten oder offensichtlich demokratiefeindlichen Kräften überlassen.
Für mich stellen sich jetzt Fragen wie diese: Wie überbrücken wir die Risse in unserer Gesellschaft, wie entwickeln wir neue heilsame Ideen für eine gemeinsame Zukunft? Auf welche gemeinsamen Werte können wir uns einigen? Und vor allem: Wie aktivieren wir wieder unser Vertrauen in eine funktionierende Demokratie und in die Wirksamkeit von sozial engagiertem, kollektivem Tun?
Die soziale Verantwortung ist im zwanzigsten Jahrhundert in die Liga einer moralischen Kategorie aufgestiegen und zu einem existenziellen Wert für die Weltgemeinschaft geworden. Um zu erläutern, wie es dazu gekommen ist, werde ich im folgenden Kapitel einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Trotzdem ist die Idee, soziale Verantwortung für andere zu übernehmen, im Sinne davon, ganzheitlich zu denken und die Folgen für die Natur und für die nächsten Generationen in das eigene Handeln einzubeziehen, noch nicht so ganz in der Gesellschaft angekommen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander, neue Lebensentwürfe machen Hoffnung, aber auch Angst sowie individuelle Überforderung und Erschöpfung sind weit verbreitet.
Was wir allerdings alle spüren, ist, dass wir eine Zeit des Wandels erleben. Klimakrise und Flüchtlingsbewegungen und jetzt auch noch die Corona-Pandemie machen deutlich, dass unsere Probleme sich nicht regional und im Alleingang lösen lassen. Alles ist mit allem verbunden. Ich möchte meinen bescheidenen Beitrag dazu leisten, indem ich die Grundwerte des Yoga und auch die Übungsmethode Yoga in diese Diskussion über soziale Verantwortung hineintrage. Yoga hilft jedenfalls, das Grund- und auch das Selbstvertrauen zu stärken.