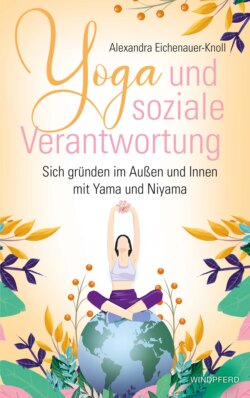Читать книгу Yoga und soziale Verantwortung - Alexandra Eichenauer-Knoll - Страница 8
ОглавлениеWelche Schritte werden wir in diesem Buch gehen?
Rückblick in die Geschichte
Als ersten Schritt werde ich im nächsten Kapitel im Zeitraffer aufzeigen, wie sich der Verantwortungsbegriff im Laufe der Geschichte geändert hat und warum soziale Verantwortungsübernahme heute so überaus bedeutsam ist. Ich denke, vieles lässt sich in der Gegenwart leichter verstehen, wenn man aktuelle Entwicklungen in einen historischen Kontext stellt.
Der Schatz des Yoga – die fünf moralischen Grundprinzipien
Dann kommen wir zu dem Schatz an Weisheit, den der Yoga zu einer gesellschaftlichen Entwicklung heute beitragen kann: zu den fünf Yamas als moralische Grundprinzipien, die uns richtungweisend darin bestärken können, Ziele zu formulieren und Haltung in der Gesellschaft einzunehmen. Die Yamas bilden die erste Stufe des Achtfachen Pfades in den Yoga-Sutren, der einen Weg der spirituellen Transformation beschreibt.
Ich möchte daher folgende These aufstellen: Ist nicht überhaupt ein heilsames Miteinandersein und damit auch die Übernahme von Verantwortung füreinander der erste Schritt auf dem Weg zu spiritueller Entwicklung? Braucht es nicht zuerst soziales Bewusstsein und Erfahrung im Miteinander, um dann diese Erfahrungen für eine authentische spirituelle Entwicklung zu nutzen? Braucht es nicht moralische Bewährung, bevor man in die Versenkung geht?
Es wird viele Yogaerfahrene geben, die das so lieber nicht formuliert haben möchten. Es wird auch Yogi:nis geben, die überhaupt verneinen, dass es beide Wege geben muss, und nur für die spirituelle Einsiedelei plädieren. Aber ich nehme an, dass Leser:innen, die sich für das Thema »soziale Verantwortung« interessieren, doch zumindest davon ausgehen, dass sich beide Ausrichtungen, Sinn im Leben zu erfahren, bereichernd ineinander verschränken sollten.
Für mich keine Frage: Spirituelle Praxis und Rückzug unterstützen uns dabei, gleichmütig und trotzdem energiegeladen in der Welt wirken zu können. Denn ohne eine Methode des Rückzugs und der Rückbindung an das beständig Heilsame laufen wir Gefahr, im selbstlosen Tun auszubrennen. Umgekehrt brauchen wir das sinnstiftende, gesellschaftliche Tun, um unsere Energie und unsere Einsicht in die Welt einzubringen und umzusetzen. Spiritueller Rückzug als alleinseligmachender Weg ist Weltflucht; ein Weg, der zwar keinen Schaden anrichtet, aber auch keinen Beitrag für ein erfüllendes Miteinander leistet.
Wie kann man moralische Grundwerte üben?
Sobald ein Yama definiert ist und uns klar geworden ist, warum es uns moralisch bedeutsam ist (ich nenne das im Folgenden »Moralitäts-Check«), können wir mit dem Üben beginnen. Ich möchte eine weitere These aufstellen: Moral, die nur im Kopf ist, wird möglicherweise im konkreten Tun schwer umsetzbar sein. Erstens, weil sie zu abstrakt ist und nicht auf die konkrete Handlung anwendbar scheint. Und zweitens, weil sie gar nicht verinnerlicht ist. Theoretisch ein Spiel beherrschen und die Regeln kennen ist etwas ganz anderes, als es praktisch geübt zu haben. Auch Moral braucht Übung. Ich habe daher zu jedem Yama vier Beispiele aus meinem Leben niedergeschrieben. Meine Gefühle haben mir die Fragen während des Schreibens eigentlich wie von selbst aufgetischt. Ich brauchte dann nur nachzufragen – warum, wieso? So, wie ich meine Schüler:innen im Yogaunterricht ermutige, mit wachem Forschergeist sich selbst bei der Asanapraxis zu beobachten, möchte ich mit meinen Geschichten in den fünf Abschnitten des vierten Kapitels anregen, die eigenen Alltagssituationen forschend unter moralischen Gesichtspunkten zu hinterfragen.
Es geht dabei nicht darum, die Moralkeule zu schwingen à la »Du sollst« und »Du sollst nicht«! Vor der Moralkeule verstecken sich die Gefühle, sie haben Angst davor, geschlagen zu werden. Wenn wir aber die Gefühle zulassen und diesen inneren moralischen Zwiespalt, dann haben wir zumindest die Chance, dass irgendwann ein innerer Impuls auftaucht, wenn man so will, eine Hinwendung, ein Hinabsinken in den tieferliegenden moralischen Grund. Dieser kann uns dann Sicherheit geben, wie einem Baum, dem weitere Wurzeln wachsen.
Moral soll sich stimmig anfühlen, soll diffuse Gefühle lichten, sorgenvolle Gedanken klären. Eine Moral, die nur funktioniert, wenn sie die Gefühle unter den Teppich kehrt, kann sich schwer festigen und wird vor allem dann Mühe haben, wenn es darauf ankommt. Wir müssen uns selbst vertrauen und uns Zeit geben. Übung hilft.
Ich gebe mit diesen Beispielen von meinem Leben etwas preis, weil ich Menschen darin ermuntern möchte, eigene Erlebnisse zu durchdenken. Meine Geschichten sind nur Beispiele – vielleicht regen sie zum Nachdenken an, aber sie sollen keinesfalls ein »moralisch vorbildliches Verhalten« demonstrieren. Die Beispiele sind bedingt durch meine Interessen, meine Stärken und Schwächen und mein persönliches Umfeld. Natürlich habe ich eine gesellschaftspolitische Haltung, sonst würde ich ja nicht über so ein Thema ein Buch schreiben. Die Geschichten sollen aber vor allem zum Weiterdenken und Selbstfühlen anregen und ruhig auch – zum Bessermachen!
Nur durch Durchdenken und Durchspüren kann man sich selbst besser kennenlernen und vielleicht das nächste Mal klarsichtigere Entscheidungen treffen. Wie das Leben eben so spielt, mal geht es leichter und fühlt sich freudvoll an, dann ist es wieder schwieriger, und Gefühle wie Hilflosigkeit und Traurigkeit stellen sich ein. Situationen wiederholen sich in ähnlicher Form. Darunter kann man leiden – oder man erkennt diesen wiederkehrenden Moment als zweite Chance.
Selbstfürsorge oder die Rückbindung an das Selbst
Im fünften und letzten Kapitel geht es dann um den Weg nach innen, die Rückbindung an das Selbst. Im Kontext von sozialer Verantwortung möchte ich diese Prozesse als Selbstfürsorge beschreiben, die im Yoga einen hohen moralischen Stellenwert hat. Das kann jetzt für manche Ohren, die es gewohnt sind, soziales Engagement mit Selbstaufopferung gleichzusetzen, befremdlich klingen. Genau darum ist es aber so wichtig zu verstehen, warum eigene Yogapraxis und ein Rückzug in Stille bedeutsam sind. Denn auch die beste Vision und die überzeugendste Moral bewahren uns nicht davor, im konkreten Tun auszubrennen. Dann nämlich, wenn wir uns mit unseren eigenen Erwartungen überfordern oder an den Spitzfindigkeiten der Realität zerbrechen.
Erst diese Rückbindung an meine inneren Ressourcen regeneriert mich und lässt mich wieder hinspüren zu dem, was es jetzt gerade braucht – für mich. Passt mein Engagement noch? Oder halte ich nurmehr an einem Dogma fest, das meine »inneren Antreiber« von mir einfordern? Die fünf Niyamas, moralische Verhaltensregeln uns selbst gegenüber, können uns helfen, unbeschadet durch einen Verantwortungsprozess zu kommen.
Zu jedem der fünf Niyamas habe ich abschließend vier Stilleübungen entwickelt. Eine Auswahl von fünf Übungen gibt es über einen QR-Code und einen Downloadlink auf Seite 221 auch zum Nachhören. Der Atem wird dabei unser freundlicher Reisebegleiter werden. Hier findet sich also die Brücke von der moralischen hin zur spirituellen Praxis. Es sind meditative, selbstreflexive Übungen mit sehr unterschiedlichem Fokus. Patanjali, der offizielle Verfasser der Yoga-Sutren, beschreibt eine Fülle von Methoden, wie der Weg in den stillen Rückzug, im Rückzug der Sinne von außen, gestaltet werden könnte. Wir haben gerade hier eine große Gestaltungsfreiheit und Wahlmöglichkeiten. Natürlich ist es vertiefend sinnvoll, sich einer ehrenwerten Tradition zu verpflichten und dann diese Form von Meditation, am besten in einer Gruppe, jahrelang zu üben. Vielleicht helfen Ihnen die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten ja dabei, auf den Geschmack zu kommen.