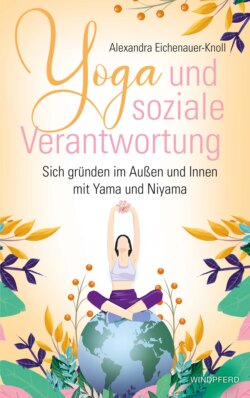Читать книгу Yoga und soziale Verantwortung - Alexandra Eichenauer-Knoll - Страница 7
Was kann der Yoga zu gesellschaftlichem Engagement beitragen?
ОглавлениеDer Yoga ist ein komplexes System aus moralischen Handlungsempfehlungen, Körper- und Atemübungen bis hin zu meditativen Techniken und spirituellen Weisheitslehren. Immer wieder fließt eins ins andere, ein laufend sich umschichtender Prozess – vom Groben ins Feine, vom Gedanken zum Atem, von außen nach innen, von der tiefen Erkenntnis zurück zum alltäglichen Tun … Wir lernen, uns selbst zu beobachten und unsere individuellen Belastungsgrenzen zu erkennen, aber auch, unsere Ressourcen zu stärken und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Mit der Übung wächst die Lust, sich zu erproben – auf der Matte und in den Begegnungen in der Gesellschaft. Yoga macht Lust auf selbstwirksame, soziale Begegnungen. Soziale Verantwortungsübernahme ist ein großes Übungsfeld dafür.
Yoga ist – trotz aller Lehrmeinungen, Schulen und der Entwicklung von unzähligen Yogastilen in den letzten hundert Jahren – immer ein Erfahrungsweg. Nur die Erfahrung macht das möglich, was Yoga ist – ein Ankommen im Hier und Jetzt, ein Seinszustand. Die Erfahrung entsteht durch das Hinspüren – auf das, was gerade präsent ist: Gedanken, Körpergefühle, Stimmungen … Yoga lässt uns die eigene Lebendigkeit spüren. Und damit wächst der Wunsch, auch zukünftige Begegnungen im Außen lebendiger und heilsamer zu gestalten. Yoga vermittelt uns eine Vision für ein achtsames, respektvolles Miteinander. Soziale Verantwortungsübernahme ist ein großes Erfahrungsfeld dafür.
Yoga basiert auf moralischen Handlungsanweisungen, sowohl für Begegnungen im Außen als auch für die eigene Lebensführung – die Yamas und Niyamas, auf die ich später genauer eingehen werde. Wir üben im Yoga, diese Prinzipien inwendig fühlbar zu machen und so von innen nach außen nicht nur eine bessere Aufrichtung der Wirbelsäule, sondern auch ein moralisches Rückgrat zu entwickeln, das uns im Alltag Haltung bewahren lässt. Wenn wir spürend verstehen, warum Haltung unverzichtbar ist, können wir sie auch selbstbewusster in die Gesellschaft hineintragen und vertreten. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn ich beispielweise auf der Matte möglichst ohne Druck übe, also ohne Ehrgeiz und Anspannung, sondern stattdessen mit Hingabe und Wohlwollen, dann kann dieser achtsame Umgang mit Druck, der ja auch eine Form von Gewalt ist, auch meine sozialen Beziehungsmuster verändern. Yoga ist ein ganzheitlicher Weg, ein Lebensweg. Ich mache nicht Yoga und dann etwas anderes. Wenn ich danach mit jemandem spreche, bleibe ich trotzdem im achtsamen Spüren und bleibe meinen moralischen Prinzipien treu. Der Alltag und das Üben auf der Matte sind also auf einer tieferen Ebene nicht wirklich voneinander zu trennen. Die innere Haltung sollte dieselbe sein. Ich kann nicht einen Menschen verletzend behandeln und mich danach genüsslich auf der Yogamatte entspannen. Das ist nicht authentisch. Genauso vice versa: Ich kann kein ganzheitliches Leben führen, wenn ich zwar den anderen die Wahrheit einschenke, über meine eigenen Gefühle und Handlungsmuster hingegen lieber im Unklaren bleibe und meine eigene Selbsterforschung ablehne. Yoga wirkt immer in beide Richtungen – nach innen und nach außen. Yoga ist eine Haltung, die man im Leben einnimmt, und wird spürbar durch das moralische Rückgrat. Soziale Verantwortungsübernahme ist ein großes Betätigungsfeld, um Haltung zu zeigen.
Glücklicherweise gibt es genügend Menschen, die intuitiv richtig handeln und gute Taten setzen. Mit und ohne Yoga. Für alle verantwortungsbewussten Menschen ist es dennoch sinnvoll, die eigenen moralischen Werte und Positionen gelegentlich durchzudenken. Dies dient der Selbsterforschung und liefert eine gefestigtere Basis für konstruktive Gespräche und mehr Entscheidungssicherheit. Warum?
Der norwegische Philosoph und Umweltaktivist Arne Næss prägte Anfang der 1970er Jahre den Begriff »Tiefenökologie«, der später von der Amerikanerin Joanna Macy übernommen wurde. Die Tiefenökologie versteht sich demnach als »tief«, weil die Fragestellungen über Zweck und Wert tiefgründig sind, weil die Fragen bis an das Fundament reichen müssen.2 Damit unterschied Næss sich von dem, was er als »shallow ecology movement« bezeichnete, einen Umweltaktionismus ohne ethische Basis. Næss forderte einen gravierenden Paradigmenwechsel in den Industriegesellschaften und ging davon aus, dass dieser auf einer soliden Basis gegründet sein muss – auf sorgfältig begründeten Normen und Werten und logisch verknüpften Argumentationsreihen: »Mit anderen Worten: Der argumentative Zusammenhang zwischen den je relevanten Grundwerten und den konkreten Entscheidungen lässt sich im Einzelfall nicht immer nachvollziehen. Wie man von Grundwerten wie Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit zur konkreten politischen Umsetzung dieser Prinzipien gelangt, ist auch heute noch ein Buch mit sieben Siegeln.«3 Denn in der Praxis fehlt oft der argumentative Mittelbau, also die argumentative Herleitung zwischen den Grundwerten und den konkreten Maßnahmen. Næss bringt ein Beispiel aus dem norwegischen Schulsystem: Im Curriculum wird zum Beispiel Hilfsbereitschaft gefordert, in konkreten Prüfungssituationen ist Hilfsbereitschaft aber verpönt.4
Ich versuche mich ebenfalls an zwei Beispielen: Hilfsbereitschaft hat einen hohen moralischen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Wenn allerdings Seenotretter:innen Geflüchtete aus dem Mittelmeer ziehen, werden sie behindert, möglicherweise sogar bestraft, zum Schutze der europäischen Außengrenzen – und was heißt das anderes als zum Schutze der europäischen Bürger:innen, und dazu zähle auch ich. Anderes Beispiel: Plastikvermeidung hat inzwischen einen hohen moralischen Stellenwert in unserer Gesellschaft, aber wenn ich beim dörflichen Kaufmann meines Vertrauens einkaufe, um diesen zu stärken und mein Auto nicht zu benützen, dann bekomme ich fast alle Lebensmittel in Plastikverpackung.
Wie löse ich mit meinen konkreten Handlungen diese moralischen Dilemmata? Was kann ich als einzelne Person tun? »Nichts kann ich tun« ist die schlechteste Antwort, denn was passiert, wenn unsere moralischen Ansprüche mit unseren konkreten Handlungen nicht mehr zusammenpassen? Unsere Sätze werden zu hohlen und unglaubwürdigen Phrasen, und unsere Herzen müssen sich vor den Argumentationen der Politiker:innen, die für uns keinen mehr Sinn ergeben, verschließen. Verdrängung alles dessen, keine Nachrichten mehr hören oder lesen?
Ich denke, viele Menschen sehnen sich nach moralischer Stimmigkeit und einem authentischen Leben. Der Yoga bietet einen wunderbaren Baukasten an moralischen Grundwerten. Es wäre also genug Rüstzeug da, um sich im Tieferdenken zu üben und den moralischen Mittelbau bis hin zu konkreten Handlungen durchzudenken. Wir streben im Yoga Stimmigkeit und Entfaltung an, im Körper wie im Atem, in unseren Gefühlen und Gedanken. Warum also nicht auch im Hinspüren auf unsere moralische Befindlichkeit im Hier und Jetzt?
Arne Næss entwickelte ein komplexes System, um moralische Werte von oben nach unten durchzudenken. Ich versuche in diesem Buch etwas anderes: die Yamas (Grundwerte) über konkrete, selbst erlebte Situationen zu reflektieren und dabei mit dem Wahrnehmen, was gerade ist, also mit Erfahrung und Fühlen zu verknüpfen. Das ist für mich Yoga – einen global existierenden Grundwert in meinem Mikrokosmos Mensch aufzuspannen und ganz auf mein eigenes Maß und meine Möglichkeiten zu hinterfragen. So regt mich Yoga zum Tieferdenken an. Soziale Verantwortungsübernahme ist ein großes Feld, um Grundwerte konstruktiv und authentisch in Handlungen umzusetzen.
Dass der Yoga als ein spiritueller Weg der inneren Einkehr gilt, ist dabei kein Widerspruch. Denn der Weg nach innen, die Mystik der Stille, hat in allen spirituellen Traditionen immer auch eine Kehrseite – einen Weg in die Begegnung, hin zu den anderen: die Mystik der Tat.