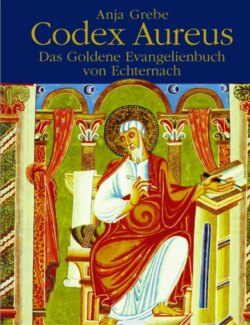Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 10
Die Erwerbung durch das Germanische Nationalmuseum
ОглавлениеDer Erste Direktor des Germanischen Nationalmuseums, Ludwig Grote, konnte sich also des Interesses der Öffentlichkeit gewiss sein, als er Ende 1953 den Ankauf des „Codex Aureus“ unternahm. Die Handschrift befand sich zu diesem Zeitpunkt in München, wo sie 1950 in der Ausstellung „Ars Sacra“ zu sehen gewesen war und anschließend in der Bayerischen Staatsbibliothek deponiert wurde. Eigentümerin war die Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha’sche Stiftung für Kunst und Wissenschaft mit Sitz in Coburg. In den Wirren der letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs hatte Herzog Carl Eduard (1884 – 1954) den Codex neben einigen wertvollen Besitztümern vor den anrückenden Sowjet-Truppen retten können. Im Rucksack eines Angestellten versteckt, soll der Codex samt seinem goldenen Prunkdeckel nach einer abenteuerlichen Eisenbahnfahrt im Frühjahr 1945 das sicherere Coburg erreicht haben.
Erhebliche Vermögensverluste infolge des Krieges zwangen den Herzog zum Verkauf des „Goldenen Evangelienbuchs“. Die Verhandlungen wurden zunächst mit der Bayerischen Staatsbibliothek geführt, doch die Preisforderung überstieg mit 1,2 Millionen Mark die finanziellen Möglichkeiten des Bayerischen Staates in der Nachkriegszeit. Am 17. Dezember 1953 erhielt Ludwig Grote einen vertraulichen Brief von einem Münchner Museumskollegen, der ihm nahe legte, sich als Leiter des Nationalmuseums für den Ankauf des Codex einzusetzen, für den ausländische Interessenten bereits hohe Summen geboten hätten. Zwar stand die Handschrift seit 1921 auf der „Liste der national wertvollen Kulturgüter“, doch sicherte dieser Status einer deutschen Institution nur ein Vorkaufsrecht und beinhaltete keine Ankaufsverpflichtung durch den deutschen Staat. Die Gefahr eines Verkaufs ins Ausland blieb bis zum Abschluss der Erwerbungsverhandlungen 1955 akut. Alle Schwierigkeiten hielten Grote nicht davon ab, umgehend positiv auf das Angebot zu reagieren und damit die Chance wahrzunehmen, das Nürnberger Museum durch den spektakulären Ankauf „dieses Nationaldenkmal[s] erster Klasse“ (Brief Grotes an Ministerialdirigent Bott, 11. Dezember 1954) nachhaltig ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Noch am selben Tag nahm Grote Kontakt zur Herzoglichen Hauptverwaltung und wenig später zu den Finanzierungsstellen des Museums beim Bund auf, ohne zu ahnen, dass sich die Verhandlungen mit ungewissem Ausgang fast anderthalb Jahre ausdehnen würden. Als Hauptproblem erwies sich die Finanzierung. Während beständig höhere Offerten aus den USA eintrafen und die Herzogliche Hauptverwaltung auf einen Verkauf drängte, sah sich Grote immer neuen Verhandlungen mit den Bundes- und Länderministerien ausgesetzt. Dabei hoffte er, dass sich einem Ankaufswunsch von höchster Stelle – der amtierende Bundespräsident Theodor Heuss war zugleich Verwaltungsratsvorsitzender des Germanischen Nationalmuseums – auch die Länderministerien nicht widersetzen würden. Der Ankauf des „Codex Aureus“ sollte zum Politikum in der Geschichte der jungen Bundesrepublik werden: „Wenn ein Kunstwerk überhaupt als nationales Denkmal angesprochen werden kann, ist es dieses Buch. Es darf für Deutschland auf keinen Fall verloren gehen.“ (Brief Grotes an das Bundesministerium des Inneren, 29. Januar 1954).
7
Festakt zum Ankauf des „Codex Aureus“ im Germanischen Nationalmuseum am 9. Mai 1955 in Anwesenheit der Herzogin von Coburg-Gotha.
Um seinem Antrag Nachdruck zu verleihen, war Grote zu Opfern bereit: Mit dem Verkauf eines Kunstwerks aus der Sammlung wollte das Museum selbst einen Teil der Finanzierung übernehmen, womit nicht zuletzt gewährleistet war, dass der Codex tatsächlich zum Eigentum des Museums und nicht zur – widerrufbaren – Dauerleihgabe des Bundes wurde. Die umstrittene Wahl fiel auf das Gemälde „Moses schlägt Wasser aus dem Felsen“ (1527) des Niederländers Lucas van Leyden, für das man auf dem amerikanischen Markt 100 000 US-Dollar, rund 420 000 DM, zu erhalten hoffte. Am Ende konnte Grote mehr als 500 000 DM mit dem Gemälde erzielen – allerdings erst nach einer langen Zitterpartie, welche ihn fast den „Goldenen Codex“ gekostet hätte.
Statt der erlösenden Nachricht vom Verkauf des Bildes erhielt der Erste Direktor um den 1. Dezember 1954 Besuch von James Joseph Rorimer, dem Direktor des New Yorker Museums The Cloisters. Mit einem Angebot von einer Million US-Dollar, etwa 4,2 Millionen DM, trat Rorimer offen als Mitkonkurrent um den „Echternacher Codex“ auf. Erst am 11. Dezember konnte Grote dem Bundespräsidialamt mitteilen, dass der Verkauf des Lucas-van-Leyden-Gemäldes an das Museum of Fine Arts in Boston geglückt war. Diese Nachricht beschleunigte das langsame Vorgehen der Behörden keineswegs.
Angesichts immer höherer Dollar-Gebote des „internationalen Kunsthändlerkonsortiums“ (Brief Grotes an Ministerialrat Hübinger, 11. Dezember 1954) sah sich der Erste Direktor zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen. Zum Weihnachtsfest sandte er an sämtliche Ordinarien für Kunstgeschichte an den Universitäten und die Direktoren wichtiger kulturhistorischer Institutionen ein Schreiben mit der Bitte, sich beim Bundesinnenministerium befürwortend für den Ankauf des Codex einzusetzen. Die Resonanz auf Grotes Aufruf war ausgesprochen positiv. Einhellig war man der Meinung, dass „dieser Schatz Deutschland erhalten“ bleiben müsse (Brief Hans Sedlmayrs an Grote, 23. Dezember 1954), Luitpold Dussler von der Technischen Hochschule München bezeichnete die Erwerbung gar als „nationale Ehrenpflicht“ (Brief an Grote, 10. Januar 1955). Kritisiert wurde allerdings der Verkauf des Lucas-van-Leyden-Bildes.
Nach und nach wurden auch auf politischer Ebene weitere Weichen gestellt. Ein endgültiger Entscheid wurde für die Kultusministerkonferenz am 28. Januar 1955 erwartet. Außerdem fehlte noch die Zusage zum Beitrag der Bundesregierung. Dennoch erschienen in den Medien bereits erste Meldungen über die geplante Erwerbung des „Codex Aureus“. So meldete Grote triumphierend nach Coburg: „Der Blätterwald rauscht nur noch Echternacher Codex“ (Brief vom 10. Februar 1955).
Die Öffentlichkeit wartete ab Mitte Februar 1955 gespannt auf die Nachricht, dass der Kauf getätigt und der Verbleib des Codex in Deutschland gesichert war. Während in Nürnberg erste Glückwunschschreiben zum „Codex Aureus Groteanus Epternacensis et Norimbergensis“ (Brief Albrecht Knaus an Grote, eingegangen 7. März 1955) eintrafen, erreichte Grote die Nachricht, dass der Niedersächsische Kultusminister Voigt Einspruch gegen den Ankauf erhoben hatte, und es war zu befürchten, dass sich weitere Minister dieser Haltung anschließen würden. Grote alarmierte den im Urlaub befindlichen Hessischen Kultusminister Arno Henning, der sich stets für eine Erwerbung des Codex eingesetzt hatte. Dank seiner Hilfe konnten auch die letzten Ankaufsgegner überzeugt werden und am 24. März stimmte die Ministerkonferenz der Länder der Bereitstellung der Mittel zur Erwerbung des „Echternacher Codex“ zu.
Am 30. April nahm Ludwig Grote die Prunkhandschrift in München „in einwandfreiem Zustand“ in Empfang und brachte sie nach Nürnberg, wo am 9. Mai in Anwesenheit der Herzogin von Coburg-Gotha die feierliche Übergabe stattfand (Abb. 7). Damit war das fast anderthalb Jahre währende Ringen um die Erwerbung des Codex zu einem glücklichen Abschluss gelangt und das Germanische Nationalmuseum rechtmäßiger Eigentümer eines Kunstwerks, das in der Presse schon vorab als eines der bedeutendsten Zeugnisse abendländischer Kultur gefeiert wurde: „Der ganz unirdische Farbenglanz der Blätter, die in der ‚Ars Sacra‘ in einer beleuchteten Vitrine in dem kleinen Mittelraum im Münchener Prinz-Karl-Palais auslagen, bleiben unvergessen. […] keine andere der Echternacher Handschriften weist einen solchen Reichtum der Erscheinungen auf. […] Das Zarte, das Melodiöse, der allgemeine Wohllaut kennzeichnen den Echternacher Codex gegenüber der geistdurchwehten Dynamik der Reichenauer Schule; aber auch das ist Ausdruck des christlichen Abendlandes im Mittelalter und macht das Evangeliar aus dem frühen 11. Jahrhundert zu einem der bedeutendsten künstlerischen Zeugnisse, die damals im Westen Deutschlands entstanden sind.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. Februar 1955).