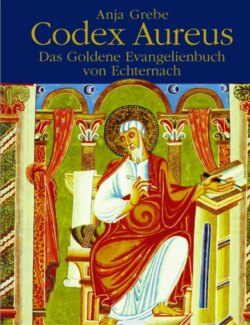Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 16
Der Buchdeckel in Echternach
ОглавлениеDie Abtei Echternach ist während der Regierung Ottos III. mit keinem Ereignis aus dem Dunkel der Überlieferung hervorgetreten, das einen überzeugenden Anlass für ein so wertvolles Geschenk dargestellt hätte. Die eher routinemäßige Gewährung oder Verlängerung von Privilegien unter einem neuen Herrscher erscheint als Grund nicht ausreichend. Für den damaligen Abt Ravanger (973 – 1007), der nach der Reform des Klosters 973 aus Sankt Maximin in Trier nach Echternach gekommen war, sind ebenfalls keine engen Beziehungen zum Kaiserhaus bekannt.
Für eine solch wertvolle Schenkung erforderte es eine besondere Gelegenheit, wie sie etwa der Chronist Thietmar von Merseburg für Magdeburg überliefert hat. Theophanus Gatte Otto II. hatte den Magdeburger Domherren das Recht zur Wahl des Erzbischofs verliehen. Um dieses Privileg zu bekräftigen, übergab der bei der Feier persönlich anwesende Kaiser einen heute verlorenen Codex, der mit den goldenen Bildnissen des Kaiserpaares geschmückt war: „ein Buch, in dem sein und der Kaiserin Theophanu Bildnis, in Gold geformt, leuchtet“ (zitiert nach Kahsnitz 1982, S. 148). Doch ist zuwenig über die Geschenkpraxis der Ottonen bekannt und der erhaltene Bestand an Kunstwerken aus dieser Zeit zu gering, als dass allgemeinere Aussagen oder gar Prinzipien aus den wenigen Quellen und Artefakten abgeleitet werden könnten.
Rätsel umgeben nicht nur den Auftrag, sondern auch die ursprüngliche Verwendung des Deckels vor seiner Verbindung mit dem „Codex Aureus“. Zwar gibt es in mittelalterlichen Kircheninventaren Belege, dass goldene Buchdeckel auch für sich, das heißt ohne eingebundenen Codex, in den Schatzkammern verwahrt wurden, doch bleiben diese Fälle Ausnahmen. Fast alle Prunkdeckel gehören zu einer Handschrift, auch wenn diese in der Üppigkeit ihrer Verzierung weit hinter dem Einband stehen kann. Allerdings ist kein ottonisches Evangeliar bekannt, das von den Maßen und der Entstehungszeit zum Echternacher Buchdeckel passen würde. Dies schließt jedoch die Existenz einer solchen Handschrift nicht aus.
Für den Sonderfall eines einzelnen Buchdeckels könnte die Inschrift sprechen, die sich auf der Innenseite des Vorderdeckels befindet. Dort wurde im oberen Drittel der bloßen hölzernen Rückseite in schwarzer Tinte die zu einer Kirchweihe passende Perikope aus dem Lukasevangelium geschrieben (Lk 19,1 – 10), die sich auf das Vorsatzblatt abgedruckt hat (Abb. 15). Die Schrifttype ist eine sehr gerade karolingische Minuskel, die vom Duktus derjenigen des Echternacher Sakramentars in Darmstadt (um 1030/40) ähnelt, wenngleich nicht identisch ist. Der Entdecker der Inschrift, Carl Nordenfalk, schlug einen Zusammenhang mit der Neuweihe der Echternacher Abteikirche 1031 vor (Nordenfalk 1932). Allerdings erscheint es merkwürdig, dass der Rücken des Prunkdeckels bei der Schenkung unbedeckt geblieben sein soll – zumindest ein Seidenbezug ist zur Verhüllung des bloßen Eichenholzbrettes anzunehmen. In diesem Falle wäre die Inschrift jedoch nicht mehr lesbar gewesen. Zudem liegt das Datum lange nach der Schenkung durch das ottonische Kaiserpaar.
Schließlich besteht die Möglichkeit, dass der Deckel ursprünglich Teil eines Buch- oder Reliquienkastens war, der zur Einbindung des „Goldenen Codex“ zweckentfremdet und mit dem seidenbezogenen Rückendeckel verbunden wurde. Wie ein solcher Kasten ausgesehen haben könnte, zeigt ein zumindest fragmentarisch überliefertes Beispiel aus karolingischer Zeit (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum).
Jede der genannten Möglichkeiten kann hinsichtlich des originalen Aussehens und der ursprünglichen Bestimmung des Deckels in Frage kommen. Kein Rekonstruktionsversuch lässt sich jedoch endgültig beweisen. Welches Anliegen oder welche Gunst Theophanu und Otto mit der Schenkung des goldenen Buchdeckels an das Kloster Echternach verbanden, bleibt weiterhin ein Geheimnis.