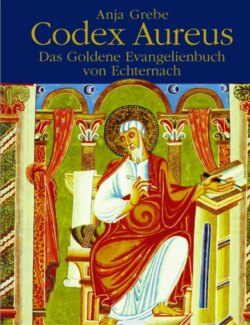Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 6
ОглавлениеVorwort
1982 war der „Codex Aureus“, das „Goldene Evangelienbuch von Echternach“, zum zweiten und letzten Mal im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt. Damals hatte man das Buch auseinandergenommen, um ein vollständiges Faksimile herstellen zu können. Danach verschwand der Buchblock im Tresor der Bibliothek, während der Einband als wertvolle Goldschmiedearbeit, die eine dauerhafte Ausstellung erlaubt, Teil der Mittelalter-Präsentation des Germanischen Nationalmuseums wurde. Doch bereits wenige Jahre später wurde diese Mittelalterabteilung vorübergehend aufgelöst, um dem neuen Eingangsbau des Museums Platz zu machen, und es folgte eine lange Zeit provisorischer Ausstellungsorte in verschiedenen Sammlungsräumen des Germanischen Nationalmuseums. Erst 2006 konnte die neue Mittelalterabteilung des Museums eröffnet werden, in der nunmehr der Einband des „Echternacher Codex“ seinen festen Platz hat.
Die mit goldener Tinte geschriebene und mit zahlreichen Miniaturen versehene wertvolle Pergamenthandschrift wird auch künftig nicht dauerhaft ausgestellt werden. Gleichwohl ist sie eines der am meisten angefragten Objekte des Museums. Das klima- und lichtempfindliche Material erlaubt es aber nicht, sie in den inzwischen zahlreichen Sonderausstellungen zur hochmittelalterlichen Kunst und Kultur, wie sie zuletzt etwa in Berlin, Magdeburg, Paderborn, Bamberg und München gezeigt wurden, zu präsentieren.
Das große Interesse an diesem vielleicht wertvollsten, zumindest aber lange Zeit teuersten Buch Deutschlands, hat das Germanische Nationalmuseum veranlasst, die Handschrift erneut in einer dreimonatigen Ausstellung zu präsentieren. Allerdings wird das Original dafür nicht auseinandergenommen, sondern im Laufe der Ausstellungsdauer geblättert werden. Die jeweils nicht zu sehenden Bildseiten des Originals werden während dieser Ausstellung als Faksimileblätter präsentiert, so dass sich ein Überblick über den gesamten Buchschmuck des Werkes ergibt. Übrigens ist auch dieses hervorragende Faksimile inzwischen im Handel längst vergriffen und erreicht auf Auktionen fünfstellige Preise.
Die Anregung zu der hier vorliegenden wissenschaftlichen Publikation war letzter Auslöser für die Ausstellungsidee. Für Publikation und Ausstellung wurden umfangreiche Forschungen durchgeführt, sowohl von der Autorin Anja Grebe als Kunsthistorikerin als auch von Doris Oltrogge und Robert Fuchs von der Fachhochschule Köln, welche die Handschrift technologisch untersuchten und ihre Ergebnisse großzügigerweise für die Auswertung im vorliegenden Buch zur Verfügung stellten. Die Zusammenarbeit von Kunstgeschichte und Naturwissenschaften erwies sich als äußerst fruchtbar, um viele der bis dahin ungeklärten Fragen beantworten zu können. Damit erscheint erstmals nach dem umfangreichen Faksimile-Kommentar von Rainer Kahsnitz wieder eine grundlegende Publikation zum „Codex Aureus“, die zahlreiche neue Erkenntnisse zur Handschrift und ihrer Entstehung beinhaltet.
So lässt die Buchmalerei – und hier haben die naturwissenschaftlichen Analysen eine wichtige Rolle gespielt – auf den ersten Blick einige Überarbeitungen, bei genauer Untersuchung aber zahlreiche Übermalungen der Darstellungen erkennen. Die wichtigsten Ergebnisse werden in der Ausstellung, didaktisch umsichtig aufbereitet durch Frank Heydecke vom Institut für Kunsttechnik und Konservierung am Germanischen Nationalmuseum, erstmals einem größeren Publikum anschaulich präsentiert. Eine umfassende Publikation der technologischen Untersuchungen durch Robert Fuchs und Doris Oltrogge ist in Vorbereitung.
Kunsthistorisch stellt sich nicht zuletzt die Frage nach der Einordnung des „Codex Aureus“ in den künstlerischen Kontext der Buchmalerei der Ottonen- und Salierzeit und speziell nach dem Verhältnis zwischen Echternach, Trier und der umstrittenen „Reichenauer“ Malerschule, die einigen Forschern als Weltkulturerbe, anderen als reine Fiktion gilt. Buch und Ausstellung wollen die Forschung voranbringen, ohne Eitelkeiten alte Forschungsergebnisse hinterfragen, neue Ergebnisse präsentieren und Anregungen für die künftige Forschung geben. Nach mehr als einem Vierteljahrhundert soll die Forschung einen neuen Impuls erhalten. Wir freuen uns deshalb, dass die Wissenschaftliche Buchgesellschaft in Darmstadt dieses Buch in so hervorragender Weise ausgestattet hat und es einem breiten Interessentenkreis zugänglich macht. Denn natürlich soll das Lesen und Blättern auch Vergnügen bereiten – und auch nach Ablauf der Ausstellung eine bleibende Erinnerung an die Pracht des Originals bieten.
G. Ulrich Großmann
Generaldirektor des
Germanischen Nationalmuseums