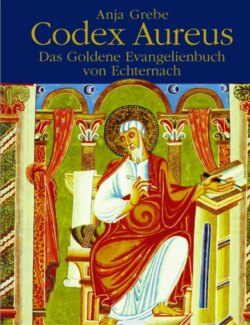Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 9
Der Prunkcodex in Gotha
ОглавлениеBis zum Ende des 18. Jahrhunderts fristete das „Goldene Evangelienbuch“ ein relativ ruhiges Dasein in der Abtei Echternach. Mit der Französischen Revolution überstürzten sich allerdings die Ereignisse. Im August 1794 mussten die Echternacher Mönche sich selbst und ihre wertvollsten Besitztümer vor den plündernden französischen Revolutionstruppen in Sicherheit bringen. Zusammen mit Teilen des Kirchenschatzes und der Bibliothek gelangte der „Codex Aureus“ nach Erfurt in das Benediktinerkloster auf dem Petersberg. Während die Mönche 1795 für eine kurze Zeit nach Echternach zurückkehrten, blieben die Zimelien im Peterskloster. Am 1. September 1796 wurde die Abtei endgültig aufgehoben, Anfang 1797 Gebäude und Klostergut öffentlich versteigert.
Zu den fatalen Folgen der Revolutionszeit zählte die Zerschlagung und teilweise Zerstörung des Echternacher Buchbesitzes. Die Abtei besaß eine lange Buchtradition und eine reiche Bibliothek. Der um 1761 erstellte Bibliothekskatalog des Klosters listet über 4000 Bände auf, darunter rund 160 mittelalterliche Handschriften und zahlreiche Frühdrucke. Zum Zeitpunkt der Auflösung waren vermutlich 7000 bis 8000 Bücher vorhanden, nicht eingerechnet die liturgischen Bücher, die sich in der Kirche, der Sakristei und dem Kirchenschatz befunden hatten.
Der „Ausverkauf“ der Echternacher Bücherschätze begann jedoch schon einige Jahre vor der Französischen Revolution. Zwischen 1785 und 1790 wurden mindestens vier wertvolle Handschriften aus dem Klosterbesitz veräußert, darunter ein mit zahlreichen Initialen geschmückter Psalter des 8. Jahrhunderts, heute in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart, und das um 1030/40 illuminierte „Darmstädter Sakramentar“, die zunächst nach Köln in die Sammlung des Barons von Hüpsch, eigentlich Jean Guillaume Adolphe Fiacre Honvlez (1730 – 1805), gelangten (Abb. 5).
5
„Kreuzigungs“-Miniatur aus dem Darmstädter Sakramentar-Antiphonar, das um 1785/90 aus Echternacher Klosterbesitz an den Kölner Sammler Baron von Hüpsch verkauft wurde (Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 1946, f. 12r).
6
Die älteste Abbildung des Buchdeckels erschien 1858.
Eingefädelt wurde der Verkauf vermutlich vom letzten Bibliothekar des Klosters, Pater Constantin Keiffer, und dem französischen Benediktiner und Handschriftenexperten Jean Baptiste Maugerard. Beide waren auch am Verkauf des „Codex Aureus“ an Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745 – 1804) beteiligt.
Der 1735 geborene Maugerard galt als ausgezeichneter Kenner alter Handschriften und Drucke. Er nutzte seine Bibliotheksreisen allerdings nicht nur zu wissenschaftlichen Zwecken, sondern auch zum Handel mit wertvollen Büchern. Einer seiner Hauptkunden war Herzog Ernst II., dem er zwischen 1795 und 1801 rund 50 Handschriften und zahlreiche gedruckte Bücher vornehmlich aus Klosterbesitz verkaufte. 1802 ernannte ihn die französische Regierung zum „Kunst-Kommissar“ für die Rheinprovinzen. In dieser Funktion beschlagnahmte er in den folgenden Jahren unzählige Handschriften und wertvolle Drucke für die Pariser Nationalbibliothek. Darunter befanden sich auch 84 Handschriften aus Echternach, die nach der Auflösung des Klosters 1797 mit den verbleibenden Beständen der Bibliothek in die neu gegründete Luxemburger Zentralschule überführt worden waren. Aufgrund dieser Vorkommnisse sind die ehemaligen Bestände der Klosterbibliothek heute weitgehend auf die Nationalbibliotheken in Paris und Luxemburg verteilt, einige geringere Bestände gelangten in die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv Trier.
Nach der endgültigen Auflösung der Klosters sahen sich die Echternacher Mönche zur Bestreitung ihres Lebensunterhalts zum Verkauf des in Erfurt deponierten Klosterschatzes gezwungen. In Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg war rasch ein Interessent für den „Codex Aureus“ und andere Zimelien gefunden, doch zogen sich die Verkaufsverhandlungen über mehrere Jahre hin. Den Kontakt hatte vermutlich Jean Baptiste Maugerard hergestellt, der dem bibliophilen Herzog aus Echternacher Besitz bereits eine Riesenbibel des späten 11. Jahrhunderts (Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, Memb. I 1), eine Sammelhandschrift mit Werken des Abtes Thiofried (Gotha, Memb. I 70) und den „Liber Aureus“ (Gotha, Memb. I 71), das wichtigste Kopialbuch der Abtei mit Abschriften Echternacher Urkunden von 715 bis 1222, verkauft hatte. Pater Keiffer hatte dem Herzog den „Codex Aureus“ zunächst für 200 Karolin, rund 2200 Gulden, angeboten. Am 1. September 1801 erwarb Ernst II. den Codex aus seiner Privatkasse schließlich für 120 Karolin zusammen mit weiteren wertvollen Handschriften und Inkunabeln.
Zwischen 1801 und 1945 gehörte der „Codex Aureus“ zu den Prunkstücken der Herzoglichen Bibliothek in Gotha. Als „Echternacher Evangeliencodex“ wurde er nicht nur einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, sondern stand auch erstmals der wissenschaftlichen Erforschung zur Verfügung (Abb. 6). 1835 widmete ihm der Kurator Georg Rathgeber in seiner „Beschreibung der Herzoglichen Gemälde-Gallerie zu Gotha“ eine längere Würdigung: „Der Codex, durchaus mit goldener Schrift geschrieben, besteht aus 135 ungemein schönen Pergamentblättern. Unter diesen sind diejenigen, welche Gemälde oder die Titel, wodurch das folgende von dem vorhergehenden Evangelium getrennt werden soll, enthalten, purpurbraun angestrichen. […] Sowohl diese als die ähnlichen Titel der übrigen Evangelien nehmen jedes Mal eine ganze Folioseite ein und sind mit verschwenderischer Pracht ausgeziert. […] Ich schließe diese Beschreibung des Evangelienbuches mit allgemeinen Betrachtungen über den Styl seiner Malereien. Derselbe ist fast durchgängig der Byzantinische, wie er damals im Hauptsitz Byzantinischer Kunst, in Constantinopel, bestand.“ (Rathgeber 1835, S. 12 – 18).
Bahnbrechend wirkte eine ausführliche Abhandlung Karl Lamprechts, in der er den Bildschmuck des Evangeliars mit jenem des Trierer „Codex Egberti“ (um 980/90) verglich, welcher in der Folge immer wieder als maßgebliche Vorlagenhandschrift für den Miniaturenzyklus genannt werden sollte. Die Popularität des „Codex Aureus“ zeigt nicht zuletzt die häufige Verwendung seiner Miniaturen und Zierseiten in Jahresgaben, so etwa 1930 als „Neujahrsgabe der Vereinigung von Freunden des Kunsthistorischen Instituts in Bonn“. Auch der Prunkdeckel erregte wegen der Darstellungen Ottos III. und Kaiserin Theophanus weiterhin die Aufmerksamkeit von Publikum und Wissenschaft.