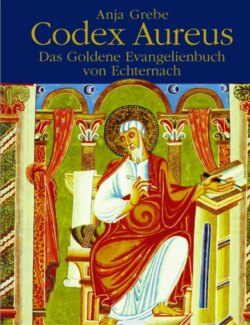Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 7
Der „Codex Aureus“ – Glanzstück der salischen Buchkunst
ОглавлениеDer „Codex Aureus Epternacensis“ – das „Goldene Buch von Echternach“ – zählt zu den bedeutendsten Bücherschätzen des Mittelalters (Abb. 1). Er entstand um 1045 in der Benediktinerabtei Echternach, dem wichtigsten Skriptorium der Salierzeit. Der Codex wurde ausschließlich mit Goldtinte geschrieben – daher der Name „Codex Aureus“ („Goldener Codex“). Nach einer spannenden Ankaufsgeschichte wurde die Handschrift als bis dahin teuerstes Buch Deutschlands im Jahre 1955 für das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg erworben. Seither ist sie einer der Publikumsmagneten des Museums, auch wenn sie aus konservatorischen Gründen nur selten gezeigt werden kann.
Zum Codex gehört ein kostbarer, edelsteingeschmückter Buchdeckel. Er ist ein Meisterwerk der Trierer Goldschmiedekunst um 985/90, gefertigt aus Gold, Elfenbein, Email, Edelsteinen und Perlen. Er gelangte vermutlich als Stiftung der Kaiserin Theophanu und ihres Sohnes Otto III. nach Echternach. Rund 50 bis 60 Jahre später fertigten die Echternacher Buchkünstler den „Goldenen Codex“ und schmückten ihn mit dem Prunkdeckel. Der Codex besitzt mit seiner goldenen Schrift und prächtigen Ausstattung alle Kennzeichen einer kaiserlichen Handschrift, doch bleibt sein Auftraggeber unbekannt.
Als Evangeliar enthält der „Codex Aureus“ den vollständigen Text der vier Evangelien, ergänzt durch Vorreden, Kapitelverzeichnisse und die Kanontafeln. Mit ihrem Folioformat gehört die Handschrift zu den größten ihrer Zeit. Sie besitzt einen außergewöhnlich umfangreichen Buchschmuck. Keine Seite blieb unverziert. Initialen in Gold und Purpur schmücken die Evangelientexte, farbige Zierfelder und Zierkolumnen kennzeichnen besondere Textanfänge. Ungewöhnlich reich gestaltet sind die zehn Kanontafeln unter einer antik anmutenden Bogenarchitektur. Jedes Evangelium beginnt mit einer Sequenz von ganzseitigen Miniaturen und Zierseiten (Abb. 2). Besonders prunkvoll ist die Titelillustration zu Beginn des Evangeliars (f. 2v – 3r). Gerahmt von den Evangelistensymbolen thront Christus als Weltenherrscher („Majestas Domini“) in einer goldenen Mandorla, auf der rechten Seite flankiert von zwei Engeln, die ein Lobgedicht zu seinen Ehren präsentieren.
Mit seinen zahlreichen Bild- und Schmuckseiten ist der „Codex Aureus“ eine der am reichsten verzierten Handschriften des Mittelalters. Er steht in einer Reihe mit den bedeutendsten Handschriften der ottonisch-salischen Buchkunst wie dem „Codex Egberti“ (um 980/85), dem „Perikopenbuch Heinrichs II.“ (um 1012) oder dem „Codex Aureus Escorialensis“ (um 1045/50). Alle diese Handschriften sind in jüngerer Zeit umfassend untersucht und in aufwendigen Faksimile-Editionen publiziert worden, wobei zahlreiche neue Einsichten über ihre Herstellung, die beteiligten Künstler und mögliche Vorlagen gewonnen werden konnten, die das Bild der ottonischen Buchmalerei wesentlich schärfer umrissen haben.
Dies war ein Anlass, auch den Nürnberger „Codex Aureus“ mit neuen kunsthistorischen Fragestellungen und modernen technologischen Methoden zu untersuchen. Die im Auftrag und in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Germanischen Nationalmuseums im Jahre 2006 durchgeführte technologische Analyse durch Robert Fuchs und Doris Oltrogge von der Fachhochschule Köln förderte überraschende Ergebnisse zutage, die bislang ungeahnte Einblicke in die Enstehungsumstände des Prachtcodex geben. Zuletzt war der „Goldene Codex“ 1982 im Rahmen der Faksimilierung und Begleitausstellung in zwei Monografien gewürdigt worden. Die maßgeblich von Rainer Kahsnitz verfassten und herausgegebenen Publikationen enthalten ausführliche Beiträge zur Geschichte des Klosters Echternach sowie der Geschichte und Forschungsgeschichte der Handschrift (Kahsnitz 1982 und Kahsnitz u. a. 1982). Ein Schwerpunkt des Faksimilekommentars liegt auf einer umfassenden Analyse des Bildprogramms des Prunkdeckels und der Herkunft vieler Motive unter Berücksichtigung der Untersuchungen Hiltrud Westermann-Angerhausens zur Trierer Goldschmiedewerkstatt des 10. Jahrhunderts unter Erzbischof Egbert (Westermann-Angerhausen 1973) und Frauke Steenbocks Grundlagenwerk zum „Kirchlichen Prachteinband“ des frühen und hohen Mittelalters (Steenbock 1965). Offen bleiben hingegen die Fragen nach dem genauen Stiftungsanlass und der ursprünglichen Erscheinungsform des Deckels sowie dem Zeitpunkt seiner Verbindung mit der Handschrift, die bis heute nicht abschließend geklärt sind.
1
Vor dem Matthäusevangelium präsentiert ein Engel ein riesiges geöffnetes Buch mit goldenen Zeilen (f. 21r).
2
Prunkinitiale „Liber“ („Buch“) zum Beginn des Matthäusevangeliums (f. 22r).
Die Trierer Kunstproduktion des späten 10. Jahrhunderts, vor allem die Buchmalerwerkstatt des sogenannten „Meisters des Registrum Gregorii“ („Gregormeisters“), ist der zweite Schwerpunkt von Kahsnitz’ Faksimilekommentar. Ausgehend von Carl Nordenfalks „Chronologie“ (Nordenfalk 1972) gibt er einen Überblick über die Werke des „Gregormeisters“, der neben Erzbischof Egbert („Codex Egberti“) auch für das Kloster Echternach tätig war. Erstmals ausführlich wissenschaftlich gewürdigt wird von ihm das „Evangeliar der Sainte-Chapelle“, das er als unmittelbaren „Anreger und Vorbild“ (Kahsnitz 1982, S. 58) für den „Codex Aureus“ sieht, wobei die genauen Vermittlungswege nicht weiter thematisiert werden. Eine umfassende ikonografische und stilistische Analyse des Miniaturenschmucks des „Goldenen Evangelienbuchs“ selbst war zwar vorgesehen, kam jedoch nicht mehr zustande. Ansätze hierzu enthalten die älteren Publikationen von Peter Metz (Metz 1956) zum Nürnberger „Codex Aureus“ und Carl Nordenfalks Kommentar zum „Codex Caesareus“, der weit über seinen eigentlichen Gegenstand hinaus die Echternacher Buchmalerei insgesamt betrachtet (Nordenfalk 1971). Nordenfalk bemerkte bereits, dass viele der Echternacher Prunkhandschriften stilistisch unterschiedliche Miniaturen enthalten, wobei er einen Hauptmeister, den „Werkstatt-Meister“ („Workshop-Master“), und einen Gehilfen, den „Meuterer-Meister“ („Master of the Muniteers“), unterschied, die gemeinsam für den Großteil des Buchschmucks verantwortlich gewesen seien. Die Beobachtungen des schwedischen Forschers wurden in den wenigen späteren Überblicksdarstellungen (Plotzek 1974, von Euw 1999) und Publikationen zu einzelnen Echternacher Handschriften (Knoll 1981/1993, Kahsnitz 1982, Rathofer 1999/2001) nicht weiter diskutiert.
Eine genaue Analyse des Buchschmucks und Ausstattungskonzepts des „Codex Aureus“ sowie der Herstellung des Evangelienbuchs und eine Untersuchung zu Zusammensetzung und Arbeitsweisen des Echternacher Skriptoriums fehlt in der bisherigen Literatur. Sie sind der Hauptgegenstand der vorliegenden Publikation. Auch wenn nicht alle Geheimnisse der Handschrift ergründet werden konnten, ließen sich dank einer präzisen Fragestellung, einer interdisziplinären Herangehensweise und neuer technologischer Untersuchungsmethoden, die der älteren Forschung vielfach noch nicht zur Verfügung standen, zahlreiche neue Erkenntnisse zu den Entstehungsumständen des „Goldenen Evangelienbuchs“ gewinnen. Mit Robert Fuchs und Doris Oltrogge führten zwei Spezialisten auf dem Gebiet der technologischen Handschriftenforschung die Untersuchung des „Codex Aureus“ durch, die zudem durch ihre vorherigen Analysen des Echternacher „Codex Caesareus“ (Fuchs/Oltrogge 2001) und von Handschriften der Trierer Werkstatt des „Gregormeisters“ (z. B. Fuchs/Oltrogge 2005) breites Vergleichsmaterial besaßen. Die Ergebnisse der technologischen Untersuchung des „Codex Aureus“ sind so umfangreich, dass sie in einer eigenen Monografie dargelegt werden sollen. Zentrale Erkenntnisse konnten aber dank einer großzügig zur Verfügung gestellten Vorab-Auswertung bereits für die vorliegende kunsthistorische Analyse des „Echternacher Evangelienbuches“ verwendet werden.
Die Untersuchung förderte überraschende Ergebnisse zutage, die ungeahnte Einblicke in die Entstehungsumstände des Prachtcodex geben.
Schon mit bloßem Auge ist zu erkennen, dass mehr als die drei von Nordenfalk genannten Maler an der Ausführung der Handschrift beteiligt waren. Die technologische Analyse ermöglichte, das Zusammenwirken der Schöpfer besser zu fassen. Zu den erstaunlichsten Erkenntnissen gehören die umfangreichen Übermalungen, die auf fast jeder Bildseite festgestellt wurden. Auch wenn für die Übermalungen kein eindeutiger Grund vorzuliegen scheint, erlauben sie Einsichten in die Arbeitsweisen des Echternacher Skriptoriums.
Die Zusammenarbeit der Miniaturisten war viel enger als bislang angenommen. Sie betrifft nicht nur den „Codex Aureus“, sondern auch die anderen Echternacher Prunkhandschriften. Alles deutet darauf hin, dass in Echternach zwischen 1040 und 1050 die bedeutendste Buchwerkstätte des Salierreichs existierte, die sich auf Prachtcodices für das Herrscherhaus und hochrangige Kirchenfürsten spezialisiert hatte. Im Mittelpunkt der Produktion steht der Nürnberger „Codex Aureus“. Er ist mit den anderen Handschriften einerseits durch die Verwendung gemeinsamer Vorlagen und einer ähnlichen Ornamentik, andererseits durch personelle Überschneidungen eng verbunden. Diese enge Verflechtung mit der um 1040 bis 1050 entstandenen Hauptgruppe Echternacher Prunkhandschriften hat zur Folge, dass die bisherige Datierung des Codex neu überdacht werden muss. Statt als frühes Meisterwerk um 1030 entstand er sehr wahrscheinlich um 1045 als Herzstück der Gruppe, und damit zu einer Zeit, als das Skriptorium die höchste Aufmerksamkeit des Salierherrschers Heinrich III. genoss.
Mit der neuen Datierung des „Codex Aureus“ muss aber auch die Frage nach den bislang ungeklärten Ursprüngen und der weiteren Entwicklung der Echternacher Buchmalerei im 11. Jahrhunderts erneut gestellt werden. Durch die Untersuchung wird eine präzisere Einordnung des Codex wie der gesamten Echternacher Buchmalerei in die ottonische bzw. salische Kunst möglich.
Die Kunst der Salierzeit, die mit der Regierung Konrads II. (1024 – 1039) beginnt und mit der Herrschaft Heinrichs V. (1106 – 1125) endet, wird immer noch als Teil der ottonischen Kunst oder als „spätottonisches“ Anhängsel an die ottonische Blütezeit betrachtet. Nicht nur in politischer Hinsicht sollte das Jahrhundert der Salier als eigene Epoche gelten. Auch kunsthistorisch sind genug eigenständige Stilmerkmale vorhanden, die es rechtfertigen, von einer Kunst der Salierzeit zu sprechen. Ebenso wie die ottonische Kunst aus der karolingischen hervorgegangen ist, ist die salische aus der ottonischen Kunst erwachsen. Mit dem Tod des letzten Ottonenherrschers Heinrich II. (1002 – 1024) bestanden die Werkstätten und Skriptorien weitgehend fort und bildeten den Nährboden für die neue Kunst der Salierzeit. Diese zeichnet sich durch Charakteristika wie Klarheit in den Strukturen, ein höchstes Streben nach Prachtentfaltung, den Einbezug internationaler ebenso wie vielfältiger historischer Vorbilder und ein ausgesprochenes Interesse an Materialimitationen aus.
Ein herausragendes Beispiel für den neuen Stil ist der „Codex Aureus“. In ihm offenbart sich die Verbindung von ottonischer und salischer Kunst in geradezu symbolhafter Art und Weise. Mit dem von Otto III. und Theophanu gestifteten Prunkdeckel bildete die ottonische Kunst gleichsam den Rahmen, unter dessen Schutz die salische Kunst eine umso größere Blüte entfalten konnte. Selbst wurde die Kunst der Salierzeit zur Voraussetzung der im 12. Jahrhundert beginnenden Romanik in Deutschland. Es gehört zu den großen Glücksfällen, dass der „Codex Aureus“ und sein Prunkeinband bis auf den heutigen Tag in weitgehend unversehrter Form erhalten blieben. Handschrift und Deckel besitzen eine über tausendjährige Geschichte. Ihre Faszination hält bis heute an.