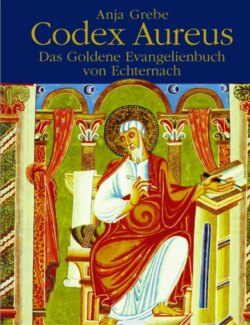Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 13
Der Goldschmiederahmen
ОглавлениеDas rahmende Gemmenkreuz wird aus unterschiedlich gemusterten rechteckigen Emailplättchen im Wechsel mit verschiedenfarbigen Edelsteinen in ziselierten Fassungen gebildet (Abb. 11). Die insgesamt 14 verschiedenen Emailmuster sind in den rechten und linken Rahmenstreifen spiegelsymmetrisch angeordnet, während es bei den oberen und unteren Streifen zu Verschiebungen kommt, die teilweise durch Reparaturen beziehungsweise Restaurierungen zu erklären sind. Die Blatt- und Rankenornamente der Emails entsprechen Formen, wie sie sich in der ottonischen Trierer Buchmalerei, aber auch in der Initial- und Rahmenkunst der karolingischen Buchmalerei finden lassen. Der Herkunftsort Trier wird neben der Ornamentik auch durch die Emailtechnik nahegelegt, die sich ähnlich auf den für Erzbischof Egbert gearbeiteten Reliquiaren findet. Außer Voll- und Zellenschmelzen verwandten die Trierer Goldschmiede auch farbige Fonds, welche die Farbwirkung der Emails verstärkten.
Typisch für die Trierer Werkstatt sind die herzförmigen Almandine, welche die großen Edelsteine an den Ecken rahmen. Am häufigsten wurden Amethyst, Bergkristall, Perlmutt und Smaragd verwandt, daneben finden sich einzelne Beispiele für grauen Achat, Onyx, Granat, Chalzedon, Glas, gefärbten Chalzedon, Karneol und Pyrit. Das Arrangement der Edelsteine scheint im Gegensatz zu den Emailplättchen eher willkürlich bestimmt, hinsichtlich ihrer Größe und Farbigkeit lässt sich kein strenges Prinzip erkennen. Nur für die Ecken und Mittelstücke scheinen meist besonders große Steine ausgewählt worden zu sein.
Allerdings sind genauere Aussagen über die ursprüngliche Anordnung der Edelsteine kaum mehr möglich, da rund die Hälfte nicht mehr original ist. Misstrauisch stimmt bereits der neuzeitliche Schliff vieler Steine, der im Gegensatz zur typisch muggeligen Form der mittelalterlichen Edelsteine steht. Auch an den Fassungen lässt sich erkennen, dass die originalen Steine eine andere Form besessen haben müssen, die für die Ersatzsteine entsprechend zurechtgedrückt wurde. Der Nürnberger Buchdeckel zeigt exemplarisch, wie wichtig es ist, sich zunächst über die Originalität der verwandten Materialien klar zu werden, bevor Aussagen über das ursprüngliche Bild- oder Dekorationsprogramm oder gar eine symbolische Bedeutung der Bestandteile getroffen werden. Weitgehend original sind hingegen die grazilen ziselierten Fassungen und die fein geschmiedeten Zackenbänder, die zwischen den diagonalen Perlbändern verlaufen. Sie offenbaren die hohe Kunst des Trierer Goldschmiedeateliers.
11
Goldrelief mit Johannes-Adler und der Personifikation des Paradiesflusses Geon, gerahmt von Edelstein-Email-Bändern. Prunkdeckel des „Codex Aureus“ (Detail).
Die Edelstein-Email-Bänder rahmen sowohl die Elfenbeinplatte wie die getriebenen Goldreliefs, die sie zugleich in acht Zonen gliedern. In jedem Kompartiment sind jeweils zwei äußerst fein gearbeitete Figuren beziehungsweise Personifikationen zu sehen. Die plastische Wirkung der im Laufe der Jahrhunderte stark eingedrückten Figuren muss ursprünglich weitaus stärker gewesen sein. Heute vermitteln wohl am ehesten die oberen rechten Felder einen Eindruck vom einstigen Erscheinungsbild. Alle Figuren stehen auf kleinen Erdhügeln und sind durch Inschriften, teilweise auch Attribute, identifizierbar.
Die Auswahl der Personen scheint allein durch den Auftrag begründet und ist in keinem anderen Beispiel überliefert. Während die Evangelistensymbole gewissermaßen zum Standardprogramm frühmittelalterlicher Buchdeckel gehören, sind die vier Paradiesflüsse hier erstmals als Deckelverzierung belegt. Als Vorbild dienten dem Künstler sehr wahrscheinlich antike Darstellungen von Flussgöttern, wofür ihre lagernde Pose, die vasenartigen Attribute und die naturalistische Baumgestaltung sprechen. Zwar konnte keine exakte Vorlage ausfindig gemacht werden, doch waren in der einstigen Römerstadt Trier im 10. Jahrhundert zahlreiche antike Bau- und Kunstwerke vorhanden, die den ottonischen Künstlern als Anregungsquelle gedient haben könnten. Möglich ist auch eine Vermittlung über karolingische Kopien. Die Figuren erscheinen in den oberen Kompartimenten freier, zugleich wirkt die Komposition dort ausgewogener und die Evangelistensymbole und Flusspersonifikationen sind stärker aufeinander bezogen. Allerdings ist die Detailzeichnung der Figuren oder der Flügel der Evangelistensymbole ähnlich fein ausgearbeitet. Letztlich erlaubt der Erhaltungszustand der Reliefs keine Entscheidung in der Frage, ob die oberen und unteren Reliefs von unterschiedlichen, wenn auch stilistisch eng verwandten Künstlern geschaffen wurden.
Die Heiligen- und Stifterfiguren an den Seiten zeichnen sich durch eine schlanke, die Vertikale betonende Körperform und eine eher steife Haltung aus. Der Eindruck von Starre wird auch dadurch verstärkt, dass die Gewänder wie Hüllen wirken, die nur wenig Binnenzeichnung aufweisen. Die Figuren sind der Kreuzigung in der Mitte zugewandt. Die sechs Heiligen tragen als Attribut ein Buch in den Händen, Petrus zusätzlich einen mit seinem Namen versehenen Schlüsselstab, während die Stifterfiguren ihre Hände im Akklamationsgestus erhobenen haben. Betrachtet man Kreuzigungsdarstellung und Rahmenfiguren im Zusammenhang, so erscheinen diese wie eine inhaltliche Ergänzung der Binnenszene, die gewissermaßen zum Typ einer volkreichen Kreuzigung erweitert wird, angeführt durch die Gottesmutter Maria und den Apostelfürsten Petrus.