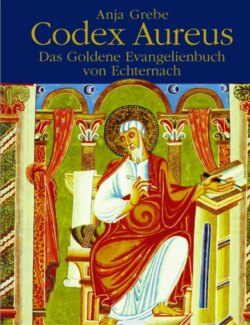Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 15
Zur Frage von Stiftern und Stiftungsanlass
ОглавлениеAusgehend von der Interpretation des theologischen Programms stellt sich die Frage nach weiteren Bedeutungsebenen des Buchdeckels. Die Darstellung des kaiserlichen Paares könnte auf eine mögliche politische beziehungsweise kirchenpolitische Funktion hinweisen und gibt Anlass zur Frage nach den genauen Umständen seiner Stiftung beziehungsweise Schenkung. Ungeklärt ist auch die ursprüngliche Verwendung des Prunkdeckels, bevor er Mitte des 11. Jahrhunderts mit dem „Codex Aureus“ verbunden wurde. Dabei sind sein Programm und der Bezug einzelner Figuren zu Echternach keineswegs so eindeutig und zwingend, wie dies von der Forschung bislang behauptet wurde. Vielmehr gibt die Wahl der Personen Rätsel auf.
Ein unmittelbarer Stiftungsanlass ist weder in schriftlichen Dokumenten überliefert noch ergibt er sich aus der Darstellung des Buchdeckels. Es kann daher nur versucht werden, das theologische Programm des Deckels mit historischen Daten zur Abtei Echternach, dem Stifterpaar Otto III. und Theophanu sowie der Darstellungspraxis kaiserlicher beziehungsweise königlicher Stifter in der Ottonenzeit im Allgemeinen in Zusammenhang zu bringen. Dabei spielt neben der Auswahl auch die in der spezifischen Anordnung vermittelte Hierarchie der Personen auf dem Buchdeckel eine Rolle.
Die Spitze der Figurenreihe nehmen Maria und Petrus ein. Maria genoss als Gottesmutter seit dem frühen Mittelalter besondere Verehrung. Zahlreiche Kirchen im Frankenreich besaßen ihr Patrozinium. Im Gegensatz zu den späteren Salierkaisern scheinen jedoch weder Otto III. noch Theophanu Maria über das übliche Maß hinaus verehrt oder ihren Kult besonders gefördert zu haben. In der Echternacher Abteikirche wurde ihr 1034 der Hauptaltar der Krypta geweiht, wo sie vermutlich auch vor dem Neubau der Kirche verehrt worden war. Dem Apostelfürsten Petrus waren ebenfalls zahlreiche bedeutende Kirchen und Dome geweiht, so auch die Klosterkirche in Echternach.
Direkt unter Maria im selben Kompartiment erscheint der heilige Willibrord (658 – 739), der damit als wichtigster Heiliger nach Petrus hervorgehoben ist (Abb. 13). Der im bischöflichen Messornat mit Pallium dargestellte Missionar wurde von Papst Sergius I. 695 zum Erzbischof der Friesen ernannt und begründete im Auftrag Pippins II. das Bistum Utrecht. Um 698 gründete er das Kloster Echternach. Dank zahlreicher Wunder erfuhr der in der Echternacher Abteikirche bestattete Willibrord schon bald nach seinem Tod die Verehrung eines Heiligen und wurde Mitte des 8. Jahrhunderts zu einem der Titelheiligen der Kirche. Sein Kult erstreckt sich neben Echternach vor allem auf Kirchen im Bistum Utrecht und der Eifel.
12
Goldrelief mit Petrus und Bonifatius vom Prunkdeckel des „Codex Aureus“ (Detail).
13
Die älteste bekannte Darstellung des heiligen Willibrord findet sich auf dem Prunkdeckel des „Codex Aureus“.
Ihm gegenüber steht sein Zeitgenosse und Missionarskollege Bonifatius (um 675 – 754). Der seit dem 16. Jahrhundert als „Apostel der Deutschen“ bekannte Bischof und Märtyrer betätigte sich ab 716 unter Willibrord in der Friesenmission, bevor er sich ab 722 in päpstlichem Auftrag der Bekehrung der germanischen Völker und der Einrichtung von Bistümern im Frankenreich widmete. Im Jahr 754 wurde er im friesischen Dokkum erschlagen. Die Figur auf dem Echternacher Buchdeckel gilt als die früheste bekannte Darstellung des Bonifatius in der Kunstgeschichte. Verehrt wurde er vor allem in seiner Klostergründung Fulda, im Bistum Mainz, in Franken und Thüringen, später auch in Utrecht.
In den beiden unteren Kompartimenten sind links der heilige Benedikt und Otto III., rechts der heilige Liudger und Theophanu dargestellt. Der unter Willibrord in Tunika und Überwurf stehende Benedikt (um 480 – um 547) war Gründer des Benediktinerordens und Verfasser der ersten Mönchsregel, nach der das Echternacher Kloster 973 nach einer Zeit als Kanonikerstift reformiert wurde. Ihm gegenüber ist der heilige Liudger (um 740 – 809) zu sehen, der von Karl dem Großen zum Leiter der Friesen- und Sachsenmission berufen und 805 zum Bischof von Münster geweiht wurde. Seine Verehrung beschränkte sich zur Ottonenzeit vor allem auf das Bistum Münster, das von Liudger gegründete Benediktinerkloster Werden bei Essen und einige Orte in Friesland beziehungsweise der Diözese Utrecht.
Unterhalb der Heiligen, doch in gleichem Maßstab, sind die beiden Stifter „Otto Rex“, das heißt Otto III. (980 – 1002), und „Theophanu Imperatrix“, also Kaiserin Theophanu (950/55 – 991), dargestellt (Abb. 14). Otto erscheint im selben Kompartiment wie Benedikt, während Theophanu ein Feld mit Liudger teilt. Weder für Otto noch für Theophanu ist eine spezielle Verehrung für einen dieser Heiligen bekannt, gleiches gilt auch für ihre Beziehung zu Bonifatius und Willibrord. Die Stiftungstätigkeit der Ottonen konzentrierte sich auf ihre sächsischen Kerngebiete und besonders das Bistum Magdeburg. Theophanu förderte vor allem die Abtei Memleben, bedachte aber auch das Kölner Pantaleonskloster, das sie als Grablege bestimmt hatte.
Ein engerer Bezug zu Echternach, der über die einem „normalen“ Reichskloster entgegengebrachte Aufmerksamkeit hinausgehen und einen Stiftungsanlass bieten würde, ist in den Quellen nicht überliefert. Ein Aufenthalt in Echternach ist für keinen der beiden Stifter bezeugt. Auch die Urkunde, in welcher Otto III. am 15. Mai 993 auf Bitten des Klostervogts Graf Sigfried und explizit zum Seelenheil seines Großvaters Otto I., seines Vaters Otto II. und seiner Mutter Theophanu dem Kloster Echternach sämtliche im Reich gelegenen und von Reichswegen an andere zu Lehen gegebenen oder durch Gewalt entwendeten Kirchen restituierte, bekräftigt allein die legitimen, lange eingeforderten Ansprüche der Abtei (Wampach 1930, Nr. 180). Der Vorgang belegt weder ein besonderes Verhältnis des Herrschers zum Kloster noch eine besondere Verehrung Ottos III. für den heiligen Willibrord. Aus den Quellen geht kein Anlass für die Schenkung des Prunkdeckels hervor.
Betrachtet man die Heiligen auf dem Deckel, so handelt es sich mit Ausnahme von Maria und Benedikt um Bischöfe oder Erzbischöfe. Wäre nicht der Ordensgründer Benedikt dargestellt, so hätte der Buchdeckel eher als Geschenk an die Kathedrale von Utrecht Sinn gemacht, deren erster Erzbischof Willibrord war. Denn der Bezugspunkt der übrigen Heiligen besteht in der Friesenmission der frühen Karolinger, als deren Begründer Willibrord wirkte. Der Buchdeckel beinhaltet damit ein kirchenpolitisches und kirchenhistorisches Manifest wie kaum ein anderes bekanntes Kunstwerk der Zeit. Die Betonung des Benediktinerordens bestätigt jedoch das Kloster Echternach als plausibelsten Bestimmungsort.
Die Bezeichnung Ottos als „REX“ und Theophanus als „IMP(eratrix)“ legt eine Entstehung zwischen 983 und 991 während der Regentschaft Theophanus für ihren minderjährigen Sohn Otto nahe. Diese Zeitspanne lässt sich mit Blick auf den Thronfolgestreit nach dem plötzlichen Tod Ottos II. am 7. Dezember 983 in Rom mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Jahre zwischen 985 und 991 eingrenzen. Theophanu kehrte erst im Frühjahr 984 nach Deutschland zurück, am 29. Juni 984 konnte sie Otto III. aus den Händen seines Entführers, Heinrich des Zänkers, in Empfang nehmen, die endgültige Aussöhnung mit Heinrich erfolgte erst auf der Frankfurter Reichsversammlung am 2. Juli 985. Da zu Heinrichs Parteigängern auch Erzbischof Egbert von Trier gehörte, kann vermutet werden, dass Theophanu den Auftrag für die Anfertigung des Prunkdeckels in den Trierer Werkstätten erst nach der Versöhnung erteilte. Geht man von einem arbeitsteiligen Herstellungsprozess aus, so müssen für die Anfertigung des Buchdeckels mindestens sechs Monate gerechnet werden.
14
Kaiserin Theophanu, Stifterin des Prunkdeckels.
Dass die Trierer Goldschmiede überhaupt Aufträge von auswärtigen Bestellern annahmen und nicht nur für den eigenen Bedarf arbeiteten, geht aus einem Brief des Reimser Erzbischofs und späteren Papstes Sylvester II., Gerbert von Aurillac, an Egbert hervor. Gerbert, der auch Lehrer Ottos III. war, bat Egbert im Sommer 987 um die Anfertigung eines Kreuzes, wobei er neben Modellzeichnungen das nötige Gold und die Edelsteine mitsandte: „Für das vorgesehene Werk senden wir gezeichnete Bildvorstellungen. Eine bewundernswerte Form möge der Bruder (der Erzbischof von Trier) für den Bruder (den Erzbischof von Reims) […] schaffen. Unser geringes Material wird Euer großes und gefeiertes Ingenium durch die Hinzuführung des Glases (Emails) und durch die Gestaltung eines geschmackvollen Künstlers veredeln.“ (zitiert nach Kahsnitz 1982, S. 85).
Neben Gold und Edelsteinen sollten also auch Emails („vitri“) als Schmuckauflagen verwandt werden, die offenbar als Spezialität der Trierer Werkstatt galten. Der Brief ist ein einzigartiger Beleg für die Kunstfertigkeit der Trierer Goldschmiede, die überregionalen Ruhm genossen. Gleichzeitig macht er auf die Rolle Egberts als Auftragsvermittler und Vorsteher der Werkstatt aufmerksam, die sehr wahrscheinlich in seinem unmittelbaren Umkreis aktiv war. Der genaue Sitz des Ateliers geht aus den Quellen jedoch nicht hervor.
15
Ursprünglich in den Buchdeckel eingeklebtes Vorsatzblatt mit Abdruck der Inschrift vom Innendeckel und unvollendeter Zeichnung eines „Thronenden Christus“ (seitenverkehrte Reproduktion).