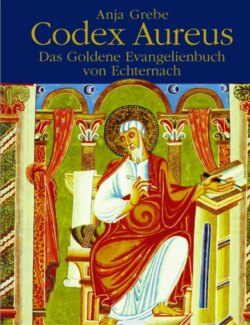Читать книгу Codex Aureus - Anja Grebe - Страница 12
Die Elfenbeintafel
ОглавлениеDie 20,5 mal 12,7 Zentimeter große Elfenbeintafel ist das Werk eines höchst originellen anonymen Bildschnitzers (Abb. 10). Sie zeichnet sich durch eine große Lebendigkeit und Detailfreude aus. Charakteristisch sind die bewegten Figuren mit überlangen Beinen und großen Gliedmaßen. In ihrer kunstvoll gedrehten Haltung scheinen die beiden auf der unteren Rahmenleiste stehenden Soldaten Longinus und Stephaton fast um das Kreuz zu tanzen und mit ihren ausladenden Bewegungen den Rahmen der Schnitzerei zu sprengen. Mit erstaunlichem, an der Spätantike geschultem Realismus hat der Künstler die Muskulatur wiedergegeben; fast vermeint man unter den locker sitzenden Gewändern den Körper in seinen Formen und Drehungen von Schulterblättern und Gesäßbacken spüren zu können. Mit ähnlichem Verismus ist auch die Muskulatur und Anatomie an den Beinen, Armen und dem Brustkorb des Gekreuzigten gestaltet.
8
Die Vorderseite des Prunkeinbands des „Codex Aureus“, Trier, sogenannte Goldschmiedewerkstatt Erzbischof Egberts, um 980/990.
9
Der Rückendeckel des „Codex Aureus“ ist mit kostbarer byzantinischer Seide bezogen und mit Metallbeschlägen verziert.
Auch die Gewanddarstellung zeichnet sich durch einen großen Realismus aus, wie die locker fallenden Tuniken der Soldaten mit ihrer gerafften Hüftpartie, das geknotete Lendentuch Christi und das vor das Haupt gehaltene Tuch der Luna zeigen. Akribisch hat der Schnitzer Kleidungsdetails wie die geschnürten Beinkleider und Schuhe des Longinus oder die Musterborten an Ärmel und Saum der beiden Tuniken und des Lendentuches Christi wiedergegeben. Beim Eimer des Stephaton meint man die Holzstruktur wahrnehmen zu können, auf dem Essigschwamm ist ein kleines Kreuz eingeritzt.
Hingegen wirken die Gesichter mit ihren übergroßen Mündern, Nasen und Ohren und den hervortretenden Stirnfalten überraschend grob. Dabei ist die expressive Mimik zumindest teilweise inhaltlich motiviert und unterstreicht die Handlung und die Charakterisierung der Figuren. So wendet sich Christus Longinus nicht einfach zu, vielmehr sind die beiden durch einen direkten Blickkontakt verknüpft, der als virtuelle Linie parallel zur Lanze verläuft. Der im Johannesevangelium erwähnte Soldat, der Christus als Beweis des vollbrachten Todes den Lanzenstich versetzt (Joh 19,34), wurde in der christlichen Überlieferung mit dem Zenturio gleichgesetzt, der nach Matthäus die Kreuzigung überwachte (Mt 27,54). Durch das aus der Seitenwunde hervorquellende Blut Christi wurde er von einer momentanen Blindheit geheilt und bekehrt. Unbekehrt blieb hingegen der links von Christus dargestellte Stephaton, der ihm kurz vor dem Tod den Essigschwamm reichte und hier entsprechend auf der negativ besetzten linken Seite steht.
Die Bildkunst hat die beiden Bibelepisoden von Longinus und Stephaton schon früh zu einer gemeinsamen Darstellung der beiden Soldaten unter dem Kreuz vereint. Dabei ist meist der Moment kurz vor dem Tode Christi dargestellt. Die Nürnberger Elfenbeintafel folgt dieser Tradition, erweitert sie jedoch um die Personifikationen von Sol (Sonne) und Luna (Mond), die als Sinnbilder von Tag und Nacht trauernd ihr Haupt verhüllen. Unter dem Kreuz beziehungsweise dem Suppedaneum kauert die Personifikation der Terra (Erde), die mit hängenden Brüsten schwer an ihrer Last trägt. Das Kreuz selbst entspricht der griechischen Form mit doppeltem Querbalken. Auf dem oberen Balken ist die von den seitlichen Medaillons überlagerte Inschrift „(I)HCNAZARENV(S)“ zu lesen.
10
Die Elfenbeintafel mit der Kreuzigung Christi vom Prunkdeckel des „Codex Aureus“.
Die expressiven Körperdrehungen der Figuren verbinden die Elfenbeintafel mit Werken eines Künstlers, der von Wilhelm Vöge als sogenannter „Deutscher Meister“ in die Kunstgeschichte eingeführt wurde (Vöge 1899). Zu seinem Œuvre gehören ein Diptychon mit der „Gesetzesübergabe an Moses“ und dem „Ungläubigen Thomas“ sowie eine „Majestas Domini“ (alle: Berlin, SMB, Skulpturensammlung), die mit ähnlichen, an Eichblattlaub erinnernden Blattwerkrahmen umgeben sind. Die charakteristischen, zugleich feingliedrigen wie derben Figuren finden sich jedoch nur auf der Nürnberger Tafel und lassen sich auf keiner zweiten Elfenbeinarbeit des späten 10. Jahrhunderts wiederfinden. Wann die Tafel farbig gefasst wurde, ist nicht bekannt. Die heute fragmentarisch erhaltene Bemalung muss nicht original ein. Möglicherweise war das Elfenbein einst vergoldet, zumindest sind an einigen Stellen kleine goldene Farbspuren sichtbar.
Nicht zu verkennen ist, dass zwischen Elfenbeinplatte und Goldschmiederahmen eine Lücke von mehreren Millimetern klafft. Dies gab zu der unter anderem von Frauke Steenbock geäußerten Hypothese Anlass, dass die Tafel nicht ursprünglich sei, sondern erst aus dem 11. Jahrhundert stamme, was die auffällige Stildifferenz zu den bekannten ottonischen Elfenbeinwerken erklären könne (Steenbock 1965, S. 120). Im Moment der Verbindung des Deckels mit dem „Codex Aureus“ sei die ursprüngliche Tafel, möglicherweise eine Darstellung der „Majestas Domini“, durch das jetzige Kreuzigungsrelief ersetzt worden.
Gegen diese Theorie spricht, dass viele mittelalterliche Prunkdeckel Passungenauigkeiten aufweisen. Die Theorie, dass der Spalt auf eine natürliche Schrumpfung der Elfenbeintafel infolge von Austrocknung zurückzuführen sei (Kahsnitz 1982, S. 150), lässt sich nicht belegen. Ein solcher Vorgang hätte vermutlich sichtbare Risse des auf dem Holzdeckel befestigten Reliefs hervorgerufen; die Nürnberger Tafel ist jedoch ohne diesbezügliche Schäden. Offenbar hat die mittelalterlichen Betrachter der Spalt nicht gestört. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Lücke von einer schmalen Leiste ausgefüllt war, doch haben sich hierfür keine Anhaltspunkte finden lassen. Kompositorisch macht die Kreuzigungsszene im Kontext des Bildprogramms am meisten Sinn. Formal sind Goldschmiederahmen und Kreuzigung durch die Fortführung des Kreuzstammes im vertikalen Edelstein-Email-Streifen verbunden. Die diagonalen Perlbänder lassen sich als Verlängerung der Lanze und des Essigstabes verstehen. Damit erweitert der Rahmen mit der crux gemmata die Kreuzigung im Zentrum in formaler, aber auch symbolischer Hinsicht.