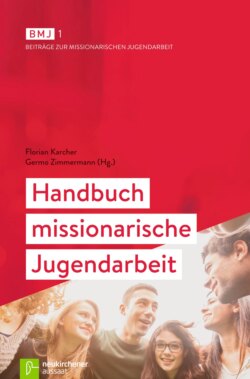Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 49
1. Die Anfänge christlicher Jugendarbeit im 19. und beginnenden 20. Jh. 1.1 Jugendmissionarisches Wollen
ОглавлениеDer Begriff „missionarische Jugendarbeit“ findet sich im 19. und beginnenden 20. Jh. noch nicht als feste Prägung. Doch kann im Blick auf die im 19. Jh. gegründeten Vereine und Verbände evangelischer Jugendarbeit durchweg von einem „missionarischen Wollen“ (Cordier 1925: 490) gesprochen werden. Denn „historisch gesehen haben so gut wie alle evangelischen Jugendverbände ihre Wurzeln in den Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegungen des vergangenen Jahrhunderts; dies gilt für den CVJM ebenso wie für den EC, aber auch für die Schülerbibelkreise [...] und das frühere Mädchenwerk“ (Affolderbach 1982: 279).
Zwar finden sich Ansätze evangelischer Jugendarbeit bereits seit der Reformation in kirchlichen Angeboten wie dem Konfirmations- und Katechismusunterricht und ebenso erhielt die Jugendarbeit Impulse aus dem Pietismus, z. B. durch für Jugendliche begründete Sozietäten, wie die von Pastor Meyenrock 1768 in Basel begründete, „die als erster offizieller Jünglingsverein in die Geschichte der kirchlichen Jugendarbeit eingegangen ist“ (Deresch 1984: 47 f.) und der Einübung in den christlichen Glauben diente. Doch liegen die Wurzeln heutiger evangelischer Jugendarbeit im 19. Jh. Denn Jugendarbeit wird ein Anliegen, wo das Jugendalter seit der zweiten Hälfte des 18. Jh. als eigenständige Lebensphase (Reifezeit) verstanden wird und zugleich die gesellschaftlichen Entwicklungen des 19. Jh. (Industrialisierung, Pauperismus) dazu nötigen, spezifische Angebote für junge Menschen, zunächst in den Städten, zu machen (vgl. Jürgensen 1980: 9–32). Träger dieser Jugendarbeit sind sozial engagierte Männer und Frauen, oft ohne theologische Ausbildung, die aus christlicher Motivation und mit christlicher Zielsetzung Angebote für junge Menschen entwickeln. So gehen seit den 1820er-Jahren aus der Erweckungsbewegung Vereine hervor, wie z. B. das sozialdiakonische Angebot von „Sonntagssälen“ oder die „Hilfsvereine für Jünglinge“ (ab 1834 in Bremen und Hamburg), aber auch die stärker missionarisch akzentuierten „Missions-Jünglingsvereine“ und entsprechende „Jungfrauen-Vereine“. Im Blick auf die Zielgruppe Jugend wurden in den Vereinen soziale, gesellige und das Evangelium verkündigende Angebote gemacht. Evangelische Jugendarbeit hat damit eine doppelte (nicht zwei unterschiedliche) Wurzel in einer stärker sozialarbeiterisch und einer stärker religiös geprägten Form der Jugendarbeit, die sich durch ihre aus der Erweckungsbewegung kommenden Träger aber immer als Einladung zum christlichen Glauben versteht. Damit kann evangelische Jugendarbeit im 19. Jh. als missionarisch bezeichnet werden.
Mit dem Zusammenschluss von Vereinen kommt es in der zweiten Hälfte des 19. Jh. zur Bildung von zwei großen Jugendverbänden, die Teil einer europäisch-nordamerikanischen Bewegung, überkonfessionell und mit Kißkalt (2014: 417) „ausdrücklich missionarisch“ orientiert sind: der ab 1882 aus den deutschen Missions-Jünglingsvereinen und Hilfsvereinen für Jünglinge hervorgehende Nationalverband der Jünglingsvereine (heute: CVJM-Gesamtverband e.V.), der ein Teil der weltweiten YMCA-Bewegung wird, und der Jugendbund für entschiedenes Christentum (EC, ab 1894), der aus der nordamerikanischen Christian-Endeavour-Society (1888) erwächst. Deren Satzung bzw. Selbstverpflichtung betont den missionarischen Auftrag. Die Jünglingsvereine übernehmen mit der „Pariser Basis“ (1855) des Weltverbands der YMCA das Ziel, „solche jungen Männer untereinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland erkennen, im Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter den jungen Männern auszubreiten“ (Roll 2008). Im EC gilt das Bekenntnis: „Jesus Christus ist der Heiland der Welt. Seinem Ruf zur Umkehr und zum Glauben will ich folgen und es lernen, zur Ehre Jesu zu leben. Ich will jeden Tag Gottes Wort lesen und beten und treu an den Veranstaltungen des Jugendbundes teilnehmen“.18 Die missionarische Ausrichtung teilen auch die Schülerarbeit („Bibelkränzchen an höheren Schulen“ (BK)) und Studentenarbeit (Deutsche Christliche Studentenvereinigung). Auch der erst 1919 erfolgte Zusammenschluss zum „Bund der Deutschen Mädchen-Bibel-Kreise“ (seit 1971: Arbeitsgemeinschaft MBK. Missionarisch-biblische Dienste unter Jugendlichen und Berufstätigen e.V.) hat das dezidiert missionarische Anliegen, „das Evangelium von Jesus Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn zu bezeugen, damit sie zur lebendigen Gemeinschaft mit ihm kommen und durch ihn Vergebung der Sünde und die Gabe eines neuen Lebens im Glauben empfangen“ (Böhnisch/Gängler/Rauschenbach 1991: 874 f.).
Die Zielformulierungen dieser Jugendverbände und Werke teilen das für die Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegung des 19. Jh. charakteristische Missionsverständnis (vgl. die Basis der Evangelischen Allianz, 1846). Grundlage ist das persönliche Bekenntnis zu Jesus Christus als Retter, aus dem heraus eine christus- und schriftzentrierte Frömmigkeit gelebt wird. Zu dieser gehört sowohl der Gemeinschaftscharakter (gemeinsames Einüben und Wachsen im Glauben in der Gemeinschaft der Christen) als auch das Weitergeben des Glaubens, wozu selbstverständlich auch die Wortverkündigung gehört. Dieses Missionsverständnis verbinden die Jugendverbände mit einer zielgruppenspezifischen Arbeit (Handwerksgesellen, Studenten, Schüler), die auch soziale Unterstützung, Bildungsarbeit und Angebote zur Freizeitgestaltung beinhaltet, was aber in den Dokumenten, in denen Bekenntnisgrundlage und Ziele der Arbeit bestimmt werden, nicht ausgeführt wird. Dabei war die Praxis der missionarischen Arbeit mit Jugendlichen prinzipiell offen in Methoden und Formen und konnte z. B. von den Jugendbewegungen zu Beginn des 20. Jh. (Wandervögel, Pfadfinder) Arbeitsformen übernehmen. Zugleich gab das formulierte theologische Ziel eine intensive Beschäftigung mit der Bibel und mit Fragen des christlichen Glaubens vor und konnten unter Umständen die sozial-geselligen Aktivitäten einer Gruppe in die Rolle der Vorarbeit und „uneigentlichen“ Arbeit gegenüber der zentralen Verkündigung des Evangeliums gedrängt werden.
Die Werke verstehen missionarische Arbeit mit jungen Menschen als Bezeugen des Evangeliums Jesu Christi in Wort und Tat. In der Praxis der Arbeit der Jugendverbände, wie z. B. in den Jünglingsvereinen/CVJM, wurden soziale und religiöse Arbeit zusammengedacht, und in ihren Anfängen ist christliche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit nicht voneinander zu trennen. Doch betonen die Basis-Dokumente die persönliche Glaubensentscheidung und, davon ausgehend, das Weitersagen von diesem Glauben, während das soziale Handeln als Teil eines ganzheitlichen Missionsverständnisses wohl mitgedacht, aber nicht explizit formuliert wird.
Der Blick in die Entstehung evangelischer Jugendarbeit im 19. Jh. und erste Entwicklungen im 20. Jh. zeigt für den Begriff „missionarische Jugendarbeit“: Die exakte begriffliche Formulierung findet sich in den Anfängen evangelischer Jugendarbeit im 19. Jh. nicht. Jugendmissionarisches Handeln aber ist Ziel und Inhalt der aus der Erweckungsbewegung hervorgegangenen Jugendverbände (z. B. EC, CVJM), die in ihren Gründungsdokumenten dieses theologische Ziel formulieren und für deren Missionsverständnis die persönliche Beziehung zu Jesus Christus als Retter entscheidend ist. Damit sind diese Jugendverbände traditionelle Träger jugendmissionarischer Arbeit.