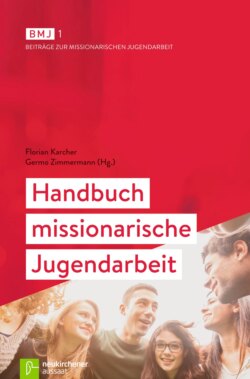Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 51
2. Missionarische Jugendarbeit zwischen 1945 und 1980 2.1 Evangelische Jugendarbeit bis in die 1960er-Jahre
ОглавлениеDie Jugendarbeit von Kirchen und Verbänden erfährt durch Nationalsozialismus, Kirchenkampf und Zweiten Weltkrieg Einschränkungen und Veränderungen. Das erzwungene „Abkommen über die Eingliederung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend“ vom 19. Dezember 1933 führt zur Auflösung der evangelischen Jugendverbände und durch das Verbot geselliger und sportlicher Angebote außerhalb der Hitlerjugend zur Beschränkung der evangelischen Jugendarbeit auf die Beschäftigung mit der Bibel (Bibelarbeit) und zu einer stärkeren Anbindung an die Gemeinde vor Ort.
Nach 1945 nehmen einerseits die Jugendverbände die Arbeit wieder auf, andererseits besteht die gemeindliche Jugendarbeit weiter. Daneben entstehen in Reaktion auf die sozialen Nöte der Nachkriegszeit sozialarbeiterische Formen christlicher Jugendarbeit, wie z. B. das Christliche Jugenddorfwerk (CJD). Dies führt nach 1945 zu einer Vielfalt der Träger evangelischer Jugendarbeit. Ende 1949 schließen sich die Träger landeskirchlicher, freikirchlicher und verbandlicher evangelischer Jugendarbeit in der „Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend Deutschlands“ (AGEJD, ab 1971: aej) zusammen, deren Satzung das Ziel formuliert: „Die aej als Teil der Gemeinde Jesu Christi bekennt Jesus Christus als das eine Wort Gottes an alle Menschen. Sie verkündigt Christus durch Wort und Tat [...]“ (Böhnisch/Gängler/Rauschenbach 1991: 864).
Sowohl die evangelische Jugendarbeit der Kirchen als auch der Jugendverbände ist bis Anfang der 1960er-Jahre geprägt von einer Arbeit in festen Gruppen mit regelmäßiger Bibelarbeit. „Die regelmäßige Bibelarbeit galt mindestens bis Ende der fünfziger Jahre als das Kennzeichen evangelischer Jugendarbeit“ (Affolderbach 1981: 27 f.) und damit als Ausdruck des missionarischen Auftrags. „Die intensive Beschäftigung mit dem Text bedeutete persönliche Glaubensorientierung und eine gemeinschaftliche Verbindlichkeit zugleich“ (Schmucker 1994: 42).
Anfang der 1960er-Jahre kommt es vor dem Hintergrund abnehmender Teilnehmerzahlen in den Gruppen-Angeboten evangelischer Jugendarbeit, der Diskussion um gesellschaftliche Öffnung der Jugendarbeit und parallel zu den theologischen Auseinandersetzungen um die historisch-kritische Exegese zur Kritik an der Bibelarbeit als Zentrum evangelischer Jugendarbeit, sowohl durch Mitarbeiter als auch durch die jugendlichen Teilnehmer selbst. „Die Selbstbeschränkung der christlichen Gemeinde auf ihre Mitte war im Dritten Reich erzwungen und nach dem Kriege als Vermächtnis bewahrt worden. In der Konzentration auf die Mitte hatten sich die pietistische und neupietistische Gemeindefrömmigkeit und die theologische Schultradition der Dialektischen Theologie zusammengefunden. Dieser Konnex wurde nun mehr und mehr in Frage gestellt“ (Affolderbach 1981: 43).
Damit beginnt eine Diskussion, in der unterschiedliche Konzeptionen evangelischer Jugendarbeit sichtbar werden. Sie ist vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Bemühungen um eine Theorie der Jugendarbeit (vgl. Müller et al. 1964) zu sehen und führt auf der Ebene des Dachverbands, der AGEJD, zu einem Grundsatzgespräch im Mai 1964, zwischen 1963 und 1969 zu einer „schleichenden Polarisierung“ (Affolderbach 1982: 308) und in den Jahren 1970 bis 1974 zur sog. Polarisierungsdebatte innerhalb der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Jugend (vgl. Affolderbach 1981: 51–57; Affolderbach 1982: 121–179; Affolderbach/Scheunpflug 2003: 119–125). Hier findet sich der Begriff „missionarische Jugendarbeit“ als Bezeichnung für eine Konzeption evangelischer Jugendarbeit.