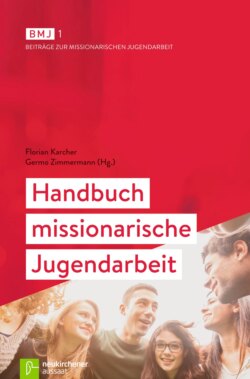Читать книгу Handbuch missionarische Jugendarbeit - Группа авторов - Страница 52
2.2 Der Begriff taucht auf: Die Polarisierungsdebatte der 1970er-Jahre Missionarische Jugendarbeit als Konzeptionsbegriff
ОглавлениеZur Frage „Was ist Jugendarbeit?“ legen vier junge Pädagogen 1964 Versuche zu einer Theorie der Jugendarbeit vor (vgl. Müller et al. 1964), in der insbesondere eine These C. Müllers in der evangelischen Jugendarbeit rezipiert wird, dass im Zentrum moderner Jugendarbeit nur „die an dieser Jugendarbeit teilnehmenden jungen Leute selbst“ (Müller et al. 1964: 19) stehen können. Aus der Frage heraus, wie moderne Jugendarbeit gestaltet werden soll, gibt die AGEJD eine empirische Studie evangelischer Jugendarbeit in der BRD in Auftrag. Mollenhauer (1969) kommt in seiner (Vor-)Studie zu einer kritischen Sicht der von ihm untersuchten Praxis evangelischer Jugendarbeit, da sie u. a. nicht an den Bedürfnissen der Jugend orientiert sei (vgl. Mollenhauer et al. 1969: 50) und nicht der Förderung der Mündigkeit der Jugendlichen diene. Dabei kritisiert die Studie insbesondere die Jugendarbeit mit dem Ziel der Verkündigung und Mission. Deren Zielformulierungen, so Mollenhauer, „bleiben in den meisten Fällen gebunden an einen geschichtslos begriffenen Auftrag christlicher Mission und Verkündigung, ohne sich konkret auf die gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse zu beziehen“ (Mollenhauer et al. 1969: 69).
Mollenhauers abschließende Hypothesen zur evangelischen Jugendarbeit sind pointiert formuliert und lösen heftige Diskussionen aus, insbesondere die These, dass die derzeitige evangelische Jugendarbeit kaum emanzipatorische Impulse gebe (Mollenhauer et al. 1969: 230), und die These: „Die theologischen Begründungen evangelischer Jugendarbeit sind Ausdruck bzw. nachträgliche Rechtfertigung pädagogischer Handlungsmuster bzw. des Sozialisationsmodus im ganzen“ (Mollenhauer et al. 1969: 238).
Mollenhauers Studie führt einerseits zur wissenschaftlichen Diskussion und Weiterführung seiner Thesen (Bäumler 1970; Giesecke 1971) sowie zu Versuchen einer theologischen Begründung evangelischer Jugendarbeit (Leschonski 1974; Affolderbach 1977; Deresch 1984). Andererseits führen seine Thesen auch zu einer Kontroverse, in der sich innerhalb der AGEJD v. a. die Vertreter der Jugendverbände und die der gemeindlichen Jugendarbeit gegenüberstehen. Denn die empirische Studie Mollenhauers zeigte, dass es zwei unterschiedliche Konzeptionen evangelischer Jugendarbeit gab, die in den nächsten Jahren als „emanzipatorische“ versus „missionarische/evangelistische“ Jugendarbeit bezeichnet werden.
Der Generalsekretär der AGEJD, Klaus Lubkoll, spricht diese beiden Konzeptionen in einem Vortrag vor der Oldenburger Synode am 1. Juni 1970 offen an: „Die Spannung zwischen einer stärker missionarischen und einer stärker diakonischen evangelischen Jugendarbeit, ich könnte auch sagen: zwischen den Konzepten pietistischer Gruppen und den Zielvorstellungen der ‚Offenen Arbeit‘ stellte noch vor zehn Jahren die entscheidende Alternative dar“ (Foitzik 2003: 73 f.).
Die Spannungen, die Lubkoll rückblickend konstatiert, führen auf der Mitgliederversammlung der AGEJD im November 1970 zur offenen Auseinandersetzung, als eine Thesenreihe („Thesen zur Zielsetzung evangelischer Jugendarbeit und zu deren Umsetzung in pädagogisches Handeln“; Affolderbach 1982: 123–129) von Heinrich-Constantin Rohrbach, Direktor des Burckhardthauses, das Konzept einer emanzipatorischen evangelischen Jugendarbeit formuliert. Die These „Der evangelische Charakter einer Jugendarbeit ist also nicht primär zu erkennen an einem spezifisch kirchlichen, religiösen oder biblischen Inhalt, sondern an dem Bemühen, in einer konkreten Situation Agape zu praktizieren“ (Affolderbach 1982: 127), wird von den Vertretern der Verbände (CVJM, EC, MBK) und Freikirchen abgelehnt und mit Gegenthesen beantwortet.
Im Widerspruch zu Rohrbach betont Wolfhart Schlichting als Stellvertreter für den CVJM-Gesamtverband in der Mitgliederversammlung der aej im März 1971: „In diesem Sinn ist es das Hauptziel evangelischer Jugendarbeit, junge Menschen mit Jesus bekanntzumachen“ (Affolderbach 1982: 136). Die Arbeitsgemeinschaft MBK ergänzt: „Im Sinne der Reformation [...] sehen wir in der verbalen Verkündigung [...] das für die Jugendarbeit Konstitutive“ (Affolderbach 1982: 138). Schließlich formuliert eine gemeinsame Stellungnahme von CVJM, MBK und EC, der sich die Vertreter der freikirchlichen Jugendarbeit anschließen: „Das primäre Ziel evangelischer Jugendarbeit besteht darin, jungen Menschen zum Anschluß an die Person Jesu Mut zu machen. Aus der Verbindung mit ihm erwachsen Konsequenzen in Form missionarischer, diakonischer und gesellschaftspolitischer Aktivitäten“ (Affolderbach 1982: 145). Die Vertreter der Jugendverbände und Freikirchen halten explizit fest an der missionarischen Zielsetzung und theologischen Begründung ihrer Jugendarbeit.
Damit stehen sich innerhalb der evangelischen Jugendarbeit zwei Konzeptionen gegenüber, die beide für sich beanspruchen, im eigentlichen Sinne evangelische Jugendarbeit zu sein: Die von den Verbänden und Freikirchen vertretene „traditionelle“ Konzeption evangelischer Jugendarbeit hat das Ziel, junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen und sie im Leben im christlichen Glauben (Nachfolge, christliche Gemeinschaft, Bibellese) zu fördern. Dazu gehört auch „Hilfe zur Bewältigung des Lebens. Möglichkeit zu Spiel und Unterhaltung“ (Leschonski 1974: 1 f.). Der christliche Glaube ist sowohl Motivation als auch Inhalt und Ziel der Jugendarbeit. Die zweite, stärker in der gemeindlichen Jugendarbeit der Landeskirchen vertretene Konzeption verfolgt das Ziel, aus christlicher Nächstenliebe heraus „mit Jugendlichen soziales Verhalten ein[zu]üben“ (Affolderbach 1981: 52), und das Ziel der „Förderung der Emanzipation gegenüber Herrschaftsansprüchen“ und wird daher auch als emanzipatorische Jugendarbeit bezeichnet. Die AGEJD/aej strengt ab 1971 einen Klärungsprozess im Blick auf die unterschiedlichen Konzeptionen an. Dabei sind die Begriffe für die jeweiligen Konzeptionen noch nicht fest. Doch wird „missionarische Jugendarbeit“ in der Kontroverse ab 1971 zu einem Begriff für eine Konzeption evangelischer Jugendarbeit und damit auch zu einem Begriff, der positiv oder negativ konnotiert ist.