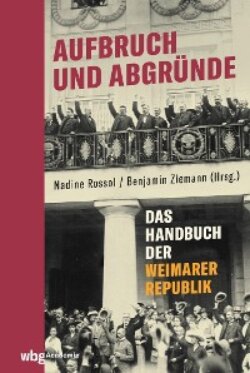Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 51
2. Die Geografie des deutschen Nationalismus
ОглавлениеZwar entwickelten die verschiedenen politischen Lager der Weimarer Republik konkurrierende Antworten auf die Frage nach der besten Staatsform für das deutsche Volk, sie waren sich jedoch einig darin, dass die deutsche Nation nicht an den Grenzen des Deutschen Reiches endete. Dieser Glaube war einerseits den Millionen deutschsprachiger Menschen geschuldet, die im 19. Jahrhundert nach Übersee ausgewandert waren, den sogenannten „Auslandsdeutschen“. Dazu kamen deutsche Staatsbürger, die als Minderheiten in den nach dem Ersten Weltkrieg neu gegründeten Staaten in Mittelosteuropa lebten. Zu diesen „Grenzlanddeutschen“ gehörten die Bewohner der Territorien, die Deutschland durch den Versailler Vertrag verloren hatte, sowie ehemalige Bürger der Habsburgermonarchie oder des russischen Zarenreiches. Vor diesem Hintergrund waren sich Gegner und Anhänger der Weimarer Republik darin einig, dass Volkszugehörigkeit wichtiger sei als Staatsangehörigkeit.36 Doch damit waren die Übereinstimmungen dann auch schon zu Ende. Entsprechend ihrer politischen Ziele hatten Antirepublikaner und Republikaner völlig unterschiedliche Vorstellungen darüber, wo und wie die Grenzen Deutschlands neu gezogen werden sollten.
In den Augen der politischen Rechten war es der Republik nicht gelungen, die territoriale Integrität Deutschlands zu verteidigen, was zur Schwächung und Verwundbarkeit des Landes geführt habe. Zu Unrecht gaben Konservative und Rechtsextreme der Republik die Schuld am Versailler Vertrag, demzufolge Elsass-Lothringen wieder zurück an Frankreich und Eupen und Malmünd (Malmedy) an Belgien gefallen war, Posen und ein großer Teil Westpreußens nun zu Polen gehörten, der Völkerbund die überwiegend deutschsprachige Stadt Danzig kontrollierte und die deutschen Überseekolonien verloren waren. Darüber hinaus sah der Friedensvertrag verschiedene Volksabstimmungen vor: Anfang 1920 in Schleswig (wonach einige Gebiete dann zu Dänemark kamen), im Sommer 1920 über zwei Gebiete in Ost- und Westpreußen (von denen die meisten an Deutschland fielen) und 1921 in Oberschlesien (das trotz eines Mehrheitsvotums für eine Wiedervereinigung mit Deutschland zwischen Polen und dem Deutschen Reich geteilt wurde).37
In ihrem Protest gegen diese Grenzen griffen Konservative und Rechtsradikale auf völkische, antirepublikanische und militaristische Formen des deutschen Nationalismus zurück. Sie stellten sich hinter nationalistische Vereinigungen, die es sich auf ihre Fahnen geschrieben hatten, die Deutschen außerhalb der neuen Grenzen des Reiches zu verteidigen, angefangen mit dem extremistischen Alldeutschen Verband bis hin zu dem etwas moderateren Verein für das Deutschtum im Ausland.38 In ihrer Propaganda setzten sie die Gebietsverluste mit den abgetrennten Gliedmaßen eines lebendigen Körpers gleich: Die durch den Versailler Vertrag geschaffenen „blutenden Grenzen“ gefährdeten die Volksgemeinschaft, die hier ganz wörtlich als ein nationaler Körper aufgefasst wurde.39 Der Unmut der politischen Rechten nahm mit der auf 15 Jahre festgelegten Besetzung des linken Rheinufers durch die Alliierten und der Übertragung des Saargebiets als Mandat an den Völkerbund für ebenfalls 15 Jahre (was Frankreich den Zugang zu den saarländischen Bergwerken verschaffte) noch erheblich zu. Die Ruhrbesetzung durch französische und belgische Truppen von 1923 bis 1925, als Antwort auf verpasste Reparationszahlungen des Deutschen Reiches, machte die Empörung nur noch größer. Obwohl es sich hier nicht um permanente Gebietsverluste für Deutschland handelte, stellten diese Besetzungen in den Augen der Konservativen und Rechtsradikalen dennoch eine Gefahr für die deutsche Nation dar.
Für die politische Rechte bedrohten diese Besetzungen und territorialen Veränderungen die „Heimat“. Dieser Begriff hatte seit der Reichsgründung von 1871 im politischen Leben Deutschlands an Bedeutung gewonnen. Denn er erlaubte es den Bewohnern der verschiedenen Regionen Deutschlands, ihre patriotischen Gefühle gegenüber ihrer jeweils lokalen Heimat auch auf eine Liebe für ein vereintes deutsches Vaterland zu übertragen. In den Weimarer Jahren benutzten sowohl Republikaner als auch die politische Rechte die Idee der Heimat zur Untermauerung und Stärkung ihrer widerstreitenden politischen Agenden. Republikaner sprachen von ihrer Liebe zur Heimat, um staatsbürgerliche und demokratische Ideen zu kultivieren. Doch letztlich war es die politische Rechte, die das Thema Heimat besetzen konnte, vor allem während der Weltwirtschaftskrise. Die Betonung der Heimat unterstrich die Notwendigkeit einer starken Stellung der Einzelstaaten gegenüber dem Reich als Gegengewicht gegen die republikanische Kontrolle über konservativ regierte Kommunen, Provinzen und Länder. Konservative und Rechtsradikale verstanden Heimat darüber hinaus als eine völkische Entität und betonten den Zusammenhang zwischen Blut und Boden: Jede Gefährdung der Heimat durch innere oder äußere Feinde war gleichzeitig eine Bedrohung für das Heil des Volkes. Darüber hinaus wurden die besetzten Gebiete für die Nazis zu einer „Schule der politischen Gewalt“. Sie behaupteten, als Einzige die Heimat verteidigen zu können, da die amtierende Regierung dazu erwiesenermaßen nicht in der Lage sei.40
Der bedrohlichste Aspekt der Besatzung war, den Rechten zufolge, der Einsatz von französischen Kolonialtruppen. Rassismus und die Idee einer Überlegenheit der Weißen waren zentrale Elemente konservativer und rechter Politikvorstellungen. Konsequenterweise inszenierte die politische Rechte eine rassistische Propagandakampagne, die die Kolonialtruppen als „den schwarzen Schrecken am Rhein“ und eine „schwarze Pest“ verunglimpfte und sie fälschlicherweise der Vergewaltigung deutscher Frauen bezichtigte. Kinder von deutschen Frauen und Soldaten der Kolonialtruppen nannten sie „Rheinlandbastarde“. Mit einer hasserfüllten und entmenschlichenden Sprache betonten Konservative und Rechtsradikale die weiße Hautfarbe als wesentliches Element des Deutschtums. Sie prangerten eine potenzielle „Rassemischung“ an, die zu Degeneration und daraus resultierend zum Niedergang der vermeintlichen germanischen Rasse führe. Hier bediente sich die politische Rechte der sozialdarwinistischen Theorie des 19. Jahrhunderts, nach der man Menschen in „Rassen“ unterteilen könne, wobei die „weiße Rasse“ den anderen „Rassen“ überlegen sei und diese „Rassen“ sich in einem Kampf auf Leben und Tod befänden, der darüber entscheide, welche von ihnen erblühen und welche dahinsiechen werde.41 Obwohl dieses Konzept jeder Grundlage entbehrte und völlig falsch war, diente es dem Deutschen Notbund gegen die Schwarze Schmach und ähnlichen Gruppierungen als Vorlage für die Warnung, „dass unsere Bevölkerung mit gemischtrassigem Nachwuchs durchtränkt wird, was heißt, dass sie […] für kommende Generationen weniger wertvoll sein wird“.42 Die Sorge um Deutschlands Grenzen war damit für die politische Rechte eng verknüpft mit völkischen Konzeptionen von Deutschtum und eugenischen Überlegungen zur Rassenhygiene.
Die Rolle, die der Antisemitismus in der Propaganda der politischen Rechten spielte, zeigt einmal mehr die Bedeutung des Rassedenkens in den Diskussionen um die deutschen Grenzen. Die extreme Rechte gab den Juden die Schuld für die „schwarze Schmach am Rhein“.43 Sie verdammte auch lautstark die nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte Einwanderung von Juden aus Osteuropa. Auf Kundgebungen und in Veröffentlichungen der frühen Weimarer Jahre brachte sie antisemitische Verschwörungstheorien in Umlauf, denen zufolge Juden „Kriegsgewinnler“ seien, die sich auf Kosten von hungernden Deutschen bereichert und den Bolschewismus in Deutschland verbreitet hätten.44 Die Republik habe dieser Auffassung zufolge Deutschlands Grenzen und die Nation nicht verteidigen können. In dieser Situation habe, so die Historikerin Annemarie Sammartino, eine „Krise der Souveränität“ geherrscht, welche die politische Rechte zur Unterminierung der Legitimität der Weimarer Republik benutzte.45
Konservative und rechtsradikale Frauen spielten in diesen nationalistischen Kampagnen eine entscheidende Rolle. Mit fadenscheinigen Behauptungen stilisierten sie sich gleichzeitig als Opfer der lüsternen „rassisch Anderen“ und als Hauptakteure in der Reproduktion und Erziehung der „deutschen Rasse“. Zur Stärkung dieser Argumente machten sie „Wallfahrten zu den blutenden Grenzen“ im Osten, schlossen sich radikal-nationalistischen Organisationen an und schufen Frauenvereine, die sich diesen Zielen verschrieben. Indem sie sich zu den Hüterinnen der „Rassereinheit“ des deutschen Volkes erklärten, konnten sie für sich eine wichtige Rolle im nationalen Leben beanspruchen und gleichzeitig eine antifeministische Agenda vertreten, nach der sich Frauen in erster Linie um ihre Ehemänner, Kinder und den Haushalt zu kümmern hatten.46
Die Verteidigung von Deutschlands existierenden Grenzen und die Rückgabe der „verlorenen Gebiete“ ging vielen Rechten nicht weit genug. So verspottete Hitler die Idee der Wiedereinsetzung von Deutschlands Vorkriegsgrenzen, da diese nicht alle „Menschen deutscher Nationalität“ in Europa mit einbeziehe.47 Doch seine Forderungen gingen weit über eine Vereinigung aller Deutschen in einem Gesamtstaat hinaus. Die Nationalsozialisten und selbst der Stahlhelm beharrten auf einer Expansion nach Osteuropa, um der deutschen Nation neuen Lebensraum zu verschaffen. Sozialdarwinistischem Denken zufolge war dieser Lebensraum eine Notwendigkeit, denn er sollte der „deutschen Rasse“ Land und Ressourcen zur Verfügung stellen, um zu erblühen und den angeblichen „Rassenkampf“ für sich zu entscheiden.48 Hitler war schon Mitte der 1920er Jahre vom Prinzip des Lebensraums fest überzeugt und glaubte, dass nur die Kolonialisierung Osteuropas „Deutschland für immer von der Gefahr befreit, auf dieser Erde zu vergehen“.49 Die politische Rechte entwickelte daher aggressive und rassistische Nationalismen, die weit über die Forderung nach Deutschlands Recht auf nationale Selbstbestimmung oder die Wiederherstellung der Grenzen des Kaiserreiches hinausgingen.
Konservative und Rechtsradikale sahen als einzige Möglichkeit zur Erreichung dieser revisionistischen Zielvorstellungen und zur Wiederherstellung von Deutschlands Stärke eine Umkehrung der gesamten Nachkriegsordnung, also des Weimarer „Systems“, des Versailler Vertrags und des Völkerbunds. Konsequenterweise lehnten sie Stresemanns „Erfüllungspolitik“ ab, die eine Einigung mit den Westmächten einschloss, um die Reparationszahlungen zu revidieren, Deutschland den Beitritt zum Völkerbund zu ermöglichen und die Besetzung des Rheinlands früher zu beenden. Sie sahen in diesen Plänen eine „Versklavung“ des deutschen Volkes durch fremde Mächte.50 Anstatt einer Republik wollten sie eine starke Führung und die Wiederherstellung von Deutschlands militärischer Stärke. Hugo Stinnes, ein Unternehmer der Schwerindustrie, Vertreter des rechten DNVP-Flügels und Gegner der Stresemann’schen Außenpolitik, war überzeugt: „Nur ein Krieg kann uns aus dieser Situation herausführen“.51 Die Nationalismen der politischen Rechten basierten also auf Sozialdarwinismus, Rassismus, Antisemitismus, Militarismus, einer aggressiven Expansionspolitik und der Feindseligkeit gegenüber der Republik.
Doch konservative und rechtsradikale Propaganda und ihre Rede von einem vereinten, reinrassigen deutschen Volk über die Grenzen des Reiches hinaus übersah die in Osteuropa herrschenden Realitäten. Im Gegensatz zur Rhetorik der Rechten war die deutsche Minderheit in Polen keineswegs monolithisch. Ihre Mitglieder hatten vor dem Krieg zu drei verschiedenen Reichen gehört: Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland. Reichsbeamte und nationalistische Vereinigungen behandelten diese deutschen Bevölkerungsgruppen in Polen unterschiedlich. Die ihnen angebotene Unterstützung differierte, je nachdem ob es sich um frühere Staatsbürger des deutschen Reiches handelte oder nicht. Es gab außerdem miteinander konkurrierende deutsche Organisationen in Polen, was kaum einer nationalen Einheit entsprach.52 Dazu kam, dass weiterhin eine „nationale Gleichgültigkeit“ in dem Gebiet vorherrschte, auch wenn diese durch den Zusammenbruch der europäischen Vielvölkerstaaten nach dem Ersten Weltkrieg stark abgenommen hatte. Vor dem Hintergrund, dass Nationalität und Volkszugehörigkeit soziale Konstrukte und keine biologischen Tatsachen sind, konnten Menschen in der Tschechoslowakei und anderen Regionen sich, je nach wirtschaftlichen und sozialen Erfordernissen, mal als Deutsche, mal als Tschechen bezeichnen.53 Diese Konkurrenzkämpfe und Schwierigkeiten, die eine genaue Bestimmung von Deutschen in Mittelosteuropa erschwerten, machen einmal mehr die Unhaltbarkeit der auf rassischen Ideologien basierenden Expansionsvisionen der politischen Rechten deutlich.
Wie die politische Rechte wollten auch die Anhänger der Demokratie die Grenzen Deutschlands ausdehnen. Doch ebenso wie ihr Nationalismus sah auch der von ihnen vertretene Gebietsrevisionismus völlig anders aus. In Einklang mit dem von ihnen vertretenen großdeutschen Nationalismus stand der Anschluss Österreichs im Mittelpunkt ihrer Revisionsvorstellungen, ja sie standen sogar während der Weimarer Republik an der Front der Anschlussbewegung.54 Republikaner investierten Zeit und Energie in diese Sache und besetzten hohe Positionen im Österreichisch-Deutschen Volksbund, der profiliertesten Organisation auf diesem Gebiet.55 Außerdem wandten sie sich gegen die Besetzung des Rheinlands, der Ruhr und der Saar sowie gegen die Zuerkennung Südtirols an Italien und die Teilung Oberschlesiens: Themen also, die ihrer Meinung nach in ihr demokratisch-nationales Rahmenkonzept passten. Das Verbot des Anschlusses sahen sie als einen Verstoß gegen das Recht der Österreicher auf Selbstbestimmung, die Besatzung als Beispiel für Frankreichs Imperialismus, den Rechtsmissbrauch gegen Deutsche in Südtirol als ein Verbrechen des italienischen Faschismus und die Teilung Oberschlesiens als eine Nichteinhaltung des Volksabstimmungsergebnisses.
Durch das Vorantreiben dieser territorialen Zielvorstellungen bestimmten die Anhänger der Weimarer Republik ihre Forderungen näher. Im Mittelpunkt ihrer Revisionspläne stand der Anschluss. Damit unterstrichen sie, dass die Ausdehnung der Grenzen Deutschlands keineswegs seine Nachbarländer bedrohe, da die mehrheitlich deutschsprachigen Österreicher eine Union mit Deutschland befürworteten. Zeitgenössischen Schätzungen zufolge waren etwa 90 bis 95 Prozent aller Österreicher für den Anschluss.56 Die Vereinigung der beiden Länder sei daher nichts weiter als eine Sache der Selbstbestimmung einer Bevölkerung, die sich überwiegend als deutsch verstand. Obwohl der Anschluss auch die Ausdehnung der deutschen Grenzen nach Osten hin beinhaltete, lehnten die Republikaner eine Kolonialisierung Osteuropas ab. Sie zeigten sich zwar besorgt um die dort lebenden deutschen Minderheiten, doch stellten sie klar, dass sie diese Gebiete auf keinen Fall annektieren wollten. Wilhelm Nowack, ein führender Funktionär des Reichsbanners und DDP-Mitglied, erklärte: Dass „die großdeutsche Idee mit den alldeutschen Phantastereien nichts gemein hat, ist selbstverständlich“, da diese „die Unterdrückung und Unterjochung fremdländischer Völker“ bedeute.57 Anders als die politische Rechte waren die Republikaner nicht darauf aus, die territoriale Souveränität der Nachbarstaaten zu gefährden.58
Darüber hinaus machten die Anhänger der Republik klar, dass sie den Anschluss nur mit friedlichen Mitteln zu verfolgen gedachten und ein österreichisch-deutscher Zusammenschluss den Frieden in Europa stärke. Sie befürworteten die internationale Nachkriegsordnung und wollten demgemäß den Anschluss durch die Intervention des Völkerbundes erreichen. Technisch gesehen erlaubten die Friedensverträge eine deutsch-österreichische Union mit Billigung des Völkerbundrates.59 Eine Reihe von Republikanern vertrat außerdem die Idee, dass die Bildung eines größeren Staates auf dem Kontinent durch den Anschluss der Grundstein für die „Vereinigten Staaten Europas“ sein könnte.60 Solche Auffassungen waren nicht zuletzt die Folge des Engagements einiger deutscher Republikaner in gesamteuropäischen Organisationen.61
In ihrem Plädoyer für einen Anschluss unterstrichen die Republikaner die besonderen politischen Grundlagen ihres großdeutschen Konzepts. Der Vorsitzende des Republikanischen Studentenkartells und Mitbegründer des Reichsbanners, Walter Kolb, erklärte auf einer republikanischen Kundgebung 1926 in Wien:
[D]as Großdeutschland der Hakenkreuzler wird nie und nimmermehr unser Großdeutschland sein. Wer ein Deutschland will, das sich als eine Gefahr für den Weltfrieden erweisen soll, dem sagen wir den schärfsten Kampf an; wer aber mit uns die großdeutsche, freie und soziale Republik erobern will, der sei uns als Kämpfer willkommen. 62
Ähnlich strebte auch Joseph Wirth, Zentrumsmitglied und Reichskanzler von 1921 bis 1922, die Schaffung eines „großen deutschen Staates der sozialen Gerechtigkeit, des Völkerfriedens und des deutschen Glückes“ an, der von Köln bis Wien reichte.63 Die Republikaner sahen in der Vereinigung von Deutschland und Österreich eine Möglichkeit, die Demokratie zu stärken und gleichzeitig ihre nationale Überzeugung deutlich zu machen. Daher waren in der Weimarer Zeit nicht alle Rufe nach einem Anschluss die Vorboten eines Nazi-Reiches, wie manche Historiker behauptet haben.64
Da nach dem Ersten Weltkrieg das Konzept der Volkszugehörigkeit Vorrang vor dem der Staatsangehörigkeit hatte, spielte auch die Vorstellung einer globalen deutschen Diaspora eine Rolle im Kampf um politische Legitimität. Hier diskutierten die Feinde und Freunde der Weimarer Demokratie nicht über eine Neugestaltung der Grenzen Deutschlands, sondern instrumentalisierten die Idee einer deutschen Diaspora, um bei den in Übersee lebenden Deutschen zu werben und damit ihre jeweiligen politischen und nationalen Ansichten zu stärken.65 Ein Weg zur Erreichung dieses Ziels war die Gründung von Auslandsabteilungen derjenigen Organisationen, die direkt mit der Weimarer Politik verknüpft waren, und das auf Initiative von Deutschen im In- und Ausland. So gab es Stahlhelm-Ortsgruppen in Südwestafrika (heute Namibia), den Vereinigten Staaten, Brasilien, China, Portugal und Italien. Die NSDAP gründete 1931 ihre Auslands-Organisation, die nach eigener Aussage schon 1932 weltweit ein Dutzend Orts- und Landesgruppen und schätzungsweise 3000 Mitglieder umfasste.66 Doch Auslandsdeutsche waren nicht einfach die Vorläufer einer fünften Kolonne der Nazis. Auch das Reichsbanner gründete Ortsgruppen in Portugal, den Niederlanden, Bulgarien, Argentinien und den Vereinigten Staaten. Außerdem stand es unter anderem in Mexiko und Brasilien unabhängigen deutsch-republikanischen Organisationen zur Seite. Ein Artikel in der Zeitschrift des Reichsbanners mag als Beispiel für die widerstreitenden Versuche dienen, sich als die Stimme der deutschen Diaspora zu etablieren: Die republikanischen Auslandsgruppen, so wurde hier versichert, „zeigen, daß die Behauptungen der Rechtspresse, die Auslandsdeutschen ständen geschlossen hinter dem monarchischen Gedanken und hinter Schwarzweißrot, nichts als bewußte Irreführung der öffentlichen Meinung in Deutschland sind!“67 Die Bildung der Auslandsabteilungen von Reichsbanner, Stahlhelm und NSDAP zeigt, dass der Kampf um eine Antwort auf die Deutsche Frage global ausgefochten wurde.