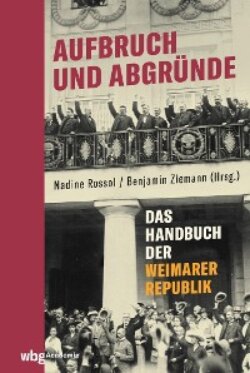Читать книгу Aufbruch und Abgründe - Группа авторов - Страница 59
3. Wahlrecht, Wahlgerechtigkeit und Demokratie
ОглавлениеDie Folgen dieser kollektiven Selbstbeschreibungen waren demokratisierend. Sie rückten die Gleichheit der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in den Blick, und das wirkte sich beim Wahlrecht aus. Das Mehrheitswahlrecht des Kaiserreichs hatte viele Stimmen unter den Tisch fallen lassen, die Wahlkreiseinteilung war unfair gewesen, und zusammen mit dem Koalitionsverhalten der bürgerlichen Parteien hatte dies dazu geführt, dass die Stimmenanteile der SPD – 1912 gewann sie 35 Prozent – sich niemals in einer entsprechenden Zahl von Abgeordnetenmandaten niederschlugen. Deshalb war „Gerechtigkeit“ der zentrale Wert bei der Einführung eines neuen Wahlrechts in der Weimarer Republik.30 Jede Stimme sollte gleich zählen und gleich gelten. Dass dies nur durch ein Verhältniswahlrecht erreicht werden könne, war nicht umstritten; in der Weimarer Nationalversammlung wurde darüber kaum diskutiert. Allein Friedrich Naumann als Vertreter der DDP befürchtete – die scheinbar festgefügten Wählerschaften der Milieu-Parteien im Kopf –, dass dann ein Machtwechsel nicht mehr möglich wäre, der aber für das parlamentarische System notwendig sei: „Parlamentarisches System und Proporz schließen sich gegenseitig aus“.31
Das Weimarer Wahlrecht zielte darauf, den Reichstag (wie auch die Länderparlamente, deren Wahlrecht dem des Reichstags im Wesentlichen nachempfunden wurde) zum Spiegel der Wahlbevölkerung zu machen. Weniger die Entscheidungsfunktion der Parlamente als vielmehr ihre Repräsentationsfunktion stand im Vordergrund. Deshalb dachte auch niemand an eine Mindeststimmklausel, wie sie die meisten heutigen Verhältniswahlrechte kennen. Das Verhältniswahlrecht hatte Folgen für die Formen politischer Vertretung: Sie wurde nun durch Parteien und nicht mehr durch Wahlkreiskandidaten wahrgenommen. In 35 sehr großen Wahlkreisen – im Kaiserreich waren es 397 gewesen – traten Parteilisten und nicht mehr einzelne Kandidaten zur Wahl an. Das brachte die Parteiapparate bei der Rekrutierung der politischen Eliten in eine entscheidende Position. Die seit 1848 geltende Vorstellung, dass lokale Wählerschaften von einem Repräsentanten vertreten würden, machte der Idee Platz, dass nationale Gesinnungsgemeinschaften ihre Vertretung finden müssten. Das wiederum begünstigte die programmatische Wahl gegenüber der Wahl von Personen.
Das Verhältniswahlsystem und die ihm zugrunde liegende Repräsentationsvorstellung begünstigten ein Vielparteiensystem. Durch das Fehlen eindeutiger Mehrheiten waren Koalitionen die einzige Art zu regieren, und bis diese verhandelt waren, vergingen nach der Wahl oft Wochen. Erschwert wurde das Regieren durch das Fehlen einer Sperrklausel. Interessenparteien und programmatische Splitterparteien traten auf den Plan und erlangten Sitze im Reichstag. Diese Protestparteien waren zwar für sich klein, erlebten aber um die Mitte der 1920er Jahre insgesamt eine Konjunktur, die ihnen bis zu einem Siebtel der Wähler zuführen sollte. Das gab ihnen Störpotenzial. Im Reichstag von 1928 fanden sich 15 Parteien, darunter die Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung und das Sächsische Landvolk mit je zwei, der Landbund und die Deutsch-Hannoversche Partei mit je drei Sitzen. 9 der 15 Parteien verfügten über weniger als je 5 Prozent der Sitze.32
Dies wurde schon von Zeitgenossen als ein Problem sowohl der demokratischen Legitimität als auch der Entscheidungsfähigkeit der parlamentarischen Institutionen beschrieben.33 Reformvorschläge gab es viele: von einer Erhöhung des Wahlalters (weil man den jungen Wählern keine entsprechende Verantwortung zutraute) über Hybride von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, eine Verkleinerung der Wahlkreise oder die Einführung von Pluralstimmen bis hin zu freien statt vorgegebenen Parteilisten, auf denen die Wähler ihre bevorzugten Kandidaten ankreuzen konnten. Von Seiten der DDP kam 1929 der bemerkenswerte Vorschlag, eine dreiprozentige Sperrklausel einzuführen – bemerkenswert deshalb, weil die Partei sich damit selbst existenziell schaden konnte.34 All diese Vorschläge brachen sich aber an einer Vorstellung von Wahlgerechtigkeit, die trotz der praktischen Probleme breit geteilt wurde und die keine Stimme verloren gehen lassen wollte.
Vor allem der Politikwissenschaftler Ferdinand Hermens und seine Schüler haben in der frühen Bundesrepublik das Verhältniswahlrecht als den maßgeblichen Grund für den Untergang der Weimarer Republik ausgemacht.35 Diese These wird heute kaum mehr vertreten. Denn sie unterschätzt die tiefgehende soziale, politische und kulturelle Zerklüftung in der Wählerschaft, die durch ein Mehrheitswahlrecht lediglich wieder in die alte Struktur regionaler Parteien und eben nicht zum idealisierten Zweiparteiensystem geführt hätte. Und sie übersieht, dass die Verhältniswahl nach den Ungerechtigkeitserfahrungen des Kaiserreichs einer großen Menge an Wählern die politische Integration erleichterte, weil sie ihnen Gehör und Stimme versprach. Auch international wird der Zusammenhang von Verhältniswahl und Regierbarkeit bezweifelt.36 Österreich hatte trotz eines Proportionalsystems jahrzehntelang ein Zweiparteiensystem, Kanada hat trotz Mehrheitswahlrecht ein Mehrparteiensystem, Israel wird effektiv regiert, obwohl dort momentan (2021) dreizehn Parteien im Parlament sitzen.
Darüber hinaus versäumt diese These, die Reformen der Weimarer Republik im zeitgenössischen europäischen Kontext zu sehen.37 Im Hinblick auf das Wahlalter lag Deutschland im Trend. Der Krieg, der ja vor allem von jungen Männern geführt worden war, erzwang überall eine Absenkung des Wahlalters. Auch die Verhältniswahl war in vielen europäischen Ländern nach 1918 gefordert und vielerorts auch eingeführt worden, insbesondere in den neu entstandenen Staaten wie Polen (1918) und der Tschechoslowakei (1920), aber auch in Italien (1919) und den Niederlanden (schon 1917). In Frankreich wurde das von der Linken dringend geforderte Verhältniswahlrecht im Senat zu einem Hybrid modifiziert. Das allgemeine Frauenwahlrecht wurde in Deutschland sogar vor anderen großen europäischen Ländern wie Großbritannien, Frankreich oder Italien eingeführt.38 Das Wahlrecht der Weimarer Republik befand sich auf der Höhe der Zeit und im Einklang mit internationalen politischen Trends.
Darüber hinaus bot die Weimarer Republik eine grundlegend neue Form der politischen Partizipation an, die nur wenige andere politische Systeme aufwiesen: Elemente der direkten Demokratie.39 Der Reichspräsident, das höchste Amt im Staate, wurde in allgemeiner Wahl vom Volk direkt gewählt und bildete neben dem Reichstag die zweite Säule der demokratischen Legitimität: Das war ein weitgehendes Novum in Europa.40 Der liberale Soziologe Max Weber und andere scharfe Beobachter hatten 1919, im Umfeld der Wahl des Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum Reichspräsidenten, die noch durch die Nationalversammlung erfolgte, eine solche plebiszitäre Wahl gefordert, weil sie dem Parlament nicht zutrauten, eine weithin anerkannte politische Führung zu bestellen. Gerade um große Reformprojekte wie die Sozialisierung anzugehen, brauche es, so Weber, einen „selbstgewählten Vertrauensmann der Massen“: Weber dachte sich den plebiszitär bestellten Führer also eigentlich als einen Sozialisten. Dass er schon in diesem Kontext den Begriff des „Diktators“ benutzte, verweist darauf, dass sich mit dem Reichspräsidenten nicht allein eine Ausweitung von Mitbestimmung, sondern auch die Vorstellung von einer massenbasierten Führung eines Einzelnen verband, die im Notfall auch tatsächlich diktatorisch funktionieren konnte. Der Artikel 48 der Reichsverfassung, der dem Reichspräsidenten das Instrument der Notverordnung zubilligte, stand dafür. Aber Weber begriff die Wahl als einen Ausdruck der Demokratie und forderte den Reichstag auf, er solle „das Recht der unmittelbaren Führerwahl anerkennen“: „Möge die Demokratie nicht ihren Feinden diese Agitationswaffe gegen das Parlament in die Hand drücken.“41 Hier zeigten sich schon in der Wortwahl des Liberalen Max Weber spezifische Vorstellungen von Demokratie und eine gewisse Skepsis gegenüber dem parlamentarischen Repräsentativsystem. Ein solches galt nicht unbedingt als demokratischer als eine unmittelbare Wahl durch das Volk – ganz im Gegenteil. Aus Webers Worten sprach eine Angst vor der Herrschaft der Parteien und ihrer Funktionäre, die man heute wohl als „populistisch“ bezeichnen würde.
Diese unmittelbare Führerwahl fiel allerdings in der Praxis nicht im Sinne der Republikgründer und auch nicht im Sinn des Liberalen Max Weber aus. Vielmehr wurde sie Ausdruck eines Bedürfnisses nach einem starken Führer im Angesicht eines nur begrenzt führungsfähigen Parlaments und durchaus auch gegen dieses. Die Wahl Friedrich Eberts war eine Absage an eine grundlegende revolutionäre Umgestaltung. Sie bedeutete stattdessen eine Kooperation von Arbeiterschaft und Bürgertum. Als nach Eberts frühem Tod im Februar 1925 eine Neuwahl notwendig wurde, die nun als Volkswahl vor sich gehen sollte, stand diese schon im Zeichen einer Auseinandersetzung zwischen den Verfechtern einer liberalen Republik und einer breiten konservativen und rechten Opposition, die man freilich nicht in Bausch und Bogen als antirepublikanisch abtun kann. Nachdem im ersten Wahlgang größtenteils Parteienvertreter kandidiert hatten, sammelten sich für den zweiten Wahlgang sowohl militant antirepublikanische als auch gemäßigte Konservative im „Reichsblock“ unter dem Banner des Ex-Generals Paul von Hindenburg. Dessen Prestige als „Sieger von Tannenberg“ dokumentierte, wie sehr die Kriegsniederlage verdrängt worden war, für die Hindenburg ja auch verantwortlich zeichnete. Gegenüber seinem Gegenkandidaten vom „Volksblock“, dem ehemaligen Reichskanzler Wilhelm Marx (Zentrum), der als ausgesprochener Vertreter der Weimarer Koalitionspolitik erschien, wurde der Nicht-Politiker Hindenburg als ein Führer der Massen „über den Parteien“ präsentiert.42
Wie wenig allerdings diese Wahl noch als eine grundsätzliche aufgefasst wurde, zeigt der Umstand, dass die Bayerische Volkspartei – bekennend katholisch, aber auf Abstand zum Zentrum – nicht den katholischen Wilhelm Marx zur Wahl empfahl, sondern den protestantischen Hindenburg. Wenngleich die Vorbehalte gegen Hindenburg auch im „Reichsblock“ groß waren, nicht zuletzt deshalb, weil er zur Enttäuschung der rechten Systemopposition die öffentliche Versicherung abgab, sich an die Verfassung halten zu wollen, konnte sich Hindenburg im zweiten Wahlgang knapp durchsetzen. Allen inneren Konflikten zum Trotz konnte er als Sammelkandidat der Rechten gelten, und das sollte sich als zukunftsfähig erweisen. Die Wahl 1925 war eine wichtige Station für Wähler auf dem Weg zur NSDAP. Viele derer, die 1925 Hindenburg wählten, vor allem vorherige Nichtwähler, wählten nach 1930 die NSDAP.43
Es erscheint paradox, dass Hindenburg bei seiner erneuten Kandidatur 1932 als Kandidat des republikanischen Lagers auftrat und viele seiner ehemaligen Parteigänger nun den Gegenkandidaten Adolf Hitler unterstützten.44 Das ist ein Hinweis auf die Zwangslage, in der die republikanischen Kräfte sich angesichts des Aufstiegs der NSDAP und ihres Kandidaten befanden. Es ist aber auch ein Hinweis darauf, dass Hindenburg die Hoffnungen der Rechten nicht erfüllt hatte. Weder hatte er sich zum Verfassungsbruch bereitgefunden, noch hatte er substanziell ins politische Tagesgeschäft eingegriffen. Als nationale Integrationsfigur war er bis weit über das nationale Lager hinaus respektiert, und er wirkte als Symbol dafür, dass man auch als Konservativer der Republik dienen konnte. Es zeigt aber die Agonie des republikanischen Lagers, dass dieses sich nicht in der Lage sah, einen eigenen profilierten Kandidaten aufzustellen, der nicht als Parteikandidat wahrgenommen wurde. Auch die SPD sah in Hindenburg eine Integrationsfigur, und im Wahlkampf wurde dieser als ein Garant der Überwindung der Parteiengegensätze präsentiert. Gegen ihn trat Adolf Hitler an, der mit Unterstützung der radikalen Rechten im ersten Wahlgang 30 und im zweiten 37 Prozent der Stimmen erreichte. Zweifellos war Hitler sehr viel stärker mit dem Image als Parteimann verbunden, jedoch trat er unter dem prononcierten Anspruch auf, „Wegbereiter des neuen Deutschlands“45 zu sein und so gegenüber dem 84-jährigen Hindenburg eine Zukunftsvision zu vertreten. Die Präsidentschaftswahlen figurierten also immer unter dem Aspekt einer Repräsentation des Volkes, die sich nicht in einer parlamentarischen Repräsentation erschöpfte und diese auch immer, gewissermaßen „von außen“, kritisierte.
Ein weiteres, in Europa ebenfalls neues Element der direkten Demokratie war der Volksentscheid. Das Gesetz dazu wurde im April 1920, im unmittelbaren Umfeld des Kapp-Lüttwitz-Putsches verabschiedet. Es lag einerseits auf einer Linie der stärkeren plebiszitären Öffnung des politischen Systems. Andererseits war die Politik der Nationalversammlung eindeutig antiplebiszitär und versuchte, diese Momente der direkten Demokratie möglichst einzuhegen. Insbesondere die Anforderungen an die Wahlbeteiligung stellten im Grunde schon einen Misserfolg sicher, denn es musste sich die Mehrheit der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligen. Eine solche Mobilisierung war praktisch nicht zu erreichen und über die Parole zum Fernbleiben zu verhindern.46 Allerdings führte auch eine Reihe von Ländern das Referendum ein, und die erste Volksabstimmung fand bereits im Dezember 1919 in München (über die Abwahl des Stadtrats) statt.
In der Weimarer Republik erreichten auf Reichsebene nur zwei der sieben Volksbegehren die notwendige Unterstützung, um zum Volksentscheid zugelassen zu werden: der Volksentscheid zur „Fürstenenteignung“ vom 20. Juni 1926, in dem auf Betreiben der KPD und mit zögerlicher Unterstützung der SPD eine entschädigungslose Enteignung der Fürstenhäuser gefordert wurde, die 1918/19 politisch entmachtet worden waren. Sowie das Referendum einer rechtsradikalen Koalition unter Führung des DNVP-Vorsitzenden Alfred Hugenberg gegen die endgültige Reparationsregelung, den Young-Plan, 1929. In beiden Fällen war das Referendum chancenlos, auch wenn die meisten derer, die abstimmten, dafür votierten. Beim Fürstenentscheid beteiligten sich 40 Prozent, beim Referendum gegen den Young-Plan gar nur 13,5 Prozent. Beide Male waren die Republikgegner deutlich in der Minderheit. Die Volksentscheide stellten jedoch Bühnen für antirepublikanische Parteien dar, die dadurch eine hohe Publizität erhielten, wenn auch gerade für die NSDAP die Bedeutung der Young-Plan-Kampagne nicht überschätzt werden sollte.47 Volksentscheide führten unter Umständen zu Zerreißproben innerhalb der politischen Lager wie zum Beispiel in der Zentrumspartei, wo die Frage der entschädigungslosen Enteignung der Fürsten Konflikte zwischen bürgerlichen Eliten und katholischen Arbeitern hervorrief.48 Die Plebiszite konnten mithin Keile in die parlamentarisch dominanten Machtgruppen treiben.
Die plebiszitären Elemente der Weimarer Demokratie haben insofern nicht im Sinne der Republik funktioniert. Aber zweifellos wirkten sie demokratisierend dahingehend, als sie die Bürger für kollektive Entscheidungen mobilisierten, darunter nicht zuletzt habituelle Nichtwähler. Sie brachten, wie bei der Fürstenenteignung, Themen ins Spiel, die von den politischen Institutionen nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden waren. Und sie polarisierten – nicht nach Sachfragen, sondern nach Systemfragen und nach Personen. Die Legitimität von Parteien als Sachwalter des Volkswillens wurde dabei immer infrage gestellt.