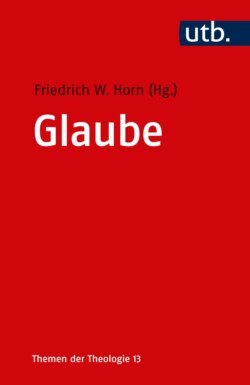Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 32
2.3. Hellenismus
ОглавлениеGerhard Barth hat im Anschluss an Dieter Lührmann dessen These, dass der nichtjüdische und pagane Hellenismus einen religiösen Gebrauch von πίστις (»Glaube«) und πιστεύειν (»glauben«) nicht kenne, in Frage gestellt und nach gründlicher Überprüfung und Besprechung des griechisch-hellenistischen Materials völlig andere Ergebnisse vorgelegt (Barth 1982; dann auch Schunack 1999). Vor allem bei Plutarch (ca. 45–125 n. Chr.), aber auch bei anderen Schriftstellern, finde sich der religiöse Gebrauch von πιστεύειν bezogen auf Götter, die Tyche, die Orakel, religiöse Rede, Wunder und Gottesverehrung »häufiger […] als anderswo« (181). Dies erkläre sich »am einfachsten wohl daher, daß dieser Gelehrte und Philosoph zugleich Priester in Delphi war, daß wir es hier also gewissermaßen mit einem heidnischen Theologen zu tun haben« (182). Es sei wohl nicht zu bestreiten, dass die Sprache des frühen Christentums maßgeblich vom hellenistischen Judentum |41|beeinflusst sei, allerdings sei vor allem in der Gräzität, speziell bei Plutarch, der Gebrauch von πίστις im Sinne der fides quae creditur belegt (πάτριος καὶ παλαιὰ πίστις [»der väterliche und alte Glaube«], Mor 756B, 402E) wie auch die Konstruktion des Genitivus obiectivus (πίστις τοῦ θείου [Gottesglaube«], Mor 165B). Darüber hinaus werde πιστεύειν/πίστις (»glauben«/»Glaube«) häufig mit einem Dativ konstruiert (Glaube oder Vertrauen an einen Gott), es begegne wie im Neuen Testament und im Judentum die Konstruktion πιστεύειν ὅτι (»glauben, dass«) und einmal πίστις in Verbindung mit der Präposition πρός (»auf/an«). Allein für die Verbindung πίστις περὶ θεοῦ/ (»Glaube über Gott« für eine Überzeugung, die man über Gott oder im Blick auf Gott hat) begegne im Judentum und im Neuen Testament gar nicht.
Ein wesentliches Nebenergebnis der Studie Barths ist, dass die urchristliche Missionsverkündigung an diesen Sprachgebrauch innerhalb des nichtjüdischen Hellenismus anknüpfen konnte (191). Wäre hingegen Lührmanns These korrekt, dass die Rede von πίστις und πιστεύειν ausschließlich im internen jüdischen und christlichen Sprachkontext verankert gewesen sei, dann bliebe das Aufkommen dieses Sprachgebrauchs in der frühchristlichen Mission geradezu unverständlich (192). Die Frage nach sprachlichen Anknüpfungspunkten im Bereich des Hellenismus ist zuletzt durch den wichtigen Hinweis Christian Streckers ergänzt worden, dass im Bereich der imperialen römischen Kultur fides (»Glaube«) gleichfalls ein wesentlicher Verstehenshorizont für die πίστις-Aussagen des Paulus war (Strecker 2005).