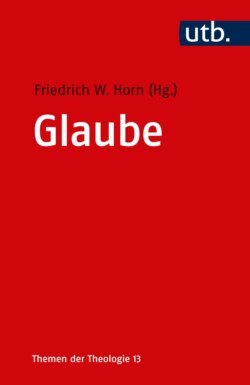Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 43
7. Johannesevangelium
ОглавлениеDas Johannesevangelium meidet den Gebrauch des Substantivs πίστις (»Glaube«), bietet aber 98 Belege für das Verb πιστεύειν (»glauben«), zumeist in der Kombination mit der Präposition εἰς (»auf/an«), also bezogen auf eine Person oder einen Gegenstand. Eine Erklärung für diesen Sachverhalt ist nicht sicher zu finden. Das Substantiv war im christlichen Sprachgebrauch fest verankert und es war dem Verfasser des Johannesevangeliums auch durch diejenigen der synoptischen Evangelien, die er kannte, vertraut. Ähnlich stellt sich der Befund im 1. Johannesbrief dar, hier stehen acht Verwendungen des Verbs immerhin einem einzigen Gebrauch des Substantivs gegenüber.
Das Johannesevangelium wurde ausweislich seines Schlusssatzes deshalb geschrieben, »damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen« (20,31). Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Evangelist einen Teil, aber nicht alle ihm bekannten Wundertaten Jesu in seinem Evangelium aufgeschrieben (20,30). Durch die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu in den Wundern entsteht Glaube an ihn (1,50; 2,11.23; 4,39.53; 7,31; 10,38.42; 11,45.48; 12,11.37; 14,11; 20,30f.). Nur selten wird die Reihenfolge umgedreht, so dass der Glaube, wie in synoptischen Heilungsgeschichten, dem Wunder vorausgeht (4,50; 11,40). An dieser Zuordnung von Offenbarung der Herrlichkeit des Gesandten im Wunder und dem darauf bezogenen Glauben hat es, etwa durch Bultmann (1968: 425), insofern Kritik gegeben, als der Glaube nach seiner Sicht wesentlich auf die Botschaft und nicht auf ein äußerliches Zeichen (Wunder) bezogen sein darf. Man muss dagegen jedoch einwenden, dass das Johannesevangelium hier anders votiert. Der Glaube wird nicht durch ein Mirakel, ein Wunder an sich erweckt, sondern der Glaube erkennt den im Wunder sich offenbarenden Gottessohn (Hahn 2011: 467; 1985a; 1972).
Die dann im Evangelium häufig belegte Kombination πιστεύειν mit Dativ μοι (»mir«) (4,21; 8,45) und vor allem von πιστεύειν mit der Präposition εἰς deutet auf einen personalen Bezug des Glaubens, und |56|zwar an den Namen Jesu (1,12; 3,18), an Jesus (Christus) (12,11), an ihn (2,11; 3,16), an den Sohn (3,36), an mich (3,35.38) oder auch an Gott und mich (14,1). Auch begegnet mehrfach die Rede vom Glauben an den, der mich (Jesus) gesandt hat (5,24.38; 6,29; 11,42; 12,44; 17,8). Dieser Glaube an Jesus bezieht sich auch auf sein Wort (4,41.50; 5,24) oder auf die Schrift, die von Jesus Zeugnis ablegt (5,46f.). Auf der Ebene der nachösterlichen Gemeinde ist der Glaube an das im Johannesevangelium präsente Wort Jesu schlechthin der Zugang zu seiner Person, es ist die Gestalt des Glaubens. Diese Worte Jesu, denen Glauben geschenkt wird, beinhalten Zusagen und Heilsgaben, wie vor allem an den sog. Ich-bin-Worten deutlich wird (6,35.41.48.51; 8,12; 10,7.9.11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5).
Ein wesentlicher Aspekt des Glaubensverständnisses ist die Relation von Glaube und Erkennen (γινώσκειν/»erkennen«). »Im Erkennen erschließen sich die Dimensionen des Glaubens an Gott und Jesus Christus« (Hahn 2011: 466). Der Glaubende erkennt die Wahrheit und gewinnt Freiheit (8,32). Zunächst ist die gegenseitige Erkenntnis für Gott den Vater und Jesus den Sohn ausgesagt (10,15), dann aber auch für Jesus und die zu ihm Gehörenden (10,14). Diese Erkenntnis eröffnet die Einsicht für Gott (17,3; 1Joh 2,13; 4,6f.), in die Offenbarung Jesu (6,69; 10,14; 1Joh 4,16) und in die Wirksamkeit des Parakleten (14,17.20). Wer nicht im Glauben steht, hat nicht erkannt und erkennt auch gegenwärtig nicht (1,10; 16,3; 17,25).
Wenn nicht von der Erkenntnis gesprochen wird, die der Glaube gewinnt, dann greift Johannes mittels des breit ausgearbeiteten Wortfeldes der optischen Wahrnehmung zu dem Bereich des Sehens/Schauens (vor allem ὁρᾶν, βλέπειν, θεωρεῖν/»sehen«). Es geht hierbei, wie bereits der Prolog des Evangeliums zeigt (1,14: wir sahen seine Herrlichkeit; dann auch 11,40; 17,24), »um das im Glauben mögliche Schauen der sich auf Erden bereits realisierenden Heilswirklichkeit« (Hahn 2011: 467). Auch hier gilt, dass den Glaubenden das Sehen eröffnet wird, während die nicht Glaubenden eben nicht sehen (16,16.22). Exemplarisch werden Sehen und Nicht-Sehen, Augenlicht und Blindheit der Wundergeschichte in Joh 9,39–41 zum Glauben in Beziehung gesetzt (dazu Labahn 2009). Der Blindgeborene wird durch den Glauben ein Sehender, die sich dem Glauben verschließenden Pharisäer werden zu Blinden. Der Glaube hat bereits gegenwärtig am Leben, am ewigen Leben, am Heil in vollem Umfang Anteil, denn der Glaubende geht nicht mehr auf ein Gericht zu, sondern ist bereits gerettet (3,17–19). Ruben Zimmermann (2004: 45–59) hat das ›Sehen‹ im Johannesevangelium als Basis der Christologie der |57|Bilder vorgestellt. Sehen ist gerade nicht nur die empirische Wahrnehmung, sondern es impliziert eine Tiefendimension des geistigen Sehens.
Diese Gedanken werden im Johannesevangelium in immer neuen Anläufen und mit leichten Variationen dargelegt. Im Kern wird das Thema des Glaubens verdichtet auf die Anerkennung Jesu als des Gesandten Gottes. Diese Anerkennung wiederum stellt in eine heilvolle Gemeinschaft mit Jesus und eröffnet einen tiefen Erkenntnisgewinn über das Leben.