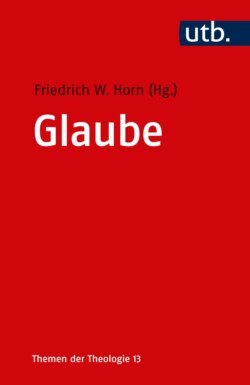Читать книгу Glaube - Группа авторов - Страница 38
5.1. Gerecht nicht durch Werke des Gesetzes, sondern durch Glauben an Jesus Christus
ОглавлениеIn Gal 2,16 formuliert Paulus erstmals eine klare Alternative zwischen Glauben an Jesus Christus und Werken des Gesetzes. Röm 3,28 (vgl. auch 3,21; 4,6) wird diese Aussage erneut aufnehmen. Die in beiden Aussagen beschlossene Einsicht stellt die Basisformulierung der Rechtfertigungslehre des Paulus dar, deren Ausarbeitung der Galater- und der Römerbrief vollziehen:
Wir wissen, dass ein Mensch nicht gerechtfertigt wird aus Werken des Gesetzes (ἐξ ἔργων νόμου), sondern durch Glauben an Jesus Christus (διὰ πίστεως Ιησοῦ Χριστοῦ), und wir sind zum Glauben an Christus Jesus gekommen (εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν), damit wir gerechtfertigt werden durch den Glauben an Christus (ἐκ πίστεως Χριστοῦ/aus Glauben Christi) und nicht aus Werken des Gesetzes (οὐκ ἐξ ἔργων νόμου), denn aus Werken des Gesetzes (ἐξ ἔργων νόμου) wird niemand gerechtfertigt (Gal 2,16).
Dieser Satz begegnet erstmals in der Besprechung des sog. antiochenischen Zwischenfalls (Gal 2,11–21). Die Mahlgemeinschaft von Heiden- und Judenchristen in der Stadt Antiochia ohne Beachtung der jüdischen Speisevorschriften war dem Bericht zufolge von Petrus zeitweise geteilt, nach dem Auftreten Jerusalemer Judenchristen in Antiochia aber wieder zurückgenommen worden. In der Folge seiner Entscheidung zogen sich auch die anderen Judenchristen Antiochias und selbst der theologische Ziehvater des Paulus, Barnabas, von der Mahlgemeinschaft zurück. Dies bedeutete, dass in Antiochia der Versuch, Heidenchristen und Judenchristen in einer Gemeinschaft ohne Beachtung der jüdischen Tora(vorschriften) zu verbinden, gescheitert war. Paulus bewertet im Rückblick das Verhalten des Barnabas und der anderen Judenchristen als Heuchelei (Gal 2,13) und hält Petrus u.a. die Konsequenz seines Verhaltens vor: Wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben (Gal 2,21).
|49|Im Rückblick auf diesen Zwischenfall formuliert Paulus den Gegensatz von Glaube an Jesus Christus und Werken des Gesetzes und er trägt ihn in die Darstellung des antiochenischen Konflikts ein. Was aber ist mit diesen beiden Syntagmen gemeint und worauf zielt die Entgegensetzung? Die sog. New Perspective on Paul hat mit Recht darauf hingewiesen, dass es bei den Werken des Gesetzes keineswegs um eigene verdienstliche Werke gehe, die der Rechtfertigung entgegenstehen. Vielmehr eröffnet Paulus einen Gegensatz zu den von der Tora geforderten Handlungen oder Vorschriften. Innerhalb der New Perspective dachte man hierbei an diejenigen von der Tora geforderten Handlungen, die zur Identität des jüdischen Lebens in paganer Umgebung beitragen und sie erkennbar machen: Beschneidung, Sabbat, Reinheits- und Speisegebote. Distanziert Paulus sich von diesen Werken des Gesetzes, so eröffnet er Heiden einen Zugang zum Gottesvolk, ohne sie an jüdische Identitätsmerkmale zu binden. Diese Werke des Gesetzes haben im Zusammenhang der Rechtfertigung des Menschen vor Gott oder durch Gott keine Bedeutung mehr, an ihre Stelle tritt ausschließlich der Christusglaube. Man darf nun nicht im Umkehrschluss meinen, dass das Judentum eine Religion der Selbstrechtfertigung durch Werke des Gesetzes gewesen sei. Die Ausrichtung an der Tora diente vielmehr der Bewahrung des Bundes. Allerdings tritt jetzt, da die christlichen Gemeinden sich aus Juden und Heiden zusammensetzen, die Tora in dieser Funktion ganz zurück und an ihre Stelle tritt der Glaube an Jesus Christus als einzige Bedingung und Aneignungsform des Heils. Paulus weitet im Galater- und Römerbrief den Gegensatz zu den Werken des Gesetzes zunehmend aus und bezieht ihn nun auf die Tora insgesamt. Christus wiederum ist das Ende des Gesetzes (Röm 10,4).
Diese Grundentscheidung verdichtet Paulus abschließend im Proömium des Römerbriefs im Blick auf das Evangelium: »[…] denn es ist eine Macht Gottes zum Heil für jeden, der glaubt, für den Juden vor allem und auch für den Heiden. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm offenbar aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: Der aus Glauben Gerechte wird leben« (Röm 1,16f.). Die Bestimmung ›für jeden, der glaubt‹ wird zweimal im Blick auf Glauben aufgenommen. Mit der Präpositionalverbindung ›aus Glauben zu Glauben‹ deutet Paulus auf einen Anfang und ein Ziel, also auf eine nicht überbietbare Totalität, die vom Glauben umschlossen wird. Bestätigend für diese Sicht führt er das Schriftzitat aus Hab 2,4 an, das er bereits in Gal 3,11 eingesetzt hatte. Dieses Zitat soll neben Gen 15,6 (aufgenommen in Röm 4,3; Gal |50|3,6) belegen, dass diese Verbindung von Gerechtigkeit und Glaube bereits im Alten Testament angesprochen worden ist. Dieses Zitat ist wohl so aufzunehmen, dass die Zuordnung von ἐκ πίστεως (»aus Glauben«) zu δίκαιος (»gerecht«) und nicht zu ζήσεται (»er wird leben«) gesetzt wird, also: der aus Glauben Gerechte wird leben.
Ich rufe an dieser Stelle einen Einspruch auf, den der Jakobusbrief gegen diese Position vorträgt. Der Einspruch in 2,14–26 richtet sich gegen die Position des Paulus, was daran erkennbar wird, dass Jakobus die entscheidenden Stichworte aufnimmt, aber neu bestimmt: den mehrfachen Gegensatz von πίστις (»Glaube«) und ἔργα (»Werke«; allerdings nicht ἔργα νόμου [»Werke des Gesetzes«]), das Syntagma πίστις χωρὶς (τῶν) ἔργων (»Glaube ohne Werke«) (Röm 3,28/Jak 2,18), μόνον (»allein«) (Röm 3,29/Jak 2,24), die Verknüpfung dieses Themas mit dem Abraham-Beispiel (Jak 2,21–23/Röm 4), das Zitat von Gen 15,6 (Röm 4,3/Jak 2,28), das in beiden Texten von der LXX leicht abweicht. Wir wissen nicht, ob der Galater- oder der Römerbrief dem Verfasser des Jakobusbriefs bekannt war und er sich also direkt gegen beide Schriften und deren Verfasser wandte. Möglicherweise sind ihm die entscheidenden Stichworte durch Christen paulinischer Gemeinden oder auch von antipaulinisch gesinnten Christen übermittelt worden. Daneben wird allerdings auch die These vertreten, dass Paulus und Jakobus unabhängig voneinander auf den frühjüdisch/frühchristlich bezeugten Zusammenhang von Glaube und Rettung eingehen. Von Werken des Gesetzes spreche Jakobus aber gerade nicht (Konradt 2013: 552f.). Gegenüber dieser Entgegensetzung von Glaube und Werken betont Jak 2,22: der Glaube wirkt zusammen mit seinen Werken, und durch die Werke wird der Glaube vollendet. Dies bedeutet nach 2,17: Der Glaube, der keine Werke hat, ist für sich allein tot.
Der Jakobusbrief bietet mehr als diese Antithese (dazu Niebuhr 2009) und sein Verfasser hat den von Paulus eröffneten Gegensatz von Glaube und Werken nicht in der von diesem beschriebenen Tiefendimension aufgenommen. Das Gesetz (1,25; 2,8–12; 4,11) ist für Jakobus die Norm christlichen Lebens, Sünde besteht im Missachten der Gesetzesforderung. Paulus hingegen kann das Gesetz im Galater- und Römerbrief jedoch nicht mehr so uneingeschränkt als Norm anerkennen, da in der Begegnung mit dem Gesetz gerade die Begierde erweckt wird, die zur sündigen Tat führt. Auch würde sich Paulus nicht von den Beispielgeschichten in Jak 2,15f., die einen Glauben ohne Werke illustrieren sollen, getroffen fühlen, wie das Insistieren auf Nächstenliebe in Röm 13,8–10; Gal 5,6.14; 6,2; 2 Kor 8,13f. u.a. zeigt.