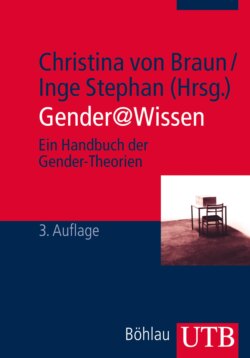Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 18
Identität
Claudia Breger Einleitung
ОглавлениеDer Begriff der Identität ist aus dem lateinischen idem: „(ein und) derselbe / dasselbe“ abgeleitet. Meyers Großes Taschenlexikon definiert ihn allgemein als „vollkommene Gleichheit oder Übereinstimmung (in Bezug auf Dinge oder Personen); Wesensgleichheit“, „Echtheit“ einer Person.1 Entwickelt worden ist der Begriff zunächst in der antiken Logik, deren Rezeption in der neuzeitlichen Philosophie ihn in die Wissenschaft der Moderne hineingetragen hat. Hier allerdings hat sich die Bedeutung des Begriffes im Laufe der Zeit verschoben: In der aktuellen Diskussion lässt sich Identität vielleicht am besten als Antwort auf die Fragen ,wer bin Ich? Wer sind Wir?‘ beschreiben. Dabei geht es nicht um die „absolute Selbstgleichheit“ der Logik, sondern um die Herstellung von Kohärenz, sei es historisch bzw. biographisch (als Kontinuität, Gedächtnis etc.) oder horizontal (als Konsistenz des Ich bzw. sozialer Zusammenhang).2 In diesem Sinne lässt sich die Frage der Identität als zentrale, wenn nicht die zentrale Problematik der neuen Frauenbewegung und der aus ihr hervorgegangenen Geschlechterforschung beschreiben. Denn einerseits funktioniert Identität hier als grundlegender Bezugspunkt politischer Aktivität wie wissenschaftlicher Arbeit: Wer / was sind die Frauen und Männer, um die es geht? Andererseits aber ist Identität in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als immer schon problematische, als Medium von Herrschaft und Gewalt diskutiert worden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts allerdings lässt sich konstatieren, dass Identität aktueller denn je zu sein scheint. Dass sich das Wort „in unserer Alltagssprache geradezu epidemisch ausgebreitet“ hat,3 kann im Hinblick auf die (wissenschaftliche wie politische) Kritik des Konzepts in den letzten Jahrzehnten als [<< 55] backlash erscheinen: In Reaktion auf die umfassenden Verunsicherungen von Identität durch ,Postmoderne‘, Feminismus, Migration und Globalisierung sind individuelle wie kollektive Identitäten augenscheinlich wieder dringlich gefragt, nicht zuletzt in den ,alten‘ Formen z. B. ,starker‘ Männlichkeit oder nationalen Gedächtnisses. Zugleich ist festzuhalten, dass die gegenwärtige Konjunktur des Identitätsbegriffes teilweise auch als Resultat gerade seiner kritischen Diskussion in der Geschlechterforschung und parallelen Feldern (z. B. den postcolonial studies) angesehen werden kann.4 Sie reflektiert den transdisziplinären Triumphzug eines Themas, das auf komplexe Weise diskutiert wird: Die wissenschaftliche Frage nach Identität schließt heute die nach Differenzen ein. Es geht in der Regel nicht länger um stabile ,Wesenheiten‘, sondern um Prozesse der Identifizierung und der Herstellung von Zugehörigkeiten, die (z. B. in der kognitivistischen Theorie) wieder verstärkt positiv konturiert, aber auch als nicht-voraussetzbare und oft brüchige gedacht werden.
Vor dem Hintergrund dieses zwiespältigen Aktualitätsbefunds ist die Geschichte des Redens über Identität im Folgenden näher zu beleuchten. Zwei Hinweise sind einleitend noch erforderlich: Erstens sind Geschichten immer ein bisschen zu einfach. Wenn ich davon erzähle, dass Identität in der Theorie der Moderne eher positiv besetzt, in der der Postmoderne kritisiert worden ist – und ,nach der Postmoderne‘ vielleicht ein comeback erfährt, so ist ergänzend festzuhalten: Die gleiche Geschichte lässt sich auch als Geschichte andauernder Verhandlungen zwischen zwei Polen beschreiben. Historisch gesehen, stellt die Wende zum 19. Jahrhundert den Moment dar, in dem Identität auf neue, für die Moderne prägende Weise ins Spiel des Wissens gelangt ist. Die Zeit um 1800 ist die Geburtsstunde des Denkens in ,Geschlechtscharakteren‘, ,Rassen‘ usw., die als unveränderlich-,essentielle‘ gedacht und in der Natur der Menschen begründet wurden.5 Zugleich aber lässt sich auch der Beginn moderner Identitätskritik auf diesen Moment datieren: Kant, der als Anthropologe selbst an der Aufteilung der Menschen in ,Rassen‘ beteiligt war, formulierte als Erkenntnistheoretiker, dass Identität erst durch die Konstruktionsleistung eines denkenden Ich entsteht.6 Ähnliche historische und theoretische Verschlingungen der Bewegungen ,pro‘ und ,contra‘ Identität werden auch für die verschiedenen Momente des Nachdenkens über gender zu zeigen sein. Leicht zu [<< 56] Irritationen führen kann, zweitens, dass der Identitätsbegriff der Bezeichnung individueller ebenso wie kollektiver Formationen dient (einerseits der „Ich-Identität“, andererseits z. B. der gemeinsamen Identität von Frauen als Frauen). Beide Formen sind analytisch selbstverständlich unterscheidbar, fungieren in den Debatten um Identität über weite Strecken aber auf so eng verflochtene Weise, dass es mir nicht als sinnvoll erschien, sie für den Rahmen dieser Darstellung kategorisch zu trennen. Aufschlussreich ist vielmehr die Art und Weise, in der das ,Ich‘ und das ,Wir‘ jeweils miteinander verbunden werden.
Die folgende Kurzdarstellung wichtiger Stationen und Aspekte des Redens über Identität in der Geschlechterforschung schließt jeweils Verweise auf zentrale wissenschaftsgeschichtliche, d. h. hier philosophische und sozialwissenschaftliche Bezugspunkte ein. Sie geht von der Prämisse aus, dass die Identitätsdebatten in der Geschlechterforschung nicht von anderen wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen der Zeit getrennt werden können: Auf exemplarische Weise zeigt die Identitätsfrage, wie Gender@Wissen, d. h. als Schnittstelle jeweils aktueller inter / disziplinärer Konfigurationen funktioniert. Nicht weniger eng verflochten sind die Diskussionen um Identität mit den anderen theoretischen Feldern, die die folgenden Beiträge besprechen. So wurde bereits darauf verwiesen, dass Identitäten in der Moderne maßgeblich mit ,Natur‘ begründet worden sind und dass Gedächtnisprozesse einen zentralen Aspekt von Identitätsbildung darstellen. Nicht weniger grundlegend ist z. B., dass – vor allem individuelle, aber auch kollektive – Identitäten in der westlichen Tradition maßgeblich im Rekurs auf Körper(bilder) imaginiert worden sind (die wiederum eng mit ,Natur‘ zusammengedacht wurden). Die Liste wird fortzusetzen sein: Dieser und die folgenden Beiträge werfen einander ergänzende, unterschiedlich akzentuierte Blicke auf ein theoretisches Feld, auf dem sich die jeweils besprochenen Konzepte in komplexer Weise überlagern.