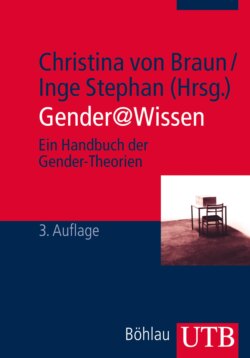Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 19
Das ,andere Geschlecht‘ auf dem Weg zur Subjektwerdung:
Simone de Beauvoir
ОглавлениеSimone de Beauvoirs Klassiker Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau (zuerst 1949) wurde Ende der 1960er zu einem zentralen Referenzpunkt der neuen Frauenbewegung. Auch hier kann ein Blick auf ihn helfen zu verstehen, worum es in Sachen Identität in der Geschlechterforschung geht – und woher diese Problemkonfiguration wissenschaftsgeschichtlich kommt. Schon der Titel von Beauvoirs Werk benennt die grundlegende Asymmetrie, die ihr zufolge das Verhältnis der Geschlechter [<< 57] charakterisiert: „Er ist das Subjekt, er ist das Absolute: sie ist das Andere.“ 7 Diese Begriffe entstammen dem Wortschatz G. W. F. Hegels, des einflussreichsten ,Identitätsphilosophen‘ des 19. Jahrhunderts. Bezugnehmend auf die Begriffe der antiken Logik, hat Hegel ein Denk,system‘ entworfen, in dem Identität, salopp formuliert, der Anfang und das Ende von allem ist. So erweist sich der Mensch, anthropologisch gedacht, im Unterschied zu Natur und Tieren dadurch als Mensch, dass er seine (virtuell immer schon gegebene) Identität als Bewusstsein seiner selbst, sich selbst in der ,reflektierten‘ Beziehung auf sich erfasst.8 Hegels idealistischer Philosophie zufolge besteht auch der Gang der Weltgeschichte in der Entfaltung dieses Selbstbewusstseins, das untrennbar mit ,Freiheit‘, Hegels zweitem Lieblingskonzept, verknüpft wird. Dieser Prozess aber erfordert eine Konfrontation des Selbst mit dem Anderen: Durch Differenzierung von ihm suchen das Subjekt wie der ,Weltgeist‘ ihre Selbstidentität zu beweisen. Auf der individuellen Ebene beschreibt Hegel diesen Prozess als Kampf zweier ,Selbstbewusstseine‘, durch den ein Herr-Knecht-Verhältnis etabliert wird. Beauvoir paraphrasiert: „das Subjekt setzt sich nur, indem es sich entgegensetzt: es hat das Bedürfnis, sich als das Wesentliche zu bejahen und das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu setzen.“ 9 Sowie: „Keine Gemeinschaft definiert sich jemals als das Eine, ohne sofort das Andere sich entgegenzusetzen.“ 10
Die Begriffe des Subjekts und des Anderen aber sind geschlechtlich codiert: Er identifiziert das Weibliche mit dem Anderen (und damit u. a. mit Natur und Körperlichkeit). So wird der ,Herr‘ durch Unterscheidung von ,der Frau‘ zum ,Menschen‘. Beauvoir verweist einleitend darauf, dass der Begriff homme im Französischen (wie man im Englischen) den „Mann“ mit dem „Menschen“ gleichsetzt.11 Ihr Werk ruft zur Überwindung dieser Kopplung auf, die der Frau den Zugang zur ,menschlichen‘ Kondition verstellt: Auch die Frau muss Subjekt werden. Dass dies möglich ist, begründet Beauvoir, indem sie sich – teilweise – von der Philosophie der Identität abgrenzt: Mit Hegels Worten akzentuiert sie gegen ihn, dass das ,Sein‘ der Geschlechter nur „geworden sein“ ist, Reaktion auf eine „Situation“ eher als „unbeweglich fixierte[…] Wesenheit“.12 Das heißt nicht, dass die Differenz der Geschlechter in der Gegenwart nicht real wäre. Doch – in den Worten, für die [<< 58] Beauvoir berühmt geworden ist – „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ 13 In diesem Sinne ist Beauvoirs Theorie ,anti-essentialistisch‘, nur sehr bedingt allerdings in dem Sinne, mit dem dieser Begriff in den Debatten der letzten Jahrzehnte meistens verknüpft worden ist: Die biologistische Argumentation, die seit dem 19. Jahrhundert das ,Wesen‘ des Geschlechts begründet hat, wird von ihr nicht (wie von vielen gender-Theoretikerinnen heute) direkt angegriffen, sondern nur in ihrer Bedeutung relativiert: Die „biologischen Voraussetzungen“ bilden kein „unausweichliches Geschick“, denn „die Definition des Menschen ergibt, dass er nicht ein gegebenes Wesen ist, sondern eines, das sich zu dem macht, was es ist.“ 14 Hier zeigt sich Beauvoirs Zugehörigkeit zur Philosophie des Existentialismus (Sartre, Merleau-Ponty und andere). Aus der Perspektive der „existentialistischen Ethik“ setzt sich das Subjekt in einem Akt der ,freien Wahl‘.15
Die ,Wahl‘ macht die ,biologisch gegebene‘ Geschlechtsidentität des Subjekts irrelevant, indem sie die ihm gegebene „autonome Freiheit“ 16 verwirklicht. Diese Freiheit aber bleibt, wie bei Hegel, auch hier mit der Vorstellung von Ich-Identität verknüpft: Die „ursprüngliche Intentionalität“ der Selbstsetzung garantiert, dass das „Seelenleben […] kein Mosaik, sondern „etwas Ganzes in jedem seiner Augenblicke“ ist.17 Das hier formulierte ,Identitätspostulat‘ wird in den Debatten der Geschlechterforschung eine zentrale Rolle spielen – ebenso wie die zweite Kopplung, die das ,Subjekt Ich‘ mit dem ,Subjekt Wir‘ verbindet: Im Vergleich mit der Situation der Schwarzen und Proletarier erklärt Beauvoir die spezifische Problematik der Frauenunterdrückung damit, dass „[d]ie Frauen“ nicht „wir“ sagen, sich nicht „zu einer Einheit […] sammeln“.18 Kurz: „sie setzen sich nicht eindeutig als Subjekt.“ 19