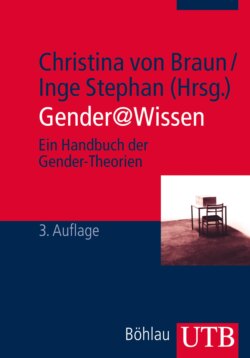Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 9
Gender@Wissen
Christina von Braun und Inge Stephan Wissensordnung und symbolische Geschlechterordnung
ОглавлениеAusgangspunkt des Buches ist die Frage nach dem Verhältnis von Wissen / Wissenschaft und Geschlecht. Die Aufsätze geben, in unterschiedlichen Varianten und bezogen auf ihre jeweiligen Themenfelder, Auskunft darüber, dass die Beziehung zwischen der Wissens- und der Geschlechterordnung unter dem Zeichen der Dichotomie Natur / Kultur oder Geist / Körper stand und steht – einer Dichotomie, die ihrerseits ein hierarchisches Verhältnis zwischen der gestaltenden Kultur und der zu domestizierenden oder gestalteten Natur implizierte. Diese Zweiteilung wurde wiederum ‚naturalisiert‘, indem in der symbolischen Geschlechterordnung den beiden Polen je ein Geschlecht zugewiesen wurde: Männlichkeit repräsentiert Geistigkeit und Kultur, während die Natur und der Körper als ‚weiblich‘ codiert wurden – eine Zuordnung, die sich bis weit in die Moderne hinein fortgesetzt hat und noch heute prägend bleibt für die Art, wie über ‚weibliche Irrationalität‘, Unberechenbarkeit und davon abgeleitet ‚Unwissenschaftlichkeit‘ gesprochen wird. Aber diese Dichotomie bildet nur den Ausgangspunkt unserer Überlegungen und der historischen Beziehung zwischen Wissens- und Geschlechterordnung. Auf diese erste ‚Setzung‘ folgte eine Entwicklung, die in den letzten zweihundert Jahren besonders deutlich zutage tritt und zu radikalen Umwälzungen auf beiden Gebieten führte. Eine der Grundannahmen unseres Buches ist die These, dass sich diese Gleichzeitigkeit der Veränderung nicht dem Zufall verdankt, sondern dass vielmehr eine enge historische und inhaltliche Verbindung zwischen dem Wandel der Wissensordnung und dem Wandel der symbolischen Geschlechterordnung besteht.
Die ‚traditionelle‘ Dichotomie Kultur versus Natur wurde in der Wissenschaft der Moderne zunehmend durch eine Spaltung in Natur- und Geisteswissenschaft überlagert – eine Spaltung, die ihrerseits auch in der symbolischen Geschlechterordnung ihren Ausdruck fand, gelten doch die Naturwissenschaften einerseits als hard sciences, andererseits aber auch als vornehmlich ‚männliche Fächer‘, während die Geisteswissenschaften gerne als ‚weiblich‘ gehandelt werden und in ihnen die Frauen sowohl unter den Lehrenden als auch unter den Studierenden tatsächlich stärker vertreten [<< 11] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe sind als in den Naturwissenschaften. Dass es sich bei dieser ‚geschlechtlichen‘ Aufteilung der Fächer nicht etwa um geschlechterspezifische Begabungen oder Interessen handelt, sondern um eine symbolische Zuordnung, geht freilich aus der Tatsache hervor, dass sich Frauen, als ihnen Anfang des 20. Jahrhunderts endlich der Zugang zu akademischer Bildung gewährt wurde, mehrheitlich für Medizin oder ein naturwissenschaftliches Fach entschieden, während die Geisteswissenschaften – etwa vertreten durch die Philosophie oder die Geschichte – am längsten zögerten, Frauen Zugang zu ihrem Wissen zu gewähren. Schon wenige Jahrzehnte später ist es genau umgekehrt. In den Naturwissenschaften stellen Akademikerinnen heute eher die Ausnahme dar, aber sie sind gut vertreten in den Geisteswissenschaften. Mit Begabungen lässt sich eine solche Entwicklung nicht erklären, eher mit geschlechtsspezifischen Codierungen der Wissensordnung. Ein ähnlicher Wandel vollzog sich später noch einmal mit der Informatik. Als das Fach in den 1960er-Jahren an einigen Universitäten eingerichtet wurde, gab es zunächst wenige Frauen. Ab Anfang der 1980er-Jahre begann der Anteil rasch zu wachsen, um den für ein Ingenieurstudium ungewöhnlich hohen Frauenanteil von über 20 Prozent zu erreichen, bevor er gegen Ende der 1980er-Jahre wieder sank. Empirische Untersuchungen zu diesem Phänomen haben gezeigt, dass sich solche Schwankungen weder mit einer erworbenen oder angeborenen technizistischen Defizienz von Frauen erklären lassen noch mit unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen der Geschlechter.1 Vielmehr, so scheint es, haben sie mit der Wissensordnung selbst zu tun – und deren wechselhaften geschlechtlichen Codierungen.
Betrachtet aus dem Winkel der ‚ursprünglichen‘ Dichotomie der Wissensordnung impliziert die ‚Vermännlichung‘ der Naturwissenschaften und die ‚Verweiblichung‘ der Geisteswissenschaften, dass sich eine komplette Umkehrung der alten Ordnung, die Männlichkeit mit ‚Geistigkeit‘ und Weiblichkeit mit ‚Naturhaftigkeit‘ gleichsetzt, vollzogen hat, erscheint doch Männlichkeit nun in Zusammenhang mit Natur, während die ‚Kultur‘ als ‚weiblich‘ daherkommt. Man könnte diesen Wandel mit einer generellen Aufhebung symbolischer Zuordnungen von Wissensgebieten an die beiden Geschlechter erklären. Aber dagegen spricht die Tatsache, dass symbolische Zuordnungen weiterhin stattfinden – nur eben unter umgekehrten Vorzeichen. So besteht die Erklärung für den Wandel vielleicht eher darin, dass den Begriffen ‚Natur‘ und ‚Kultur‘ (oder Körper und Geist) eine neue Stellung in der Wissensordnung eingeräumt wurde. Dass sich ein solcher Wandel auch tatsächlich vollzogen hat, ist unübersehbar. Noch [<< 12] bis ins 17. und 18. Jahrhundert galt an den europäischen Universitäten die theologische Fakultät als die wichtigste, wenn nicht gar die ganze Universität aus der Theologie bestand. Von der Theologie gingen die Grundsätze aus, nach denen die Wissenschaft zu funktionieren und ihre Erkenntnisfortschritte zu erzielen hatte. Nach dem Beginn der Neuzeit und vor allem mit der Aufklärung ging diese Aufgabe zunächst auf die Philosophie und die Geschichtswissenschaft über – diese beiden großen Fächer, in denen über den ‚Sinn‘ und die Sinngebung der nationalen Gemeinschaften reflektiert wurde. Fragt man heute, welche Fakultäten und Fächer der Universität als ‚Leitwissenschaften‘ zu betrachten sind, so wird ein naturwissenschaftliches Fach wie die Biologie oder die Medizin genannt. Der Grund dafür ist paradox: Einerseits sind diese Fächer zu Leitwissenschaften geworden, weil es sich um hard science handelt, das heißt, um Disziplinen, die mit quantifizierbaren und (jedenfalls meistens) verifizierbaren bzw. falsifizierbaren Methoden arbeiten. Andererseits sind sie aber auch deshalb zu Leitwissenschaften geworden, weil das alte Projekt der Unsterblichkeit – das einst der Theologie vorbehalten blieb, dann als Phantasie vom ‚Weltgeist‘ auf die Philosophie oder als Topos der ‚unsterblichen Nation‘ auf die Geschichte übergegangen war –, weil also das Projekt der Unsterblichkeit heute mit Vorliebe auf die natur- und medizinwissenschaftlichen Erkenntnisse setzt. Am deutlichsten lässt sich das erkennen an den Genwissenschaften, bei denen nicht nur die Metaphorik, sondern auch die der Wissenschaft selbst zugrunde liegenden Paradigmen eine bemerkenswerte Analogie zu christlichen Denktraditionen aufweisen.
Die ‚Verweiblichung‘ der Geisteswissenschaften ließe sich auch mit der Verdrängung dieser Fächer ins Abseits erklären – und diese Erklärung ist auch immer wieder zu hören. In der Tat ist zu beobachten, dass Frauen zunehmend Aufnahme in den Gebieten finden, die ihre ‚Macht‘ über den öffentlichen Diskurs verloren haben; wie umgekehrt auch aus Gebieten, die von Frauen ‚besetzt‘ werden – etwa die Pädagogik und das Lehramt – ein Exodus von Männlichkeit stattfindet. Befriedigend ist diese Deutung allerdings nicht, liefert sie doch keine Erklärung dafür, warum zeitgleich ein Wandel der ‚Wissenshierarchie‘ überhaupt stattgefunden hat, der von der Theologie über die Geschichte / Philosophie bis zu den Naturwissenschaften führte. Geht man zudem davon aus, dass jede geschlechtliche Zuordnung nicht nur die Folge neuer wissenschaftlicher oder medialer Paradigmen ist (die Medien sind deshalb so wichtig, weil sie über die Speichersysteme und damit auch über die Trennung zwischen Wissen und Nicht-Wissen bestimmen), sondern auch der Naturalisierung der Wissensordnung zu dienen hat, so stellt sich die Frage nach der geschlechtlichen Zuordnung der Wissensfelder auf ganz andere Weise. Denn dann ist danach zu fragen, welcher Art die ‚Ordnung‘ ist, die hier naturalisiert werden soll, und in welcher Weise dies geschieht. [<< 13]