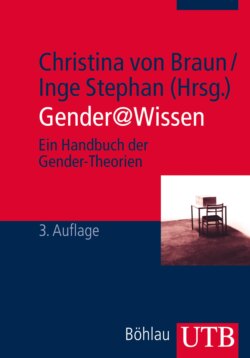Читать книгу Gender@Wissen - Группа авторов - Страница 21
(Weibliche) Differenz: Der ,französische‘ Feminismus
ОглавлениеAuf etwas andere Weise hat die Vorstellung von Weiblichkeit im Zeichen der Differenz von der männlichen Norm / alität auch den sogenannt ,französischen‘ Feminismus geprägt, der insbesondere mit den Namen von Hélène Cixous, Luce Irigaray und Julia Kristeva verknüpft ist.33 Obgleich die wichtigsten Schriften dieser Autorinnen schon in den 1970er-Jahren zeitlich parallel zu den eben diskutierten Feminismen entstanden, wurde die Theorierichtung im anglo-amerikanischen und deutschsprachigen Raum erst in den 1980er-Jahren auf breiter Basis rezipiert und – in den Literatur-, weniger den Sozialwissenschaften – vorübergehend zum hegem [<< 62] onialen Paradigma. Der grundlegende Unterschied dieser Theorierichtung von den eben besprochenen Ansätzen besteht in der Zugehörigkeit der Autorinnen zum Poststrukturalismus. Dieser nimmt erneut Bezug auf die philosophische (eher denn die aktuellere sozialwissenschaftliche) Tradition des Nachdenkens über Identität, macht dabei aber die Kritik der Identität als solcher zum Leitmotiv: Im Zeitalter der ,Postmoderne‘ wird die abendländische Philosophiegeschichte auf ihre Identitätsphantasmen hin befragt. Paradigmatisch für dieses Projekt steht insbesondere der Name Jacques Derridas, als eine wichtige Station auf dem Weg zu ihm ist aber zuvor Jacques Lacan zu besprechen.
Lacans Psychoanalyse konstituierte sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Abgrenzung von der zeitgenössischen amerikanischen Ich-Psychologie, deren Akzentuierung personaler Identität für ihn einem Verrat an Freud gleichkommt. Lacans eigene Theorie ist ihm zufolge eine Rückkehr zu Freud 34 – allerdings auf strukturalistischer Grundlage: Anstelle der Biologie tritt die Sprache, anstelle des Penis, der bei Freud die Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz prägt, der ,Phallus‘ als ein Signifikant (d. h. ein ,Bezeichnendes‘, oder: ,Wortkörper‘). Lacan knüpft hier an Ferdinand de Saussures strukturalistisches Zeichenmodell an, das Bedeutung (sprich: ,Identität‘) als den Effekt differentieller Anordnung von Signifikanten beschreibt. Dabei verunsichert Lacan allerdings den Prozess der Bedeutungskonstitution, indem er den Signifikanten anders als Saussure über das Signifikat (das ,Bezeichnete‘) setzt und die Instabilität der Beziehung zwischen beiden im – andauernden – Spiel der Signifikation akzentuiert. Identität ist für Lacan auf der Ebene dessen zu verorten, was er ,das Imaginäre‘ nennt. Frei nach, einmal mehr, Hegel akzentuiert er, dass sich der Mensch nur in der Beziehung zu einem anderen als Einheit wahrnimmt, bzw. in der Lacanschen Radikalisierung: verkennt. Lacan beschreibt diesen Prozess als das ,Spiegelstadium‘, wobei in der kleinfamiliären Sozialisation z. B. die Mutter als Spiegel funktioniert. In anderen Worten: Identität ist notwendig phantasmatisch. Das gilt auch für die Geschlechtsidentität, die Lacan im Zeichen der ,Maskerade‘ bespricht – einerseits. Andererseits behauptet er, dass die Geschlechterdifferenz im unbewussten Sprechen des Subjekts (wo ihm zufolge dessen ,Wahrheit‘ liegt) eine entscheidende Rolle spielt, und schreibt dem Phallus im Spiel der Signifikation eine privilegierte, strukturierende Rolle zu. Auch wenn Lacan darauf beharrt, dass der Phallus nicht mit dem Penis zu verwechseln ist, lässt sich dieser ,Herrensignifikant‘ doch gedanklich nicht ohne weiteres vom Bild des [<< 63] männlichen Organs lösen.35 Wie bei Freud spielen so auch bei Lacan Vorstellungen von der biologischen Differenz zwischen den Geschlechtern – und die korrespondierenden Identitätsphantasmen des ,männlichen‘ Phallusbesitzes – eine entscheidende Rolle für die Struktur unserer Wahrnehmung und unseres Begehrens.
Dass dem Phallus bei Lacan nicht zu entkommen ist, hat Derrida als Ausdruck des ,abendländischen Phallogozentrismus‘ kritisiert (logos: griech. u. a. ,Gedanke‘, ,Vernunft‘, auch ,Wort Gottes‘). Seine poststrukturalistische Theorie radikalisiert die Idee des andauernden, nie Bedeutungen fixierenden Spiels der Signifikation im Namen der (mit seinem Kunstwort) différance, die jeden Sprechakt markiert.36 Die abendländische Philosophiegeschichte verbleibt Derrida zufolge demgegenüber im Bann der Identität – oder, wie er auch formuliert, der ,Metaphysik der Präsenz‘. Er untersucht diese Identitätsproduktion als Prozess, der auf einer Reihe binärer, hierarchischer Oppositionen beruht: Begriffspaare wie Mündlichkeit und Schrift sowie – uns mittlerweile vertraut – Geist und Natur bzw. Körper, Selbst und Anderes, Männlichkeit und Weiblichkeit dienen einer Ordnungswut, die bei Derrida allerdings letztlich nicht gegen die überlegene Macht des Spiels der différance ankommt. Für seine eigene Praxis der ,Dekonstruktion‘ des Identitätsdenkens spielt die Geschlechterdifferenz wiederum eine tragende Rolle: Derrida plädiert für eine strategische Inanspruchnahme des abgewerteten, am ,anderen‘ Pol der hierarchischen Oppositionen verorteten Weiblichen. Dieser Vorschlag basiert auf der Annahme, dass dieses ,Andere‘ aufgrund seines Ausschlusses aus der ,phallogozentrischen‘ Ordnung als ,Drittes‘, nämlich Kraft der Zerstörung des oppositionellen Systems funktionieren kann. Derrida entwickelt diese Idee anhand von Nietzsches Weiblichkeitskonzept, wo Weiblichkeit u. a. mit ,Hysterie‘ assoziiert wird. Die so charakterisierte ,weibliche Schreibweise‘ ist nicht mit dem Schreiben realer Frauen zu verwechseln. Auch Derrida aber arbeitet – unter Verkehrung der Vorzeichen – mit ,herrschenden‘ Vorstellungen von Geschlechterdifferenz, die so gedanklich fortgeschrieben werden.
Hélène Cixous knüpft am direktesten an Derrida an. Aus feministischer Perspektive richtet sie den Blick vor allem auf die Opposition ,Männlichkeit – Weiblichkeit‘ und akzentuiert die ,phallogozentrische‘ Kulturgeschichte derart als Geschichte der Unterdrückung des Weiblichen. Als kritisches Gegenprinzip arbeitet Cixous die [<< 64] Vorstellung einer weiblichen Ökonomie des Begehrens – und Schreibens – aus, die das Regime der Identität destruiert.37 Charakterisiert durch Sinnlichkeit ebenso wie eine Ethik der Gabe, macht diese Ökonomie im Ich „die Vielheit von Stimmen des Anderen“ hörbar.38 Wie bei Derrida ist diese écriture féminine erklärtermaßen nicht mit dem Schreiben realer Frauen zu verwechseln. Zugleich aber wird sie hier doch essentialistisch begründet: Cixous bindet sie eng an weibliche Erfahrung und die ,dezentrierte‘ Libido von Frauen zurück.
Luce Irigaray nimmt stärker auf die Psychoanalyse Bezug als Cixous, stellt das Denken Freuds und Lacans dabei aber mit Hilfe poststrukturalistischer Überlegungen auf den Kopf: In Speculum analysiert sie die psychoanalytische, und allgemeiner: abendländische Ökonomie der Repräsentation als eine, die vom „Begehren nach dem Selben“, einem „Traum von Identität“ beherrscht ist.39 In dieser Ökonomie (sprich: unter der Vorherrschaft des Phallus) kann sexuelle Differenz nicht repräsentiert werden; Weiblichkeit erscheint nur im Zeichen des (Penis- / Phallus-)Mangels. Gerade als das ,Nicht-Repräsentierbare‘ jedoch wird Weiblichkeit hier, analog zu Derridas und Cixous‘ Überlegungen, im zweiten Schritt zu einer ,dritten‘ Kraft, die die ,phallogozentrische‘ Sinnproduktion verstören kann. Im Rekurs auf anatomische Metaphern (,zwei sich berührende Schamlippen‘) beschreibt Irigaray das weibliche Geschlecht als ,das Geschlecht, das nicht eins ist‘.40 Auch diese essentialistische Bestimmung von Weiblichkeit ist als biologistisch kritisiert, von anderer Seite allerdings als ,strategische‘ verteidigt worden.41 In jedem Fall bleibt festzuhalten, dass die (über alle anderen Differenzen privilegierte) Geschlechterdifferenz auch im Zeichen poststrukturalistischer Identitätskritik hier letztlich wieder zur Basis eines „Identitätskonzept[s]“ 42 wird. [<< 65]