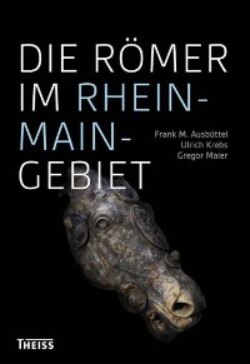Читать книгу Die Römer im Rhein-Main-Gebiet - Группа авторов - Страница 12
Fazit
ОглавлениеIn Deutschland war die Erforschung der frühen römischen Phase stark geprägt durch militärhistorische Forschungen zum Limes ab dem 19. Jahrhundert. Ausdruck dieses Interesses war die 1890 gegründete Reichslimeskommission. Erste historische Untersuchungen zur Okkupation Germaniens in augusteischer Zeit galten den überlieferten Ortsnamen und den Wegen, die das römische Militär in Germanien benutzt haben könnte (Haltern: 1938 der preußische Major G. F. W. Schmidt). Mit der archäologischen Ausgrabung des Legionslagers von Haltern am See seit 1899 konnten die ersten Bodenbefunde diesem Zeithorizont zugewiesen werden. Dort erbrachten neuere Forschungen erste Hinweise auf eine Zivilisierung des Ortes, was sowohl an der Umgestaltung von Architektur als auch in der Produktion von Keramik über den lokalen Gebrauch hinaus festzumachen ist. Die Verbreitung von Keramik, die in Haltern hergestellt wurde, reicht von Westfalen bis nach Mittelhessen, wo auch zum Beispiel unter der Keramik, die in Waldgirmes gefunden wurde, solche Stücke vertreten sind.
Im Zusammenhang mit der zivilen Nutzung der neu eroberten Gebiete sind auch Bleibarrenfunde zu sehen, die belegen, dass römische Händler, die offenbar nicht dem römischen Militär unterstanden, Blei aus der Germania exportierten. Sie besaßen also zumindest die Handels-, vielleicht auch die Schürfrechte an den germanischen Vorkommen. Die Rechtsverhältnisse in den Eifeler Basaltvorkommen hingegen sind im Einzelnen noch unklar, allerdings zeigt sich auch an diesen bereits in vorrömischer Zeit zur Anfertigung von Mühl- und Mahlsteinen genutzten Basaltvorkommen die auf die kontinuierlich weiterlaufende Ausbeutung von Ressourcen ausgerichtete pragmatische Politik der Römer. Dort wie auch bei der Eisengewinnung etwa im Lahntal zeichnet sich eine durchgehende Nutzung ab, die offenbar nicht von wechselnden Herrschaftsverhältnissen wesentlich unterbrochen wurde. Im Lahntal zeigen dies die Ausgrabungen in Wetzlar-Dalheim, wo in den letzten Jahren eine entsprechende Verhüttungsstelle der Jahrhunderte um Christi Geburt untersucht wurde oder auch die aktuellen Untersuchungen der römischen Anlage bei Oberbrechen am Rand des Limburger Beckens.
Mit Waldgirmes ist ein weiterführender Pfad der Provinzialisierung erstmals archäologisch in dieser Eindeutigkeit fassbar: die Ansiedlung von der römischen Führung vertrauten Menschen in neuen Zentren. Diese Menschen, seien es Veteranen oder Zivilisten, eine neue konforme einheimische Elite oder verdiente Auxiliare auf dem Weg zur staatstragenden Elite der neuen Provinz, also gleich ob Fremde oder Neusiedler mit einheimischen Wurzeln, sie wurden zur Verwaltung des neu eroberten Territoriums in neuen Zentren angesiedelt. Hierin unterscheidet sich das Vorgehen in der Germania nicht von dem in der 146 v. Chr. eroberten Gallia Cisalpina oder andernorts. Über die Rechtsstellung der römischen Siedlung in Waldgirmes und die Größe ihres Territoriums ist wegen fehlender Schriftzeugnisse keine Aussage möglich. Mit einer Siedlungsfläche von rund 7,5 ha innerhalb der Umwehrung ist in Waldgirmes bei einer gleichmäßigen Bebauung mit einer Anzahl von etwa 250 bis 300 Menschen zu rechnen. Ob es sich dabei um verdiente Veteranen, römische Händler oder sich konform verhaltende Einheimische gehandelt hat, diese Frage muss so lange offenbleiben, wie keine weiteren Schriftzeugnisse – abgesehen von den drei bekannten Graffiti auf Keramik – zutage gefördert werden.
Das politische und militärische Wirken Roms auf neu unterworfene Völkerschaften war ganz entscheidend von dem persönlichen Verhältnis zwischen der einheimischen Führungsschicht und dem Stellvertreter Roms am Ort abhängig. Davon zu trennen war die Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung, eigene Identitäten in ihrer Tracht oder ihrer Lebensweise bewahren zu wollen. Für die römische Seite bildeten die wichtigsten Voraussetzungen für die (dauerhafte) Kontrolle eines neu eroberten Gebietes natürlich die Anerkennung des römischen Rechts durch die einheimische Bevölkerung, das Zahlen von Steuern und die Gestellungen von Truppen. Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, konnten Bewohner des römischen Herrschaftsgebiets ihre Eigenständigkeit im Äußeren bewahren, die sie für die Archäologie insbesondere in der Fibeltracht als Fremde erscheinen lässt. Frank Kolb konstatierte:
Die Römer bemühten sich mit Erfolg, die einheimische Führungsschicht für die Annehmlichkeiten der römischen Zivilisation zu gewinnen. Wichtigstes Element dieses Romanisierungsprogramms war der Import römischer urbaner Architektur.6
Die Römer bildeten mit Gründungen wie Waldgirmes neue Zentren „als Instrumente provinzialer Verwaltung und imperialer Herrschaft“ (F. Kolb), die als Verwaltungszentren auch der kleinteiligen einheimischen Siedlungsstreuung entgegenwirken und wesentlich zur Bevölkerungskonzentration beitragen sollten. Einen Anfang solcher Urbanisierung in ihrer Entstehungszeit brachten die Ausgrabungen in Waldgirmes zutage, die Vorgehensweise ist aber gut vergleichbar mit allen Regionen, die eine auf zentrale Städte ausgerichtete Territorialverwaltung in vorrömischer Zeit nicht kannten. In großen Teilen Hessens und sicherlich auch in weiteren Gebieten zwischen Rhein und Weser hatten die Römer die Voraussetzungen geschaffen, als in Rom 16 n. Chr. der Plan aufgegeben wurde, die Germania bis zur Elbe in das Provinzialsystem einzugliedern.