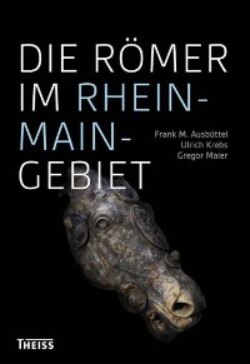Читать книгу Die Römer im Rhein-Main-Gebiet - Группа авторов - Страница 9
Die Germanienpolitik des Augustus
ОглавлениеSeitdem Iulius Caesar im Jahr 51 v. Chr. die Eroberung Galliens abgeschlossen hatte, trat das Gebiet rechts des Rheins – die Germania magna – in den direkten Blickpunkt des politischen Interesses der Römer. Zwar gab es zuvor schon teils kriegerische Kontakte mit germanischen Gruppen (58 schlägt Caesar die germanischen Sueben unter Ariovist bei Mühlhausen im Elsass), doch eine dauerhafte Inbesitznahme germanischer Gebiete rechts des Rheins war offenbar nicht Ziel der römischen Politik. Vielmehr galten die von Caesar überlieferten Rheinübergänge als Strafaktionen und dienten dem Schutz der gallischen Gebiete. So wurden die germanischen Usipeter und Tenkterer 55 v. Chr. am Niederrhein zurückgedrängt und der darauf folgende erste Rheinübergang bei Neuwied demonstrierte rechtsrheinisch die Stärke und Macht der Römer. Auch der zweite Rheinübergang Caesars zwei Jahre später bei Andernach diente demselben Ziel. In den Jahren 52/51 v. Chr. besiegte Caesar die letzten keltischen Stämme, die sich gegen ihn erhoben hatten, und im Jahr 50 v. Chr. werden von römischer Seite erste Maßnahmen durchgeführt, um die Gallia als Gallia comata und Gallia Transalpina in die Provinzialverwaltung des römischen Reiches einzugliedern. Erst nach dem Bürgerkrieg, der nach der Ermordung Caesars 44 v. Chr. ausbrach und bis 30 v. Chr. andauerte, wird ab 27 v. Chr. das Gebiet mit der Aufteilung in die Tres Galliae (Lugdunensis, Belgica und Aquitania) neu geordnet. Trotzdem kommt es in der Folge im Alpengebiet, in Gallien und am Rhein wieder zu Aufständen und germanischen Raubzügen in die Gallia hinein, was es Marcus Vipsanius Agrippa notwendig erscheinen ließ, in den Jahren 20/19 v. Chr. Lugdunum (Lyon) zu einem Verkehrsknoten und Verwaltungszentrum auszubauen.1 Immer wiederkehrende Einfälle von germanischen Scharen nach Gallien und die Niederlage des Marcus Lollius Paulinus gegen Sugambrer, Usipeter und Tenkterer (clades Lolliana) 16 v. Chr. führten in der Folge zur Verlagerung der Residenz des Augustus nach Lugdunum. Mit der Errichtung des Provinzialkultes ebendort im Jahr 13/12 v. Chr. wird diese Stadt zur politischen und wirtschaftlichen Drehscheibe für ganz Gallien, aber auch für den Aufbau und die Versorgung der Rheinzone und die späteren Kriegszüge nach Germanien. Die Sicherung und Neuordnung Galliens war die unabdingbare Voraussetzung für die Eroberung der Alpenregion und Germaniens.
Für die Eroberung und Kontrolle Galliens war die Kooperation einer einheimischen Führungsschicht von entscheidender Bedeutung, denn die römischen Legionen und die bereitstehenden Auxiliartruppen hätten nicht ausgereicht, um alle notwendigen Schaltstellen dauerhaft zu besetzen. Deshalb suchten Caesar und später Augustus gezielt den Kontakt zu lokalen und regionalen Eliten, die Verwaltungs- und Militäraufgaben, aber auch die Priesterämter am Altar für Roma und Augustus übernehmen konnten und damit die Besatzung für weite Teile der einheimischen Bevölkerung erträglicher machten. Sehr detailliert beschreibt Caesar in seinem Werk De bello Gallico das wirksame Werkzeug der amicitia, mit dem sehr flexibel, an einzelne Persönlichkeiten gebunden, auf innerfamiliäre Verwerfungen auf einheimischer Seite ebenso reagiert werden konnte wie auf unklare Verhältnisse innerhalb eines oder zwischen verschiedenen Stämmen beziehungsweise Stammesteilen.
Mit dem Alpenfeldzug des Jahres 15 v. Chr. schließlich wurden die Verbindungen zu den bereits unter römischer Herrschaft liegenden Gebieten an Oberrhein und Donau hergestellt, die Einfallsrouten nach Oberitalien gesichert und die Erzvorkommen der Alpen für die Römer zugänglich. Folgt man neueren Forschungen von Nuber, so nahm Publius Quinctilius Varus vermutlich als legatus legionis der XIX. Legion am Alpenfeldzug teil. Er hätte dort, so macht Nuber wahrscheinlich, siegreich das Kommando der XIX. Legion geführt, die ihm auch zwanzig Jahre später in Germanien unterstehen sollte. Mit der Sicherung der Alpenregion trat nun der dauerhafte Schutz der gallischen Gebiete gegen die immer wieder von Osten in die Provinzen eindringenden Scharen.
Bereits zwischen 35/25 v. Chr. hatte Agrippa, so die historische Überlieferung, verschiedene rechtsrheinischen Stämme auf das linke Rheinufer umgesiedelt. Diese Tatsache zeigt deutlich die Informationsdichte, die die Römer über die Landschaften rechts des Rheins und die innergermanischen Zwistigkeiten besaßen, obwohl diese Region nicht unter ihrer direkten Herrschaft stand. Deshalb erscheint es auch völlig unwahrscheinlich, dass sich Varus auf den Römern unbekannte Pfade begeben habe, wie es Tacitus überliefert, denn Kenntnis über die naturräumlichen Bedingungen war eine der wichtigsten Voraussetzungen, um eine Region erobern und kontrollieren zu können. Mindestens seit dem letzten Viertel des 1. Jahrhunderts v. Chr. müssen wir also von einer gezielten Vorgehensweise der Römer rechts des Rheins ausgehen. Die Offensive der Jahre 12 bis 9 v. Chr. unter Führung des Drusus war nach der Neuordnung Galliens ein folgerichtiger Schritt. Diese Kriegszüge gelten heute als Ausdruck für den politischen Gestaltungswillen der Römer, die Landschaften zwischen Rhein und Elbe dauerhaft in Besitz zu nehmen.2
Abb. 1 Karte der augusteischen Fundplätze.
Die Erfahrungen der römischen Kriegsherren – Augustus sowie seiner Stiefsöhne Tiberius und Drusus – mit nördlichen Völkern unterschieden sich aber offenbar von den Verhältnissen in Gallien und Noricum ganz wesentlich. Offenbar standen sie nicht einem stabilen Stammessystem gegenüber, sondern einer wesentlich stärker segmentär organisierten Bevölkerung, was sich auch in einem kleinteiligeren Siedlungswesen zeigte. Denn archäologisch gelang bisher nicht der Nachweis großer Siedlungen, die als einheimische Zentralorte – von Caesar oppida genannt – fungiert haben könnten. Damit war eine wesentliche Infrastruktur zur Versorgung der Truppen nicht gegeben, beziehungsweise mussten die Römer diese für die Logistik notwendigen Orte selbst aufbauen (Abb. 1).
Die Landschaft rechts des Rheins, durch die die römischen Heere ziehen mussten, war jedoch, wie archäologische und palynologische Untersuchungen zur vorrömischen Eisenzeit in unserer Region zeigen, in weiten Bereichen aufgelichtet und erschlossen. Die reichlich vorhandenen Ressourcen an Eisen und in geringerem Ausmaß an Silber und Kupfer, aber auch an Salz wurden seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. kontinuierlich zunehmend genutzt. Manche Beschreibungen von Barbaren (besonders Germanen) und den ihnen eigenen Landschaften, die in antiken Schriftquellen dieser Zeit überliefert sind, wie „unzivilisierte und kriegerische Barbaren“, aber auch „undurchdringliche Wälder und unpassierbare Sümpfe“, sind als literarische topoi zur Beschreibung fremder Völker und Landschaften zu bewerten. Die römische Seite war sicher seit den ersten Rheinübergängen durch Caesar sehr wohl über die landschaftlichen Gegebenheiten, die sicher existierenden Fernwege, wichtige strategische Orte, die wirtschaftlichen Ressourcen und die Hierarchie der Völker bestens informiert. Solche Informationen waren unabdingbare Voraussetzungen für die groß angelegten Kriegszüge des Drusus in die Germania. Als der Stiefsohn des Augustus auf dem Rückweg von der Elbe vom Pferd stürzte und wenig später seinen Verletzungen 9 v. Chr. erlag, übernahm Tiberius seine Aufgaben in Germanien, nachdem er den Leichnam des Drusus nach Rom gebracht hatte.3