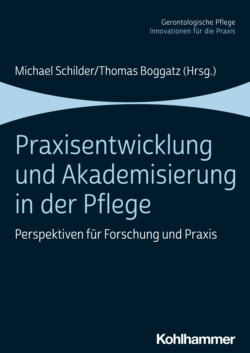Читать книгу Praxisentwicklung und Akademisierung in der Pflege - Группа авторов - Страница 15
1.2 Das Verhältnis von Theorie und Praxis in der pflegewissenschaftlichen Diskussion
ОглавлениеEine ganze Reihe von Pflegetheoretikerinnen hat ihr Augenmerk darauf gelegt Theorien zu entwickeln, die letztlich in die Praxis überführt und diese mit einer bestimmten Agenda verknüpfen sollen; die sog. »grand theories« (z. B. King, Peplau, Orem, Rogers) sind nur ein Beispiel. Die später als »middle range« (Mishel’s uncertainty in illness, Norbeck’s model for social support, Swanson’s theory of caring) oder als »situation specific« (die vor allem auf klinische Herausforderungen im engeren Sinne fokussiert sind) ausbuchstabierten theoretischen Ansätzen zeigen, dass die Theorieentwicklung in den USA elaboriert und weit fortgeschritten ist (für einen Überblick vgl. Nicoll 1997, Reed et al. 2012; für die dt. Diskussion vgl. z. B. Schröck & Drerup 1997, Moers & Schaeffer 2000, Brandenburg & Dorschner 2021).
Es lassen sich eine ganze Reihe von theoretischen Überlegungen zusammenfassen, welche die Trennung von Theorie und Praxis akzentuiert haben. Hier wurde postuliert, dass die theoretischen Positionen noch nicht ausreichend spezifiziert wurden, um einen body of knowledge für die Pflege zu generieren. Pflege(-wissenschaft) – so die Annahme – kann noch nicht als Kompass für eine veränderte Praxis angesehen werden, denn: »the practice of nursing is still directed by medical orders and institutional policy rather than beeing grounded in the findings of nursing reasearch (Jacobs & Huether 1978, S. 67). Als zentrale Barrieren wurden die fehlende Bereitschaft für die Aufnahme neuer Ideen in der Praxis, die zunehmende Diversität im Pflegesektor sowie ein Anti-Intellektualismus identifiziert. Man kann aber auch das Trennungsargument seitens der Praxis stark machen. So hat z. B. Smith eindeutig Stellung bezogen und die Frage gestellt, warum eigentlich Pflegende an der Basis »must be afflicted with baroque nursing theories couched in stilted pseudo-intellectual jargon … Who, besides academic luminaries, benefits from this blizzard of inflated words?« (Smith 1981, S. 83).
Umgekehrt gab es aber immer wieder Stimmen, welche die Verbindung von Theorie und Praxis stark gemacht haben. Am bekanntesten ist Fawcett, die auf den Einfluss von konzeptionellen Modellen auf das Setting, den Pflegeprozess, Pflegefachsprachen sowie Patientenklassifikationssysteme und Qualitätsprogramm verwiesen hat (Fawcett 1992) und immer weder die Relevanz von theoretischen Überlegungen für eine evidenzbasierte Pflegepraxis betont hat (Fawcett et al. 2001). Ebenfalls hat sich diese Autorin – vor allem an die bahnbrechenden Arbeiten von Silva in den 1980er Jahren zur Testung von Pflegetheorien – mit diesem Problem beschäftigt und eine entsprechende Kriterienliste vorgelegt (Fawcett 2005). Andere Autor/-innen gehen noch einen Schritt weiter und postulieren, dass »theory is born in practice, is refined in practice, and must and can return to practice« (Dieckhoff et al. 1968a, S. 415). Voraussetzung dafür ist aber eine Offenheit für empirisch relevante Inhalte; die Zusammenarbeit von Theoriebildung und erfahrener Pflegexpertise vor Ort ist in diesem Ansatz zwingend.
Beide Positionen – sowohl die Trennungs- wie auch die Verbindungsprotagonisten – sind nur oberflächlich gesehen grundlegend verschieden und befürworten letzten Endes eine Anwendung bzw. einen Transfer von theoretisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis (alles andere würde ja auch in einer Praxiswissenschaft keinen Sinn machen). Und wie das geschieht, ist ebenfalls Teil einer Forschungsagenda, die in Deutschland als »Implementierungswissenschaft (IW) für Gerontologie und Pflege« (Hoben et al. 2016; vgl. auch McCormack et al. 2013) bekannt geworden ist. Hier geht es um Einflussfaktoren, konkrete Modelle und bereits vorliegende Erfahrungen zur praktischen Umsetzung von klinischen Innovationen in der Pflegepraxis (Beispiele: Schmerzmanagement, Mobilitätsförderung, Medikamentenregime etc.). Bezogen auf die deutsche Situation ist der Verweis auf die »Expertenstandards in der Pflege« angebracht, von denen mittlerweile eine zweistellige Zahl vorliegt. Man muss allerdings nüchtern feststellen, dass der Forschungsstand einer Implementierungswissenschaft nahezu ausschließlich international geprägt ist. In Deutschland kann man die entsprechenden Arbeiten an einer Hand abzählen. Hier ist es jedenfalls bis jetzt nicht gelungen, auch nur ansatzweise einen eigenen Forschungsfundus zur Umsetzung von wissenschaftlichen Befunden in die Pflegepraxis zu etablieren.
Die Gründe hierfür können an dieser Stelle nicht diskutiert werden, vielmehr möchte ich mich der zweiten Frage zuwenden, die da lautet: Wie stellt sich das Verhältnis von Theorie in der Logik der jeweiligen Systeme dar?