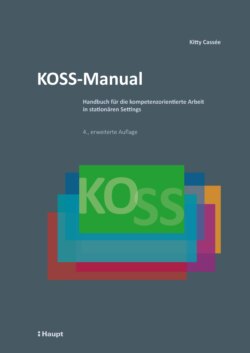Читать книгу KOSS-Manual - Kitty Cassée - Страница 10
1.2 KOSS ist eine Methodik
ОглавлениеKOSS ist eine Methodik und stellt eine innovative Entwicklung für die stationäre Arbeit dar. Eine Methodik ist ein theoretisch begründetes Handlungsmodell, das von einer Forschungsstelle als «Halbfertigprodukt» entwickelt und in einem koproduktiven Prozess zusammen mit Praxisorganisationen umgesetzt und weiterentwickelt wird. Aktuelle Erklärungs- und Handlungstheorien werden ausgewählt, aufeinander bezogen und in Form von Arbeitsinstrumenten, Rastern, Checklisten und Berichtsvorlagen für den gesamten Hilfeplanungsprozess aufbereitet und den Fachpersonen für die konkrete Klientenarbeit zur Verfügung gestellt (vgl. Cassée, 2019b).
Definition
Unter einer Methodik verstehen wir ein theoretisch begründetes Handlungsmodell, das als Standard bei mehreren Leistungserbringern vergleichbar zur Anwendung kommt. Eine Methodik umfasst Arbeitsschritte und Verfahren für die Diagnostik, die Planung und die Gestaltung von Interventionen sowie für die Evaluation.
Es liegen aktuell Methodiken für verschiedene Handlungsfelder der Sozialen Arbeit vor: KOFA (Kompetenzund risikoorientierte Arbeit mit Familie), KORJUS (Kompetenz- und Risikoorientierung für die Jugendstrafrechtspflege), KOPP (kompetenzorientierte Platzierung in Pflegefamilien). Weitere Methodikvarianten, z. B. für die Arbeit im Kindesschutz, für Besuchsbegleitungen und die Schulsozialarbeit sind in Vorbereitung (siehe für aktuelle Informationen www.kompetenzhoch3.ch).
In der stationären Jugendhilfe im deutschen Sprachraum ist die methodikgesteuerte Prozessgestaltung noch wenig verbreitet. Vielmehr entwickeln einzelne Leistungserbringer ihre je eigenen Konzepte, die als Grundlage für die Gewährung von Subventionen von den zuständigen Behörden eingefordert und als Orientierungsrahmen für die Mitarbeitenden genutzt werden. Diagnostische Verfahren und Instrumente fehlen weitgehend in den institutionseigenen Konzepten. Ressourcen- und Lösungsorientierung sowie systemische Ansätze unterschiedlicher Provenienz werden zwar relativ häufig erwähnt, sind aber selten als konkrete Handlungsmodelle mit entsprechenden Instrumenten standardisiert und evaluiert. Sie entstammen eher einer individual- oder familientherapeutischen Tradition, welche aber einen wenig konkreten Bezug zur Gestaltung des Alltags in außerfamiliären Settings hat. Weit verbreitet sind psychologische und psychiatrische Kodierungen von Problemverhalten und Interventionsstrategien im Kindes- und Jugendalter (v. a. für die Diagnostik), welche stark individuums- und problemzentriert sind. Die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und die Perspektiven der Eltern werden noch wenig theoretisch fundiert und methodisch strukturiert einbezogen und für die Interventionsplanung genutzt. Hier setzt KOSS als [20] Methodik mit einem theoretisch fundierten und integrativen Handlungsmodell an, das institutionsübergreifend und für eine Vielzahl von Klientenproblemen genutzt werden kann.
Modell für den ganzen Hilfeprozess
Die KOSS-Methodik versteht sich als Modell für den ganzen Hilfeprozess mit unterscheidbaren Prozessschritten. Die KOSS-Organisationen strukturieren ihre Arbeitsabläufe entlang den in der Abbildung 1 dargestellten Prozessschritten von der Fallaufnahme über Diagnostik und Indikation bis zu Hilfeplanung, Zielüberprüfung, Abschluss und Evaluation. Für die einzelnen Prozessschritte stellt die Methodik fachliche Grundlagen und die daraus abgeleiteten Instrumente (Gesprächsleitfaden, Beobachtungsraster, Berichtsvorlagen) zur Verfügung.
Tabelle 1: Prozessschritte im Rahmen der KOSS-Methodik
| Diagnostikprozess |
| 1. Fallaufnahme Das Klientsystem (Eltern mit Kindern) in einer belastenden Situation wird angemeldet von einer zuständigen Behörde/Stelle, die den Fall an eine stationäre Einrichtung weiterleitet mit einer Platzierungsanfrage. Auf der Basis vorliegender Informationen zur Familiensituation und zum Fokuskind erfolgt die Aufnahme. Vorliegende Akten und Gutachten werden eingeholt. |
| 2. Analyse/Sammeln von Informationen Neben den Vorakten und Informationen von involvierten Fachpersonen werden systematisch und transparent die Veränderungswünsche der Eltern und des Kindes sowie weitere Informationen zur Lebenssituation, zur Erziehungskompetenz der Eltern, zum Stand der Entwicklung und zur Ausgestaltung des sozialen Netzwerks eingeholt. Zudem werden bei gegebener Indikation psychologische Testungen durchgeführt. |
| 3. Diagnose/Fallverstehen/Fallkonzept Die gesammelten Informationen werden verdichtet mittels Hypothesenbildung und Beantwortung folgender Fragen: was ist mit diesem Kind, was in seiner Familie, in seiner Lebenswelt los, welche Risikofaktoren bestehen für die Entwicklung, welche Schutzfaktoren können für die Interventionsplanung genutzt werden? |
| 4. Indikation/Hilfeplanung Was braucht das Kind für eine gelingende Entwicklung? Welche Handlungsziele sollen mit der Platzierung erreicht werden? Welche Interventionen sind notwendig und geeignet zur Stabilisierung des Familiensystems sowie für die Befähigung der Eltern? Braucht es weitere Abklärungen? |
| Interventionsprozess |
| 5. Intervention Die formulierten Handlungsziele aus der Indikation werden in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und den Kindern/Jugendlichen als Arbeitspunkte konkretisiert. Es folgen partizipative Lern- und Veränderungsschritte, um die erarbeiteten Handlungsziele zu erreichen. |
| 6. Monitoring Im Interventionsprozess wird die Zielerreichung regelmäßig überprüft (Verlaufsdiagnostik, formative Evaluationen). Es werden – wenn sinnvoll – neue Ziele formuliert. |
| 7. Abschluss und Evaluation In der Austrittsphase erfolgt die summative Evaluation des gesamten Aufenthalts inkl. einer Kurzbefragung des Klientsystems in Bezug auf die Zusammenarbeit. Nach 6 Monaten wird die Nachhaltigkeit der Zielerreichung in einer Follow-up-Befragung überprüft. |
Primär- und Sekundärprozesse
[21] Für die Prozessgestaltung unterscheidet KOSS zwischen Primär- und Sekundärprozessen. Primärprozesse umfassen alle direkt klientbezogenen Schritte, d. h. alle Kontakte mit Eltern, Kindern und Akteuren in der Lebenswelt der Familie. Sekundärprozesse sind organisationsbezogene Prozesse und müssen in der Aufbau- und Ablauforganisation einer KOSS-Organisation geplant und strukturiert werden. Dazu gehören: Kommunikations- und Entscheidungsprozesse, Fallbegleitung und Fallcoaching, Controlling und Qualitätssicherung sowie die fallübergreifenden Evaluationen. Speziell zu beachten sind für die Arbeit in stationären Settings die Teamkonstellation und die Teamprozesse. Sozialpädagogische Arbeit erfolgt immer in einem Team, und die Wirksamkeit sozialpädagogischer Arbeit bemisst sich zu einem wesentlichen Teil an der Qualität der Teamzusammenarbeit.
Für die Praxis
Erfahrungen der letzten Jahre haben den Blick für die Sekundärprozesse geschärft. Definierte Kommunikations- und Entscheidungsprozesse sowie die fallbezogene Begleitung und Unterstützung der Fachpersonen erleichtern die Prozessgestaltung im Team, mit Kindern und deren Eltern und erhöhen die fachliche Qualität. Der Aufwand für diese Unterstützungsprozesse muss in der Abgeltung von KOSS-Leistungen ausgewiesen und von den Auftrag gebenden Behörden/Stellen als notwendiger Bestandteil der Leistung finanziert werden. Dies gilt auch für den Aufwand für Evaluationen.